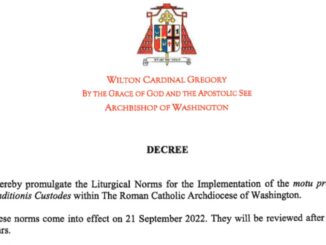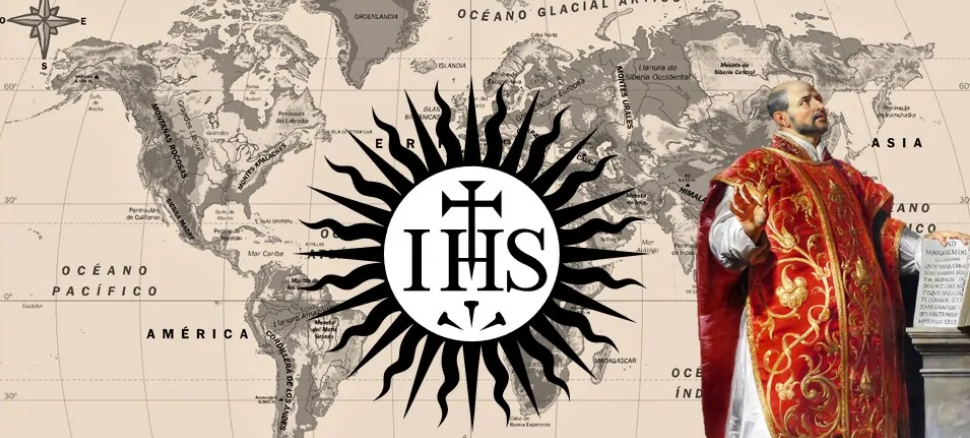
Von Wolfram Schrems*
Dieser Beitrag schließt unmittelbar an den 2. Teil vom 12. März, der sich mit dem Paragraphen 22 des Exerzitienbuches beschäftigte, an.
Exerzitienbuch § 365: „das Weiße als schwarz sehen, wenn es die Kirche so definiert“
Im letzten Teil des Ignatianischen Exerzitienbuches, den Regeln zum Fühlen mit der Kirche, findet sich folgende Regel:
„Die dreizehnte. Wir müssen, um in allem das Rechte zu treffen, immer festhalten: ich glaube, daß das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchische Kirche es so definiert. Denn wir glauben, daß zwischen Christus Unserem Herrn, dem Bräutigam, und der Braut, der Kirche, der gleiche Geist waltet, der uns zum Heil unserer Seelen leitet und lenkt, weil durch denselben Geist Unsern Herrn, der die Zehn Gebote erließ, auch Unsere Heilige Mutter die Kirche gelenkt und regiert wird“ (ebd., 112).
Wie man es dreht und wendet, diese Regel wirkt zunächst aufgrund des ersten Satzes problematisch. Zweierlei kommt nämlich sofort in den Sinn: Die Kirche „definiert“ nichts Weißes als schwarz. Und: Die Wirklichkeit kann durch die Kirche nicht umdefiniert werden.
Dennoch hat die Kirche das Exerzitienbuch anerkannt, somit auch diese Regel, die im zweiten Satz ja auch vom Heiligen selbst erklärt wird. Die Regel kann also nicht gegen den Glauben und die Gebote verstoßen.
Wie verhält es sich damit?
Konsultiert man Interpretationen durch Jesuiten selbst (Georg Sans), findet man zu dieser Regel folgende Erklärung:
Wir „sehen“ zwar den fürchterlich Mißhandelten und Gekreuzigten, „glauben“ aber auf das Zeugnis (oder die „Definition“) der Kirche hin, daß dieser Gott und auferstandener Herr ist. Wir „sehen“ die kirchliche Struktur in all ihrer Unvollkommenheit und mit sündigen Amtsträgern und Laien, „glauben“ aber auf das Zeugnis ebendieser Kirche hin, daß sie heilig ist.1
Nur so kann es Ignatius gemeint haben. Leider, so möchte man sagen, hat er sich aber nicht deutlicher ausgedrückt. Denn der Wortlaut dieser Regel legt nahe, die kirchliche Hierarchie könnte (gleichsam „nominalistisch“) Glaubensgut und Moral umdefinieren. Zumindest stellt sich das dem heutigen Beobachter so dar: Denn wir haben mit den Dokumenten des II. Vaticanums kirchliche Texte vor uns, die beispielsweise Falschaussagen über die falschen Religionen tätigen.2
Mit den Dokumenten von Papst Franziskus haben wir kirchliche Texte vor uns, die die Häresie begünstigen, Verwirrung verbreiten und in ökonomischen und ökologischen Fragen dilettieren.
Freilich wären solche Abartigkeiten dem hl. Ignatius und seinen Zeitgenossen nicht in den Sinn gekommen, und der Gesamtzusammenhang von Exerzitienbuch und kirchlichem Glauben schließt sie auch aus.
Man konnte zur Deutung dieser Regel auch hören, daß Dogmen, die sich wie in der Eucharistielehre und der Mariologie dem Verstehen des Gläubigen schwer erschließen und besonders anstößig klingen, einen erhöhten Vertrauensvorschuß benötigen, der eben durch diese massive Formulierung des hl. Ignatius illustriert werde. Das ist m. E. ein guter Gedanke.
Man versteht die Regel also richtig, wenn man sie im eben genannten Sinn und im Gesamtkontext des Glaubens interpretiert. Dazu gehört, daß es die hierarchische, lehrende Kirche ist, die sich verbindlich in einer dogmatischen Frage äußert und dabei Glaubensinhalte darlegt, die eben Glauben fordern, wie die leibliche Auferstehung Jesu, die Heiligkeit der Kirche und die Dogmen über die Eucharistie und die Gottesmutter. Beiläufige Kommentare eines Papstes oder gar häretische Aussagen egal welchen kirchlichen Amtsträgers sind selbstverständlich von dieser Regel nicht gedeckt.
Auch zur rhetorischen Untermauerung von Anordnungen kirchlicher Oberer in Führung und Verwaltung ist sie nicht gedacht.3 Wir stellen mit Bedauern fest, daß heute in der Kirche mehr Autoritarismus herrscht als je zuvor, weil man sich als Untergebener auf überhaupt nichts mehr berufen kann: Vielen Bischöfen und Ordensoberen sind die Inhalte des Glaubens und die Gebote der Moral in der Ausübung von Autorität schlichtweg egal.
Und dem Papst auch. Damit herrscht die völlige Willkür.
Resümee des 3. Teils
Es ist ein Erfahrungswert, daß sich große Katastrophen durch kleine und zeitlich oft weit entfernte Ursachen anbahnen. Von daher ist es sehr wichtig, die dreizehnte Regel zum Fühlen mit der Kirche, die für unsere Ohren zunächst schockierend klingt, richtig und im Gesamtkontext zu verstehen. Das Ignatianische Exerzitienbuch ist wie die gesamte ignatianische Spiritualität eine legitime (und besonders intensive) Art und Weise, den katholischen Glauben zu leben. Man muß wiederholen: den katholischen, also das Glaubensgut, das depositum fidei, wie es von den Anfängen durch Jesus Christus und die Apostel ohne Bruch auf uns gekommen ist. In dessen Dienst steht auch das kirchliche Lehramt, das weder neue Glaubensinhalte erfinden noch sie umdeuten kann. Das wäre dem hl. Ignatius auch nicht in den Sinn gekommen.
Resümee der Serie
Die beiden Regeln, die in dieser Artikelserie vorgestellt wurden, können falsch verstanden und falsch angewendet werden.4 Angesichts des Übermaßes an Häresie, Verrat, Blasphemie und Unverstand (Mk 7,22) im Jesuitenorden seit 1965 und seit 2013 auch auf dem Papstthron geht es natürlich nicht um einige überschießend oder falsch interpretierte Regeln des hl. Ignatius.
Es geht – ohne Übertreibung gesagt – um eine Abwendung von Gott und eine Hinwendung zum Fürsten dieser Welt, damit zwangsläufig zu dessen Handlangern in Politik, Finanz und Propaganda. Damit ist eine satanisch inspirierte Idolisierung der Welt Gegenstand kirchlicher Verkündigung, genauer gesagt, päpstlicher Propaganda geworden: Fjodor Dostojewski hat in seiner Parabel vom Großinquisitor (dazu ein Kommentar von 2017 anläßlich des frivolen Schmausens in der Kirche San Petronio in Bologna) ganz richtig erkannt, daß eine ungläubige Kirchenführung genau in diese Richtung gehen und das Geschäft des Widersachers besorgen muß.
Für einen Orden, der über vier Jahrhunderte hinweg eine der Säulen der Rechtgläubigkeit in der Kirche war, der die Unterscheidung der Geister vom Noviziat an lehrt und der im Exerzitienbuch (§§ 136ff) die Novizen zur Betrachtung der Banner Christi und des Satans anleitet, gibt es keine Entschuldigung dafür, sich der Agenda des Bösen und der Verwirrung verschrieben zu haben.5
In der Person von Papst Franziskus sind eben zwei Katastrophen vereinigt: eine Krise des Papsttums, manifest seit dem Pontifikat von Johannes XXIII. (ab 1958), und der Niedergang der Gesellschaft Jesu, manifest seit der Amtszeit des Generaloberen Pedro Arrupe (ab 1965). Papst Bergoglio kann sich für seine apostatische Politik und seine Auslieferung der Kirche an die Mächte der Welt und der Unterwelt weder auf den Apostelfürsten noch auf seinen Ordensstifter und dessen Exerzitienbuch berufen.
Schluß
Jesuiten und von ihnen geformte Ordensleute, Weltpriester und Laien haben seit den Tagen des hl. Ignatius zur größeren Ehre Gottes, zu ihrem eigenen Heil und dem Heil derer, für die sie arbeiteten, Gewaltiges hervorgebracht. Eine geheime, erfolgreiche Einflußnahme subversiver Kräfte im jungen Orden zum Zweck von dessen Umprogrammierung kann nicht festgestellt werden.6 Anzunehmen, die vielen Bemühungen, Leistungen und Martyrien so zahlreicher Jesuiten wären nur eine Deckung, um die wahren, subversiven und destruktiven Absichten zu verdecken, wäre verrückt.
Nein, es handelt sich um einen Abfall vom Glauben in neuerer Zeit. Dieser wurde nach Malachi Martin The Jesuits – The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (1987)7 untergründig in diskreten Zirkeln („brotherhood“) vorbereitet, die u. a. die Schriften von P. Teilhard de Chardin weitergaben, und brach auf der 31. Generalkongregation 1965/66 voll aus. Glaubenstreue Jesuiten, möglicherweise oder höchstwahrscheinlich zahlenmäßig in der Mehrheit, erlebten schwere Zeiten im Orden (oder traten aus).
Der Orden begann schnell zu schrumpfen.
Gleichzeitig biederte er sich den Mächtigen dieser Welt an.
Allerdings geschah diese Apostasie auch in anderen Orden. Man denke vor allem an das Chaos der Frauenorden in Westeuropa und Nordamerika. Die Priester- und Ordensberufe sind auf einen Bruchteil von vor 1965 gefallen. Mark Fellows bemerkt in Fatima in Twilight, daß nur die Pest des 14. Jahrhunderts mehr Priester und Ordensleute ausgelöscht habe als das II. Vaticanum.
Die Apostasie geschah in der ganzen Kirchenstruktur. Durch eine geheimnisvolle göttliche Zulassung werden die Christen, Gläubige und Amtsträger, auch die Päpste, vom Teufel versucht und „gesiebt“ (Lk 22,31).
Die Lauheit und Ehrfurchtslosigkeit in Klerus und Volk hatte gemäß der Botschaft von La Salette (19. September 1846) schon im 19. Jahrhundert den Boden für diese Einwirkungen des Bösen bereitet. Unsere Liebe Frau gab in Fatima klare Weisungen, um den Glauben im großen Maßstab wiederherzustellen. Diese Weisungen wurden, insofern sie an die Hierarchie gerichtet waren, nämlich Weihe Rußlands an das Unbefleckte Herz und Verkündigung der Sühnesamstage, nicht umgesetzt. Im gläubigen Volk war lange Zeit ein Bewußtsein für die Botschaft von Fatima vorhanden, nach dem Konzil verebbte es.
Wir resümieren: Der hl. Ignatius ist am gegenwärtigen Desaster des von ihm gegründeten Ordens und des Papsttums nicht schuld. Wie auch der hl. Petrus nicht schuld daran ist.
*Wolfram Schrems, Mag. theol., Mag. phil., kirchlich gesendeter Katechist, Pro Lifer
Bild: MiL
1 Zitat Sans: ‚Und drittens ist der eigentliche Grund für die Regel der, dass es in Glaubensaussagen um eine Erkenntnis im Heiligen Geist geht. Der Heilige Geist ist ein und derselbe in Christus und uns. Wir werden vom Heiligen Geist zu dem hingeleitet, was unser eigenes ewiges Heil ist.
Tatsächlich handeln alle Glaubensaussagen von der Verbindung von etwas Geglaubtem mit etwas Gesehenem. Im Glauben geht es um Gottes Selbstmitteilung an sein Geschöpf. Deshalb haben Glaubensaussagen immer die Struktur einer Einheit von Gegensätzen. Ich sehe den Gekreuzigten, einen zu Tode geschundenen Menschen. An dieser Sicht ist nichts unzutreffend; sie ist alles andere als bloßer Schein. Aber ich glaube an ihn als den Auferstandenen. Seine Gottessohnschaft angesichts des Todes ist seine Auferstehung. Dies ist keiner anderen Erkenntnis zugänglich als demjenigen Glauben, der das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist. »Niemand kann sagen: ›Jesus ist Herr‹, außer im Heiligen Geist.« (1 Kor 12,3)
Ähnliches gilt von der Kirche. Wir sehen eine Gemeinschaft von Menschen mit vielen Fehlern. Das ist kein Schein, sondern die volle Wahrheit. Aber wir glauben, dass Gott uns in der Glaubensverkündigung der Kirche seine eigene Gegenwart schenkt. Wir glauben immer Gegensätzliches zu dem, was wir sehen, ohne Letzteres dementieren zu müssen.‘
2 Nostra aetate 2: „So erforschen im Hinduismus die Menschen das göttliche Geheimnis und bringen es in einem unerschöpflichen Reichtum von Mythen und in tiefdringenden philosophischen Versuchen zum Ausdruck (…). In den verschiedenen Formen des Buddhismus wird das radikale Ungenügen der veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen mit frommem und vertrauendem Sinn entweder den Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen (…).“ Und NAe 3: „Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten (…). Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. (…) Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten.“ Lumen gentium 16: „Der Heilswille umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslim, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten wird“ (Zit. jeweils nach der offiziellen Vatikanseite www.vatican.va. Hervorhebungen problematischer und unzutreffender Aussagen WS). Nach Auffassung des Konzils beten also die Muslime als Muslime den alleinigen Gott an und bekennen sich als solche zum Glauben Abrahams. Das ist falsch. Die Darstellung der Religionen durch das Konzil kann natürlich auch so verstanden werden, daß das Konzil deren eigenes Selbstverständnis darlegen wollte. Das hätte man aber deutlich sagen müssen.
3 Vatikanexperte Hansjakob Stehle versteht diese Regel in seinem hochinteressanten Buch Die Ostpolitik des Vatikans, München 1975, in einem falschen Sinn, wenn er von dem Brief des Ordensgenerals W. Ledóchowski an Bischof Michel d’Herbigny, selbst ursprünglich Jesuit, schreibt, in dem Ledóchowski dem Bischof mitteilt: „‘Es wäre demütig und somit in Übereinstimmung mit der Institution des Ordens und mit dem Geiste des Heiligen Ignatius, bequem auch für den Heiligen Stuhl, wenn Sie durch Vermittlung des Paters General dem Heiligen Vater schriftlich Ihren Rücktritt von allen Ihren Tätigkeiten in Rom anbieten‘“ (190, leicht redigiert WS), und dann so kommentiert: „Dieses Schreiben des Jesuitengenerals enthielt keinerlei Begründung, aber auch keinen direkten Befehl (den Ledóchowski einem dem Papst unterstellten Bischof nicht geben konnte). Es war ‚nur‘ ein unmißverständlicher Appell an jenen Geist blinder Selbstverleugnung, für die der Ordensstifter Ignatius von Loyola die Regel aufgestellt hatte: ‚… bei dem Weißen, das ich sehe, zu glauben, es sei schwarz, wenn die hierarchische Kirche es so entscheidet…‘ (Exerc. Spirit.)“ (190f). Nachdem diese Regel eben die Glaubensdefinition durch die zuständige Autorität im Sinn hat (nämlich durch den Papst oder ein dogmatisches Konzil unter dem Papst), ist eine Anwendung auf eine so oder anders, nach der Klugheit zu wählenden Vorgangsweise in einer konkreten Situation nicht zulässig. Der Obere kann nicht zu einem Untergebenen sagen: „Was Sie als weiß sehen, ist schwarz, weil ich es so entscheide. Nun führen Sie das durch!“
4 Wir können zur weiteren Illustration des Mißbrauchs einer gesunden Regel ergänzen, daß man auch die übertriebene Selbstbespiegelung (als egozentrisches Um-sich-Kreisen im Rahmen der geistlichen Begleitung und Beratung oder auch im Rahmen von Sesselkreisen) als Fehlentwicklung der ignatianischen Spiritualität betrachten kann. Ignatius ruft zur Beobachtung und Analyse der inneren Regungen auf, die von Gott oder vom Teufel kommen können. Diese Unterscheidung der Geister ist eine wichtige Kunst im Inneren Leben. Wird sie aber aus dem katholischen Zusammenhang gerissen, also als rein humanistische Psychologie praktiziert, oder wird vom betreffenden Jesuitenoberen ein Frageverbot über die metaphysische Beschaffenheit der inneren Regungen verhängt, oder aber ufert die Selbstanalyse einfach über jedes gesunde Maß hinaus aus, dann kommt es zur Fehlentwicklung, zur Perversion von etwas Gutem und Sinnvollen. Auch das ist eingetreten.
5 Bekanntlich erklärte Generaloberer Arturo Sosa im Jahr 2017 und 2019 den Teufel zur „symbolischen Gestalt“, die „wir“ geschaffen hätten. Er revidierte allerdings diese Aussage. Dennoch ist die ursprüngliche Weginterpretation des Teufels symptomatisch für den Orden.
6 Ein Ex-Jesuit polnischer Herkunft namens Robert Maryks beschäftigte sich mit der Aufnahme von Konvertiten aus dem Judentum bzw. von deren Nachkommen in die junge Gesellschaft Jesu und mit dem Kampf zu deren Zurückdrängung aus Einflußpositionen ab dem 3. Generaloberen St. Franz von Borgia. Hier ein kurzes Interview. Bekannt ist, daß im Spanien des 14. und 15. Jahrhunderts tatsächlich das Phänomen der Scheinkonversion von Juden mit folgender Subversion der Kirche existierte. Einige der ersten Jesuiten hatten einen Converso-Hintergrund. Daß Lehre und Praxis des hl. Ignatius und des jungen Jesuitenordens allerdings davon im Sinne der Subversion beeinflußt worden wären, ist in keiner Weise evident. Daß es ernsthafte Bekehrungen von Juden gegeben hat und daß deren Nachkommen ebenfalls ernsthafte Christen gewesen sind, scheinen die, die das Hauptaugenmerk auf die „Rasse“ legen, auf die Abstammung und die DNS (vgl. Joh 8,33), nicht zu verstehen, weder Juden noch „Antisemiten“. Es geht aber in der Kirche nicht um die Rasse, sondern um den Glauben: In Christus ist nicht Jude und nicht Grieche, nach dem, was Paulus in Gal 3,28 sagt.
7 Der zeitgenössische katholische Autor Dr. E. Michael Jones, South Bend, Indiana, ist bezüglich der Person Malachi Martins (1921–1999) und des genannten Buches sehr kritisch. Er sagt, es enthalte viele Fehler. Nach zweiter Lektüre stellte ich tatsächlich einige irrige Jahreszahlen und falsche Ordnungszahlen bei Papstnamen fest. Alle diese und allfällige sonstige Schwächen widerlegen aber die Grundaussagen des Buches nicht. Ex-Jesuit Martin war zweifelsfrei eine schillernde Gestalt. Für mich gibt es aber keinen Grund, seinen Aussagen und Publikationen aus den 80er und 90er Jahren zu mißtrauen.
Die vollständige Reihe von Wolfram Schrems:
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (1. Teil)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – 1. Exkurs: Zum 60. Todestag von Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881–1955)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (2. Teil)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – 2. Exkurs: Karl Rahner und die Zerstörung der Theologie
- Der Jesuit auf dem Papstthron – 3. Exkurs: Töhötöm Nagy, „Jesuiten und Freimaurer“
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (3. Teil/1)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (3. Teil/2)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (3. Teil/3 und Schluß)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Epilog (1. Teil)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Epilog (2. Teil)
- Der Jesuit auf dem Papstthron – Epilog (3. Teil und Schluß)