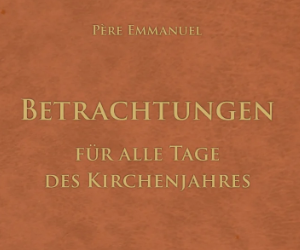(Brasilia) Brasilien ist ein stark umkämpftes Feld. Das hat mit dem gigantischen Staatsgebiet und mit der Größe seiner Bevölkerung zu tun. Klerus und Episkopat des portugiesischsprachigen Landes erlebten nach dem Zweiten Weltkrieg einen massiven Linksruck. Inzwischen steckt die kirchliche Hierarchie in der linken Sackgasse, aus der sie nicht mehr herauszufinden scheint.
Emblematisches Beispiel für diese Entwicklung ist Dom Hélder Câmara (1909–1999), der nicht von ungefähr 1964, während des Zweiten Vatikanischen Konzils, zum Erzbischof von Olinda und Recife ernannt wurde. Und nicht von ungefähr wurde sein Seligsprechungsverfahren unter Papst Franziskus eröffnet. Hélder Câmara war vor Kriegsende Anhänger des Faschismus und wechselte 1945, nach dessen vernichtender Niederlage, in das Lager des Sozialismus und wurde einer der führenden Vertreter der marxistischen Befreiungstheologie. Wesentlicher für die weitere Entwicklung Brasiliens war, daß er maßgeblich am Aufbau der Brasilianischen Bischofskonferenz mitwirkte und deren erster Generalsekretär wurde. Von seinem prägenden Einfluß (und dem anderer Befreiungstheologen) auf den Nachwuchs im Klerus und Episkopat rühren die engen Kontakte der heute in Brasilien tonangebenden Hierarchen zur linken Arbeiterpartei (PT) – und auch die Abneigung gegen den amtierenden Staatspräsidenten Jair Bolsonaro.
Bolsonaro war 2018 mit dem Motto „Brasilien zuerst, Gott über allem“ in den Wahlkampf gezogen. Die kirchliche Hierarchie setzte auf den Notkandidaten des PT. Der eigentliche Anführer der Arbeiterpartei, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasiliens Staatspräsident von 2002–2010 und Freund von Papst Franziskus, saß wegen Korruption im Gefängnis. Bolsonaro wurde mit 55 Prozent der Stimmen gewählt, womit niemand gerechnet hatte. Seither wird er, wie Donald Trump, von einer breiten Allianz aus politischer Linken und internationalem Establishment bekämpft. Und die Kirche hilft fleißig mit, etwa im Zuge der Amazonassynode, als Bolsonaro im Westen angegriffen wurde, weil kaum jemand über die Situation im Amazonasbecken Bescheid weiß. So konnte ein völlig „romantisiertes“, verzerrtes Bild von den Amazonas-Indios gezeichnet werden, während unterschlagen wurde, daß Bolsonaros Vizepräsident selbst ein Indio aus dem Amazonas ist.
Im Herbst 2022 finden Neuwahlen statt. Die Arbeiterpartei und Lula sinnen auf Vergeltung und werden wiederum aus dem Hintergrund von der brasilianischen Kirchenhierarchie und Papst Franziskus unterstützt. Um genau zu sein, erfolgt die Unterstützung bereits ganz offen. Der linke Klerus folgt darin dem amtierenden Papst, von dem man sich geschützt weiß. Franziskus war es, der bereits vor dem Urnengang von 2018 von einem „Putsch“ sprach, weil Lula sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht zu verantworten hatte. Die Botschaft lautete: Wenn nicht die politische Linke gewinnt, handelt es sich um einen „Staatsstreich“. Facebook, Twitter und Google reagierten nicht mit Löschungen wegen Verbreitung von „Fake News“.
Entsprechend ist auch die Berichterstattung der europäischen Mainstream-Medien, die sich im Besitz des globalistischen Establishments befinden und deren Redaktionen mit linksgerichteten Journalisten angefüllt sind. Das jüngste Beispiel sind die Berichte über die Feiern zum brasilianischen Unabhängigkeitstag. Brasiliens Unabhängigkeit von Portugal war am 7. September 1822 proklamiert worden. Bolsonaro rief zu Kundgebungen „für die Freiheit“ auf. Allein in der Bundeshauptstadt Brasilia nahmen über eine Million Menschen daran teil. Parallel fanden gigantische Freiheits-Kundgebungen auch in anderen großen Städten wie São Paulo und Rio de Janeiro statt. Bolsonaro, dessen Rede yu allen Kundgebungen landesweit [bertragen wurde, warnte erneut vor der Corona-Impfung und dem Einfluß von Big Pharma und Big Tech und versucht sein Land aus den Großmanövern für den Great Reset herauszuhalten, die hinter den Kulissen stattfinden. Die Arbeiterpartei und das internationale Establishment nützen die Corona-Krise seit Monaten, um Brasilien zu destabilisieren. Teile der brasilianischen Justiz, die auch für die aus formalen Gründen erfolgte Enthaftung Lulas und die Niederschlagung der Korruptionsverfahren gegen ihn verantwortlich sind, versuchen im Gleichschritt mit den Internet-Riesen die Kommunikationskanäle Bolsonaros abzuwürgen. Die Entwicklung erinnert an jene in den USA und in Europa: Man erinnere sich an das Löschen von Nachrichten und schließlich das Sperren von Donald Trumps Kanälen durch Facebook und Twitter mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Gegen Bolsonaro gibt es seit dem Sommer 2020 ein ähnliches Vorgehen, das zunehmend aggressiver wird, je näher der Wahltermin rückt. Als Vorwand dient den Internet-Quasi-Monopolisten auch in diesem Fall die angebliche Verbreitung von „Fake News“ oder „Haßreden“. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Es geht um einen massiven Versuch der Wahlbeeinflussung, wie die Computeranalystin Laura Edelson von der New York University nachweisen konnte, die übrigens auch die Bundestagswahl beobachtet.

„Politische Propaganda“ in den Kirchen unerträglich
Die seit Jahrzehnten andauernde einseitige Neigung der kirchlichen Hierarchie in Brasilien führte zu einem ungeahnten Exodus. Der Anteil der Katholiken belief sich 1950 auf über 90 Prozent, inzwischen laut dem PEW Research Institute nur mehr auf etwa 60 Prozent der Bevölkerung. Millionen brasilianischer Katholiken haben der Kirche den Rücken gekehrt und sind zu evangelikalen und pfingstlerischen Gemeinschaften abgewandert. Aus deren Reihen rekrutiert der Katholik Bolsonaro einen Teil seiner Wählerschaft. Auch Bolsonaros Frau gehört einer Freikirche an. Mehr als die Hälfte der brasilianischen Freikirchler sind ehemalige Katholiken. Gerade sie sind konservativ eingestellt und verteidigen die natürliche Ordnung, Ehe und Familie und das Lebensrecht ungeborener Kinder.
Trotz des Erosionsprozesses hält der dominante Teil des brasilianischen Episkopats an seinem Linkskurs fest. Don Nicola Bux, einer der bekanntesten Liturgiker und persönlicher Freund Benedikts XVI., bereiste 2012 Brasilien und überzeugte sich, daß es ein fruchtbarer Boden für die Tradition wäre. Doch die Oberhirten waren nicht offen für eine solche Anregung. Im Sommer 2020 unterzeichnete jeder dritte Bischof des Landes einen direkten Angriff gegen Bolsonaro. Katholisches.info bezeichnete das als „Brasiliens Tragödie“. Dabei war es Bolsonaro, der wenige Monate nach seinem Amtsantritt 2019 das Land dem Unbefleckten Herzen Mariens weihte. Eine Initiative, die von den Bischöfen durch Nichtbeachtung gestraft wurde.
Doch damit nicht genug. Inzwischen greifen linke Priester und Bischöfe die Gläubigen in den Gottesdiensten an und provozieren damit wachsenden Unmut. Das Hauptinstrument einer krassen politischen Propaganda ist das Mikrophon-Monopol der „PT-Bischöfe und ‑Priester“ (PT = Arbeiterpartei), wie sie genannt werden. Brasilianische Katholiken sprechen von „Anfeindung“ und „Intoleranz“ durch manche Kleriker, die ein fast unerträgliches Ausmaß angenommen haben.
Die offene Feindseligkeit gegen glaubenstreue Katholiken ist in den sozialen Netzwerken noch ungezügelter, da offenbar durch die physische Distanz auch Kleriker die Kontrolle verlieren.
Verlangte die Kirche unter den linken Staatspräsidenten Lula und Dilma Rousseff (beide PT) „Respekt“ vor den „demokratisch gewählten Amtsträgern“, ist davon seit der Wahl Bolsonaros nichts mehr zu hören. Es scheint der Grundsatz zu gelten, daß nur die politische Linke die politische Macht im Staat innehaben darf, womit in Brasilien die Arbeiterpartei (PT) gemeint ist. Lula da Silva sagte es im Januar 2020 in einem Interview: „Papst Franziskus denkt wie wir“.
Katholiken, die die christlichen Werte verteidigen, fühlen sich aber von jenen vertreten, die sich ausdrücklich gegen diese Werte stellen. Wie ist es möglich, Politikern zuzustimmen, die Programme vertreten, die mit der katholischen Sozial- und Morallehre unvereinbar sind? Bolsonaro mag weit davon entfernt sein, der Inbegriff eines perfekten Präsidenten zu sein, aber es ist unbestreitbar, daß er der kirchlichen Sozial- und Morallehre in vielen Punkten näher steht. Ein nicht unerhebliches Indiz dafür ist, daß er dem globalistischen Establishment mißfällt.
Der progressive Klerus gibt vor, daß die Linksparteien christlich seien, und verteidigt sie, als wären sie Herolde eines neuen Christentums, das es zwar noch nicht gibt, das aber im Kommen sei.
Tatsache ist, daß die Katholiken des Landes orientierungsloser denn je scheinen. Die Priester und Bischöfe mit guter Gesinnung, die es auch in Brasilien gibt, bleiben trotz der Not zurückhaltend, sie scheinen eingeschüchtert, während ihre sozialistischen Mitbrüder die Ideologie einer Partei offen und schamlos verbreiten.
Fassungslose Kirchgänger
Geprügelt, fassungslos und verärgert fühlen sich Katholiken von ihrer eigenen Kirche nicht mehr angenommen und vertreten, während sie von den Freikirchen, mit denen sie dieselbe Weltanschauung teilen, mit offenen Armen empfangen werden. Man muß kein Hellseher sein, um zu erahnen, wie das in vielen Fällen enden wird.
Die Kirche „der einen Partei“, deren einziges Dogma die „Unfehlbarkeit“ der politischen Linken ist, verliert täglich mehr an Glaubwürdigkeit und durch ihre Inflexibilität auch an Gläubigen.
In der katholischen Kirche Brasiliens ist es mittlerweile quasi Pflicht, links zu sein. Auch die kleinste Abweichung wird nicht geduldet. Im Zweifelsfall zögern die Hirten nicht, die Gläubigen zu opfern. Alle werden verpflichtet, die linke Politik in allem, was sie tut, zu schlucken, denn nur so findet man in der Kirche Akzeptanz und kann ein friedliches Leben haben. Das bloße Schweigen genügt nicht mehr. Es ist notwendig, links zu predigen, links aktiv zu sein und zu verteidigen, was die Linke auf ihre Fahnen schreibt, um nicht von Priestern oder Bischöfen vor die Tür gesetzt zu werden.
Natürlich erfolgt die Ausgrenzung nicht unter Nennung der wahren Gründe. Dafür werden bekannte Knüppel aus dem Sack geholt, wie es die politische Linke seit Jahrzehnten praktiziert. Die Vorwürfe lauten auf Rechtsextremismus, Faschismus, Rassismus, Autoritarismus, Spaltung, Haßrede usw. Die bereits erwähnte Berichterstattung über die Freiheits-Kundgebungen Bolsonaros am Unabhängigkeitstag belegt es. Die Tagesschau der ARD und selbst das SRF der außenpolitisch zurückhaltenden Schweiz diskreditierten in ihren Berichten Bolsonaro als „rechtsextrem“ und die Freiheits-Kundgebungen als Aktion von „Rechtsextremisten“.
„Das Delirium dieser Köpfe ist spektakulär. Wie können sie die Wahrnehmung der Realität auf diese Weise auf den Kopf stellen?“, schrieb die traditionsverbundene brasilianische Seite Fratres in Unum. „Das brasilianische Volks versteht sehr gut, was vor sich geht und wer die Machthaber sind, die Machtmißbrauch betreiben.“
Die Seite fragt sich allerdings auch, wie es sein kann, „daß wir so weit gekommen sind?“ Die Antwort, die sie darauf gibt:
„Es waren die Jahrzehnte marxistischer Indoktrination in Seminaren und religiösen Gemeinschaften, Jahrzehnte der Gehirnwäsche des Klerus. Wie Gramsci voraussah, hat es die Kulturrevolution geschafft, den Marxismus in eine allgegenwärtige Macht zu verwandeln, die die gesamte Denkweise bestimmt. Selbst wenn die Arbeiterpartei PT öffentlich vernichtet wäre und Lula nicht einmal mehr im Nordosten in Ruhe spazieren gehen könnte, wird der kirchliche Petismus [die Doktrin der Arbeiterpartei] fortbestehen, denn er ist das Ergebnis von religiösem Fanatismus und emotionaler und psychologischer Manipulation. Wann werden wir den Tag der Unabhängigkeit der katholischen Kirche in Brasilien feiern?“
Das wisse man nicht, aber bis dahin müsse man standhaft bleiben und so stark sein, es auch zu ertragen, „von den eigenen Vätern gehaßt zu werden, wie es unser Herr sagte“, so Fratres in Unum.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Fratres in Unum/MiL (Youtube/Screenshot)