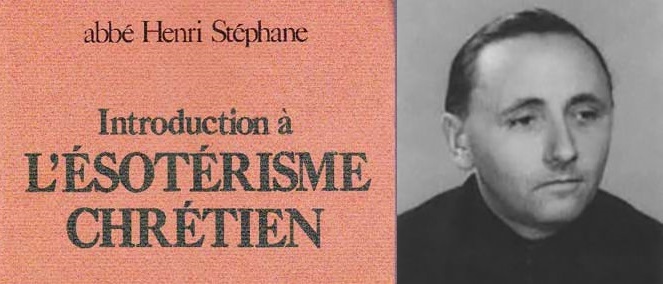
Von P. Paolo M. Siano*
Der Priester André Gircourt (1907–1985), den Liebhabern der Esoterik besser bekannt als Abbé Henri Stéphane, ist Autor von Schriften, die in zwei Bänden veröffentlicht wurden (1. Band: 1979; 2. Band: 1983) in den Éditions Dervy in Paris, einem auf freimaurerische und esoterische Literatur spezialisierten Verlag. Im Jahr 2006 sammelten die Éditions Dervy alle Texte des ersten und die Haupttexte des zweiten Bandes in einem einzigen Buch: Henri Stéphane, Introduction à l’ésotérisme chrétien (Einführung in die christliche Esoterik), Zusammenstellung und Anmerkungen von François Chenique, Vorwort von Jean Borella, Editions Dervy, Paris 2006, 518 Seiten. Im Vorwort (S. 7–17) bietet der guénonische Gelehrte Jean Borella eine kurze Biographie von Abbé Gircourt. Schauen wir sie uns an.
Als junger Mann begeistert ihn die Mathematik und er unterrichtet ein Jahr lang an einem Lycée (Oberstufengymnasium). Als seine Heiratspläne scheitern, tritt er in ein Priesterseminar ein. Am 26. Mai 1940 wird er zum Priester geweiht und als Professor für Mathematik und Religionsunterricht am kleinen Seminar von Nancy eingesetzt. Seit 1942 erwacht Gircourts Leidenschaft für das esoterische Denken von René Guénon. Im Seminar spricht er mit einigen Schülern offen über Symbolik, hinduistisches Denken und gibt ihnen die Bhagavad Gita zu lesen. Darauf entzieht ihm der Bischof von Nancy die Vollmacht, die Beichte zu hören, und verweist ihn seines Bistums. Gircourt findet eine Anstellung als Mathematikprofessor in Versailles an der von Jesuiten geführten Schule von Sainte-Geneviève, bekannt als Ginette, wo er von 1943 bis 1971 unterrichtet. Dort freundet sich Gircourt mit dem Jesuiten P. Pierre Leroy an, Freund und Schüler von P. Teilhard de Chardin, und auch mit Jean Palou, der Französisch unterrichtet und Freimaurer ist. Laut Borella weigert sich Gircourt, sich der Freimaurerei anzuschließen.

Seit 1943 setzt Abbé Gircourt seine Studien zum guénonischen Denken fort und trifft sich mit Louis Charbonneau-Lassay, der ihn in die Fraternité des Chevaliers du Divin Paraclet (Bruderschaft der Ritter des göttlichen Parakleten, siehe dazu hier) aufnimmt. Gircourt widmet sich auch dem esoterischen Denken von Frithjof Schuon (1907–1998).
Zwischen 1974 und 1976 feierte Gircourt im Einvernehmen mit seinem Bischof für eine Gruppe von Gläubigen die „tridentinische“ Messe in der Kirche Notre-Dame-des-Armées in Versailles. Wie wir sehen werden, hielt Gircourt auch in dieser Zeit, in der er sich als antimodernistischer katholischer Priester präsentiert, an der guénonischen Esoterik fest. 1976 hatte er Gehirnprobleme. Er starb 1985 in einem Pflegeheim in Nancy.
Laut dem guénonischen Gelehrten Jean Borella ist Gircourts authentische christliche Esoterik nichts anderes als eine spirituelle Vertiefung innerhalb der christlichen Offenbarung und der katholischen Lehre (S. 16). Borella behauptet die volle Katholizität der christlichen Esoterik von Abbé Gircourt. In Wirklichkeit ist dem nicht so. Wenn Gircourt auch tatsächlich einerseits die nachkonziliare Moderne in Frage stellt, die Mariologie und die traditionelle Liturgie verteidigt und den traditionalistischen Widerstand unterstützt (S. 46, 57–60, 177, 426, 441f, 487f), macht er sich andererseits guénonische, neo-hinduistische und neo-gnostische Konzepte und Inhalte zu eigen (z. B. Nicht-Dualität, Manifestation, Absorbierung im Zentrum …), um die Geheimnisse und Dogmen des katholischen Glaubens zu „vertiefen“. Ich werde nur einige Punkte seines Denkens veranschaulichen.
- Gircourt verteidigt das guénonische Denken, zum Beispiel das der „l’Unité transcendante des religions“ (der transzendenten Einheit der Religionen).
- Gircourt hält das guénonische Denken und das Christentum für vereinbar (S. 437).
- Gircourt behauptet, daß die Göttlichkeit jenseits von Sein und Nichtsein und jenseits logischer Kategorien steht (S. 79).
- Laut Gircourt ist Gott weder gut noch schlecht, sondern übersteigt alle Unterscheidungen (S. 155).
- Die Dualität männlich-weiblich, links-rechts, gut-böse usw. wird dort in dem Einen wieder zusammengeführt, wo alle Gegensätze sich auflösen (S. 230f).
In der Meditation über das Selbst oder Atman fügt Gircourt Psalmen, hinduistische Lehren und Texte von Eckart und Guénon zusammen, indem er mit Leichtigkeit von einem zum anderen übergeht. Gircourt schreibt, daß die Anrufung Jesus-Maria der Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Surrealen oder, um es mit dem Hinduismus auszudrücken, Âtmâ und Maya entsprechen würde (S. 92–95).
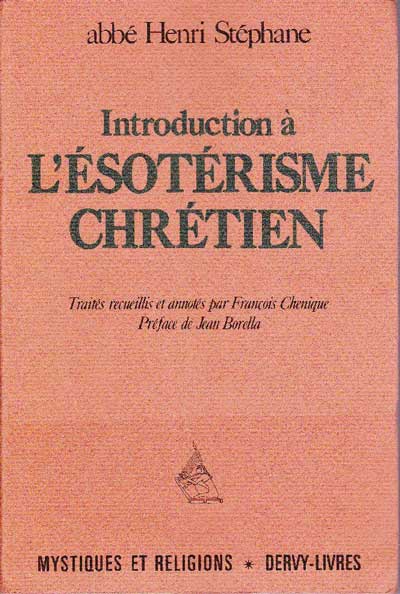
Auch die Mariologie von Gircourt ist voller Esoterik: Um das Dogma der Unbefleckten Empfängnis zu vertiefen, bevorzugt Gircourt die von Rene Guénon erläuterte hinduistische Metaphysik (S. 119–124). Gircourt versteht Gott als das höchste Prinzip, das jenseits aller Formen und aller Unterscheidungen liegt und alles in seiner Einheit oder Nicht-Dualität umfaßt und einschließt („Non-Dualité“). Die universelle Manifestation dieses Prinzips, d. h. der Schöpfung, müsse von einem Doppelprinzip („un double principe“) ausgehen, männlich und weiblich, das Purusha und Prakriti genannt wird (hinduistische „Tradition“), Yang und Yin (Taoismus), das Schöpferwort und die Jungfrau (jüdisch-christliche Tradition), Osiris und Isis (altes Ägypten), Adam und Eva (Genesis) … Gircourt behauptet, daß Christus ein Symbol für das aktive Element der Regeneration ist, Maria ein Symbol für das passive Element der Regeneration (S. 119–121).
Gircourt erkennt an, daß seine Herangehensweise an die Mariologie, die Christologie und die Sakramente „ésotérique“ ist und schlägt ein Verständnis der Göttlichkeit vor, das jenes der mittelalterlichen Scholastik überwinden und sich auf die Vedanta des Hinduismus stützen soll. Im neo-hinduistischen oder guénonischen Kontext wird die Unbefleckte Empfängnis verstanden als: universelle Möglichkeit, ursprüngliche Indifferenzierung, nicht manifestiertes weibliches Prinzip, Prakriti, ursprüngliche universelle Substanz oder Materie, Shakti, Aspekt der göttlichen Essenz (S. 123–125, 263f).
Gircourt behauptet die Androgynie (männlich-weibliches Wesen) Gottes, des ursprünglichen Adam und Christi, der als Wiederhersteller des Androgynen verstanden wird (S. 135, 187–189).
Gircourt zitiert auch begeistert eine Stelle, in der die Apokatastasis des Origenes bekräftigt wird.
Ich fasse zusammen: Der Archetypus Christi, Prinzip der Integration und Rekapitulation, trägt einen absoluten Universalismus in sich und postuliert die Apokatastasis, d. h. die Wiederherstellung der ursprünglichen Gesamtheit, einschließlich der Erlösung Satans (S. 167).
Auch im Zusammenhang mit dem Opfer der Heiligen Messe sind Gircourts Überlegungen von der hinduistischen und guénonischen Gnosis geprägt. Gircourt präsentiert:
- die Schöpfung als Opfer-Zerstückelung Gottes;
- jede Kreatur als „Glied“ Gottes;
- die Erlösung als Neuzusammensetzung der Glieder Gottes;
- die Welt (Schöpfung und Geschöpfe) als Illusion, da von Gott getrennt, aber Gott an sich steht jenseits aller Trennung …
- Sünde ist nichts als Trennung von dem Einen, daher ist Sünde oder Böses der Schöpfung als solcher inhärent (S. 319f).
Gircourt bekräftigt die „essentielle Übereinstimmung“ (S. 332) zwischen dem Opfer Christi und dem Opfer des Göttlichen, wie es im Hinduismus verstanden wird: Das Eine, die Nicht-Dualität, das Ganze ist im Prinzip enthalten, das Drache genannt wird, der getötet und zerstückelt werden muß, damit sich die Universelle Möglichkeit verwirklicht, die Existenz der Dinge oder Manifestationen … Der Tod des Drachen ist nur Schein, er bleibt das Ganze, das in die „Dinge“ zerstückelt ist … Der Drache/das Opfer und der göttliche Mörder sind eins. Das ist das hinduistische vedische Opfer (S. 332f).
So wie die Philosophie eine Suche sein sollte, ein Verzicht auf das Definitive und den Anspruch, das Universum in Definitionen zu verkapseln, so sollten die Religion und das religiöse Leben keine Gesamtheit von Beziehungen zwischen Gott und Mensch sein, die durch Dogmen und Canones bestimmt werden, sondern eine Suche nach Gott als Suche nach dem Transzendenten, das uns immanent ist (S. 340).
Den Epilog des Buches bildet ein kurzer Text über Gott vom Juni oder Juli 1976. Auf die Frage „Was ist Gott?“ antwortet Gircourt, daß es darauf keine Antwort gebe und zitiert Lao-Tse, laut dem nichts über das Prinzip gesagt werden könne … Dann merkt Gircourt Folgendes an: Für den Islam ist Gott der Einzige; auf dem Sinai offenbart sich Gott als der Existierende; in Indien wird Gott als das Höchste Selbst oder die Höchste Leere betrachtet, die die Höchste Fülle ist. In der christlichen Offenbarung offenbart sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist …
Nach Gircourt sind das alles verschiedene Wege der Offenbarung Gottes („Ces différents modes de la Révélation“), und der Mensch müsse auf die Art und Weise hören, wie Gott zu ihm spricht (S. 499).
Kurz gesagt, das von Gircourt und seinen Schülern versuchte Experiment einer „christlichen“ Esoterik kann nicht gelingen, denn sie ist weder christlich noch katholisch.
*Pater Paolo Maria Siano gehört dem Orden der Franziskaner der Immakulata (FFI) an; der promovierte Kirchenhistoriker gilt als einer der besten katholischen Kenner der Freimaurerei, der er mehrere Standardwerke und zahlreiche Aufsätze gewidmet hat. Von Katholisches.info bisher veröffentlicht:
- Die Zweideutigkeit der „christlichen“ Esoterik II
- Die Zweideutigkeit der „christlichen“ Esoterik I
- Deismus, Esoterik und Gnosis in den freimaurerischen Konstitutionen von 1723
- Spuren von Esoterik und Gnosis in der Freimaurerei vor 1717
- „Luzifer“ für Österreichs Freimaurer
- Das Freimaurer-Lexikon von Eugen Lennhoff 33. und Oskar Posner und der Dialog zwischen Kirche und Freimaurerei 1974–1980
- Die freimaurerische Doktorarbeit von Msgr. Weninger
- Bruder.·. Peter Stiegnitz von der Großloge von Österreich (1936–2017)
- Der „Fall Weninger“ – Ex-Diplomat, Priester, Kurialer, Freimaurer
Die Freimaurerei erklärt von einem Großmeister - Den Anklopfenden erwarten beim Freimaurerbund Initiation und Gnosis
- Baron Yves Marsaudon – Ein Hochgradfreimaurer im Malteserorden
- Die Loge Quatuor Coronati, der Großmeister und ein Bettelbruder
- „Katholik, der Loge beitritt, ist exkommuniziert“ – Kirchenhistoriker Paolo M. Siano über Kirche und Freimaurerei
- Kurze Antwort an einen Großmeister der Freimaurerei
- War Karl Rahner Freimaurer?
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana


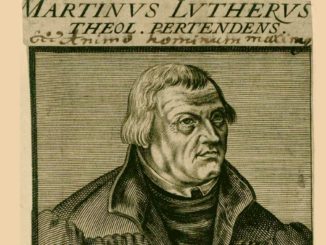


Jedenfalls eine interessante Persönlichkeit. Mich wundert oder überrascht es überhaupt nicht, dass er an der überlieferten heiligen Messe festgehalten hat. Im Gegenteil, das taten fast nur auf die eine oder andere Weise originelle, individuelle und eigenwillige Priestergestalten.