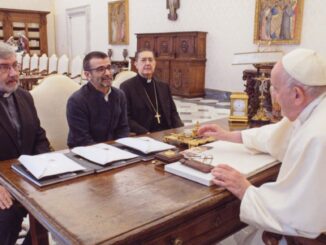Nach vier Monaten im Amt und dem am Sonntag begangenen 70. Geburtstag steht der Umzug aus dem Palast des Heiligen Offiziums in den Apostolischen Palast bevor. Doch nicht nur das: Auch die Veröffentlichung der ersten Enzyklika von Papst Leo XIV. kündigt sich an.
In der Diözese Rom will der neue Papst eigene Wege gehen – andere als sein Vorgänger. In der Migrationsfrage jedoch scheint er in dessen Fußstapfen treten zu wollen: So äußerte er den Wunsch, „bald“ die Insel Lampedusa zu besuchen. Doch der Reihe nach:
Bergoglianische Nachwehen
Seine erste apostolische Exhortatio, den Armen gewidmet, soll Anfang Oktober veröffentlicht werden. Wie zu erwarten, handelt es sich dabei um einen vollständig von seinem Vorgänger, Papst Bergoglio, übernommenen Text – wie Leo XIV. selbst in der Einleitung des Dokuments offenlegt. Der Text wurde zwar übernommen, jedoch, wie es heißt, „überarbeitet“ – offenbar, um ihn stärker an die pastoralen Schwerpunkte des neuen Pontifikats anzupassen.
Damit folgt Leo XIV. einem Vorgehen, das Franziskus selbst zu Beginn seines Pontifikats wählte: Unter seinem eigenen Namen veröffentlichte er die Enzyklika Lumen Fidei, die über den Glauben handelt, aber noch von Benedikt XVI. verfaßt worden war. Sie bildete den Abschluß einer Trilogie über die theologischen Tugenden, die der deutsche Papst mit Deus Caritas Est und Spe Salvi begonnen hatte.
Allerdings ist anzumerken, daß diese „Höflichkeitsveröffentlichung“ im weiteren Verlauf des bergoglianischen Pontifikats keinerlei Bedeutung mehr erlangte. Die Aufmerksamkeit des argentinischen Kirchenoberhaupts galt fortan ganz anderen, eigenen Texten – von denen einer umstrittener war als der andere.
Abgesehen davon ist an dieser Stelle eine kleine Klammer aufzutun: Wenn Benedikt XVI. so großen Wert auf die Vollendung seiner Trilogie legte und der Text der letzten Enzyklika bereits fertiggestellt war, drängt sich unweigerlich die Frage auf: Warum blieb er nicht zumindest so lange im Amt, um sie selbst zu veröffentlichen? Der überraschende Amtsverzicht Benedikts im Februar 2013 bleibt ein Rätsel, das bis heute keineswegs entschlüsselt ist.
Dunkle Schatten liegen über diesem Rücktritt: etwa die völlig ungewöhnliche Rücktrittsaufforderung durch Kardinal Carlo Maria Martini SJ im Juni 2012; der zeitlich so erfolgte Rücktritt, daß Kardinal Walter Kasper – einer der Vordenker und Organisatoren des folgenden bergoglianischen Pontifikats – gerade noch aufgrund von wenigen Tagen stimmberechtigt am Konklave teilnehmen konnte; und nicht zuletzt der Ausschluß des Vatikans aus dem SWIFT-System durch US-Präsident Barack Obama, um nur drei zu nennen. Aber das ist ein anderes Thema.
Franziskus erklärte seine bis dahin ungewöhnliche Entscheidung zu Lumen Fidei mit den Worten, daß sein unmittelbarer Vorgänger „praktisch bereits einen ersten Entwurf dieser Enzyklika über den Glauben fertiggestellt hatte. Ich danke ihm von Herzen und übernehme in der brüderlichen Gemeinschaft in Christus seine wertvolle Arbeit, wobei ich dem Text einige eigene Beiträge hinzufüge. Der Nachfolger Petri ist – gestern, heute und immer – dazu berufen, seine Brüder im unermeßlichen Schatz des Glaubens zu bestärken, den Gott als Licht auf dem Weg eines jeden Menschen schenkt.“ Leo XIV. hat sich diese Worte zu eigen gemacht, sozusagen als symbolischer Staffelstab von seinem direkten Vorgänger – da hält offenbar eine neue Praxis Einzug im Vatikan. Die demnächst zur Veröffentlichung anstehende Apostolische Ermahnung über die Armen steht daher in unmittelbarer inhaltlicher Kontinuität mit den beiden großen Sozialenzykliken von Franziskus: Laudato si’ und Fratelli tutti.
Das erste wirkliche Dokument von Leo XIV.: eine Enzyklika zur Künstlichen Intelligenz
Um das erste Grundsatzdokument von Leo XIV. selbst lesen zu können, wird man hingegen bis Anfang 2026 warten müssen. Dann wird der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri tatsächlich seine erste Enzyklika unterzeichnen, die der Künstlichen Intelligenz gewidmet sein wird.
Die Rede ist von einer neuen Enzyklika Rerum novarum – jener berühmten Enzyklika, mit der Leo XIII. im Jahr 1891 die Soziallehre der katholischen Kirche begründete. Die Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das dem neuen Papst sehr am Herzen liegt. Das erklärte er selbst gleich nach seiner Wahl und bestätigte es wenige Tage später gegenüber den Kardinälen. Dabei erläuterte er, warum er den gleichen Namen wie Leo XIII. gewählt habe:
„Es gibt mehrere Gründe, doch der wichtigste ist, daß Papst Leo XIII. mit seiner historischen Enzyklika Rerum novarum die soziale Frage im Kontext der ersten großen industriellen Revolution behandelte – und heute bietet die Kirche allen Menschen ihren Schatz an Soziallehre an, um auf eine neue industrielle Revolution und auf die Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz zu antworten, die neue Herausforderungen für die Verteidigung der menschlichen Würde, der Gerechtigkeit und der Arbeit mit sich bringen.“
Am Samstag wiederholte Leo XIV. diese Aussage in seiner Ansprache bei der Audienz, die er den Teilnehmern eines vom Päpstlichen Theologischen Institut unterstützten Symposiums gewährte:
„Ein bedeutendes Zeugnis des Wissens um den Glauben im Dienst des Menschen – in all seinen Dimensionen, persönlich, sozial und politisch – ist die Soziallehre der Kirche, die heute dazu aufgerufen ist, auch auf die digitalen Herausforderungen kluge Antworten zu geben. Die Theologie ist dabei direkt gefordert, denn ein rein ethischer Zugang zur komplexen Welt der Künstlichen Intelligenz reicht nicht aus; vielmehr ist es notwendig, sich auf eine anthropologische Sichtweise zu beziehen, die das ethische Handeln begründet, und somit zur ewigen Frage zurückzukehren: Wer ist der Mensch? Was ist seine unendliche Würde, die sich auf keinen digitalen Androiden reduzieren läßt?“
Andere Wege als Franziskus in der Diözese Rom
Andere Wege als sein Vorgänger Franziskus will Leo XIV. hingegen in der Diözese Rom gehen, konkret im Vikariat Rom, also dem weitaus größeren Teil der Diözese, der außerhalb des Vatikans liegt. Sein Reform sieht unter anderem die Wiedereinsetzung von Weihbischöfen für die fünf Sektoren der Diözese vor – einschließlich des Zentralsektors (Altstadt), der von Franziskus abgeschafft worden war, was im Klerus für erheblichen Unmut gesorgt hatte. Leo XIV. fühlt sich offenbar auch tief mit seiner Berufung als Bischof von Rom verbunden. Doch anders als sein Vorgänger, der in dieser Betonung eher einen symbolischen und strategischen Ansatz verfolgt, scheint es Leo XIV. ernst zu meinen und setzt daher Zeichen der Nähe zu seinem Klerus.
Dazu paßt es, daß Leo XIV. gegenüber Kardinal Baldassare Reina, seinem Generalvikar für die Diözese Rom, klarmachte, daß er selbst die Auswahl der neuen Weihbischöfe vornehmen werde, ohne – wie es unter Franziskus üblich war – Vorgaben des Vikariats zu akzeptieren. Leo XIV. äußerte zudem sein tiefes Unbehagen darüber, daß der Regens des Päpstlichen Römischen Priesterseminars ein Bischof ist – und zudem noch aus dem Ambrosianischen Ritus stammt. Franziskus hatte den aus Mailand stammenden Michele Di Tolve im Mai 2023 zum Weihbischof von Rom und wenige Wochen später, im Juli 2023, auch zum Regens des römischen Priesterseminars ernannt. Di Tolve war zuvor Regens des Priesterseminars der Erzdiözese Mailand. In Di Tolves Amtszeit hatte sich die Zahl der Seminaristen im Mailänder Priesterseminar halbiert.
Leo XIV. möchte nach Lampedusa: Wird das Migrations-Narrativ neu aufgelegt?
Politisch brisanter ist, daß Leo XIV. den Wunsch äußerte, „bald“ die Insel Lampedusa besuchen zu wollen – jenes Ziel, das Papst Franziskus für seine erste Reise wählte und damit ein Grundsatzprogramm in der Migrationsfrage formulierte.
Franziskus machte die Insel – sehr zur Freude eines interessierten Establishments – zu einem bildgewaltigen Symbol für die uneingeschränkte Masseneinwanderung. Der progressive Konzilshistoriker Alberto Melloni stellte die Lampedusa-Rede des Papstes in eine Linie mit der in diesen Kreisen gefeierten Eröffnungsansprache Johannes’ XXIII. zum Zweiten Vatikanischen Konzil – eine Gleichsetzung, die programmatisch zu verstehen ist.
Mit seiner Lampedusa-Reise bereitete Franziskus den Boden für das Jahr 2015, als eben jenes politische Establishment die Schleusen Europas für eine bis dahin beispiellose Migrationswelle öffnete. Der Papst unterstützte diesen Kurs uneingeschränkt – und rief im September desselben Jahres unmißverständlich: „Nehmt alle auf, Gute und Schlechte.“
Der argentinische Pontifex inszenierte geradezu einen Kult um die Migration: Man denke nur an das Boot, das angeblich Migranten nach Lampedusa gebracht hatte, später bei päpstlichen Zelebrationen als Altar diente und dessen Teile reliquiengleich in Diözesen weltweit gebracht wurden – um auch dort als eine Art liturgisches Symbol verwendet zu werden. Ziel all dessen war offenkundig, jede kritische Debatte über das Thema Migration zu tabuisieren.
Es wirkt befremdlich, wenn Leo XIV. auch in diesem Punkt in die Fußstapfen seines Vorgängers treten will.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)