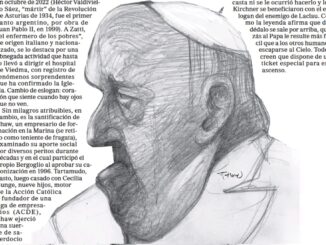(Rom) In aller Diskretion haben im Vatikan die Vorbereitungen für die Papst-Reise in seine Heimat Argentinien begonnen, die für die Zeit „nach dem Sommer“ 2024 vorgesehen ist. Neu ist, daß sie den Papst auch nach Uruguay und Brasilien führen wird, wie Sergio Rubin in der argentinischen Tageszeitung Clarín berichtete. Der Besuch in Argentinien wurde durch das politische Klima im Land verhindert. Wie sieht es dort aber jetzt aus?
Quellen an der Römischen Kurie bestätigten Rubin, daß am vatikanischen Staatssekretariat erste Vorerhebungen für die Reise stattfanden. Papst Franziskus möchte auch gerne den Marienwallfahrtsort Aparecida besuchen. Dort fand 2007 eine Vollversammlung des Lateinamerikanischen Bischofsrats (CELAM) statt, dessen Schlußdokument von dem damaligen Erzbischof von Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio redigiert wurde. Wiederholt verwies Papst Franziskus auf dieses Dokument, dem er eine besondere Bedeutung beimißt. Die Rede ist auch davon, bei dieser Gelegenheit São Paulo zu besuchen.
Jahrelang hatte Franziskus um seine Heimat eine großen Bogen gemacht. Gegenüber Medien projizierte er einen Besuch in eine nicht näher definierte Ferne oder bestritt rundweg, die Absicht zu haben, Argentinien zu besuchen. Noch 2021 sagte Franziskus, er „vermisse Argentinien nicht“. Dann erfolgte jedoch eine abrupte Meinungsänderung. Als nicht mehr damit gerechnet wurde, kündigte Franziskus anläßlich seines zehnten Thronjubiläums im vergangenen März in Interviews überraschend an, 2024 Argentinien doch besuchen zu wollen.
Überraschend wird ein Besuch doch möglich
Bei dieser Gelegenheit erklärte Franziskus, nicht weniger überraschend, den Besuch in seiner Heimat bereits für 2017 geplant zu haben. Er habe die Reise von Johannes Paul II. von 1987 wiederholen wollen, der damals Argentinien, Chile und Uruguay besuchte. Das Projekt sei jedoch daran gescheitert, daß „im Dezember“ in Chile Wahlen stattfanden. „Päpste reisen nicht in Länder, die in Wahlprozesse verwickelt sind.“ So gibt es jedenfalls Sergio Rubin wieder.
Erstaunlicherweise lassen sich keine Notizen finden, die eine so ungewöhnliche Erzählung bestätigen würden. Bisher zeigte sich in der Reisetätigkeit von Franziskus noch keine Anlehnung an Reisen seines polnischen Vorvorgängers. Zudem fanden die Wahlen in Chile in jenem Jahr bereits im Juli bzw. Anfang November statt.
Werfen wir also zunächst einen Blick auf Sergio Rubin, um seine Darstellung einordnen zu können.
Rubin ist seit den 90er Jahren mit Jorge Mario Bergoglio bekannt, als dieser noch Weihbischof von Buenos Aires war. Der Journalist steht Franziskus seither sehr nahe und ist sein erster Biograph. Rubins 2010 veröffentlichtes Buch „El Jesuita“ („Der Jesuit. Gespräche mit Kardinal Jorge Bergoglio“) war im März 2013, zum Zeitpunkt der Wahl Bergoglios zum Papst, mehr oder weniger das einzige, was weltweit vom neuen Papst bekannt war.
Wegen „politischer Spaltung“ von einer Reise „abgeraten“
In den vergangenen Jahren habe dann das vatikanische Staatssekretariat Franziskus von einem Argentinien-Besuch „abgeraten“, so Rubin weiter, um die langjährige ungewöhnliche Weigerung des Papstes, seine Heimat zu besuchen, zu erklären. Benedikt XVI. war erstmals fünf Monate nach seiner Wahl in die Bundesrepublik Deutschland gereist; Johannes Paul II. siebeneinhalb Monate nach seiner Wahl nach Polen. Zuvor regierten fast ein halbes Jahrtausend ohnehin Italiener. Bei Franziskus werden elfeinhalb Jahre vergangen sein, bis er erstmals wieder einen Fuß auf argentinischen Boden setzen wird – sollte es zur Reise kommen.
Rubin hat die Begründung für das Fernbleiben Franziskus’ eigenwillig begonnen und setzt sie ebenso fort. Dem Papst sei von einem Argentinien-Besuch deshalb abgeraten worden, damit er nicht in die politische Spaltung des Landes hineingezogen werde, da ihm Sympathien für den linksperonistischen Kirchnerismus nachgesagt wurden. Der Kirchnerismus meint die Ära der Staatspräsidenten Nestor Kirchner und dessen Frau und Nachfolgerin Cristina Kirchner von 2003 bis 2015. Damit wäre alles, was Franziskus tun oder sagen (oder nicht tun und nicht sagen) würde, „eine Quelle der Kontroverse“ geworden. Um es verständlicher zu machen: 2015 hatte der bürgerliche Kandidat Mauricio Macri die Präsidentschaftswahlen gewonnen und damit die Kirchner-Ära beendet. Papst Franziskus ließ alle Welt unmißverständlich wissen, die Wahl des neuen Staats- und Regierungschefs zu mißbilligen, so, wie er es dann auch gegenüber Donald Trump in den USA tat.
2019 gelang es den Linksperonisten, mit Alberto Fernández an die Macht zurückzukehren. Cristina Kirchner ist seither Vizepräsidentin. Am kommenden 22. Oktober 2023 finden Neuwahlen statt. Dabei werden sowohl der Staatspräsident als auch auch beide Häuser des Parlaments erneuert. Fernández erklärte vor kurzem, nicht mehr anzutreten.
Das Fernbleiben von Franziskus habe, zumindest laut Rubin, der „Einheit“ seiner Landsleute gedient, um Spaltungen zu vermeiden.
„In den vergangenen Monaten hat Jorge Bergoglio begonnen, sich deutlich über sein Land zu äußern, was von einigen Beobachtern als ‚Distanzierung‘ vom Kirchnerismus gewertet wurde, aber in der Kirche glaubt man, daß er damit seine parteipolitische Unabhängigkeit deutlich machen und seine Reise politisch entlasten wollte. Streng genommen hat sich sein Verhältnis zu Alberto Fernández verschlechtert und auch jenes mit Cristina Kirchner ist nicht gut ausgegangen“, so Rubin.
In der Tat ist bekannt, daß Franziskus zu Cristina Kirchner nie einen guten Draht hatte. Allerdings dürfte dieses Stimmungstief weniger inhaltlicher Natur sein, etwa deshalb, weil das Duo Fernández-Kirchner 2022 ein Ministerium für Frauen, Geschlechter und Diversität einrichtete und die bekennende Lesbe und Abtreibungsbefürworterin Ayelén Mazzina zur Ministerin ernannte. Eher spielt schon der Versuch der Regierung eine Rolle, jene Richter abzusetzen, die Cristina Kirchner in erster Instanz wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel zu sechs Jahren Gefängnis und lebenslangem Ausschluß von öffentlichen Ämtern verurteilten.
Eine Fülle von politischen Implikationen
Bedeutet die Fülle an politischen Implikationen, die für Franziskus beim Besuch seiner Heimat eine Rolle spielen, daß auch die für 2024 geplante Reise platzen könnte, falls im kommenden Oktober der Kandidat des Bündnisses Juntos por el cambio (Gemeinsam für den Wechsel) gewinnen sollte, dem auch Macrí angehörte?
Es gibt auch von Rubin nicht erwähnte Stimmen, die sagen, daß Franziskus unter den Bewerbern um das höchste Staatsamt, den linksradikalen Juan Grabois bevorzugen würde, der sich bei den Vorwahlen des linksperonistischen Bündnisses Frente por Todos (Front für alle) beteiligen will. Das argentinische Wahlrecht sieht vor, daß neben dem amtierenden Präsidenten nur jene Kandidaten antreten dürfen, die bei allgemeinen Vorwahlen mindestens 1,5 Prozent der Stimmen erhalten haben.
Der argentinische Sozialaktivist Grabois gehört zum engsten Kreis der Argentinier um Franziskus. 2016 berief ihn der Papst zum Consultor des Päpstlichen Rates Iustitia et Pax, heute ein Teil des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Er ist der päpstliche Verbindungsmann zum Weltsozialforum in Porto Alegre (Brasilien) und war der Organisator der internationalen Treffen der sogenannten Volksbewegungen.
Franziskus kritisierte Anfang des Jahres die weitverbreitete Armut und die hohe Inflation in Argentinien, die er auf „schlechte Verwaltungen“ zurückführte. Rubin erinnert zudem an die „schockierende“ Enthüllung von seiten des Papstes, daß die Regierung von Cristina Kirchner (2007–2015), vor seiner Wahl zum Papst, Richter unter Druck gesetzt habe, damit er wegen der Anschuldigungen des marxistischen Journalisten Horacio Verbitsky verurteilt werde, der ihn beschuldigte, während der Militärdiktatur zwei Jesuiten-Mitbrüder an die Junta ausgeliefert zu haben. Tatsächlich wurde Kardinal Bergoglio in dem Verfahren freigesprochen.
„Bin kein Peronist“ – alles nur ein Mißverständnis?
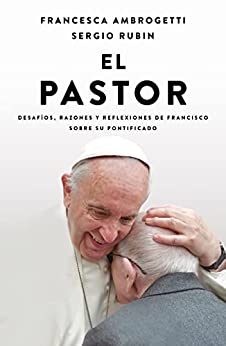
Anfang März erschien das jüngste Buch von Sergio Rubin über Papst Franziskus. Es trägt den Titel „El pastor“ („Der Hirte“), Darin bestreitet Franziskus, ein Peronist zu sein. Das erstaunt. Zu dieser Zuordnung sei er ganz ohne eigenes Zutun gekommen, so der Papst, weil Anfang der 70er Jahre, in seiner Zeit als Jesuitenprovinzial, die Eiserne Garde (Guardia de Hierro), das Führungszentrum der Linksperonisten, an der Jesuitenuniversität El Salvador sehr stark war. Er empfange in Rom alle, gleichgültig welcher politischen Richtung.
Das allerdings stimmt nachweislich nicht. Was rechts der Mitte steht, wurde von Franziskus bisher nur dann empfangen, wenn es sich um einen Staatsgast handelte, um die internationalen diplomatischen Gepflogenheiten einzuhalten.
In drei Tagen, am 25. Mai, wird Franziskus die römische Zentrale der von ihm gegründeten Stiftung Scholas Occurrentes besuchen, die ihren zehnjährigen Geburtstag begeht. Die Stiftung für ein „inklusives“ Bildungsangebot fiel bisher vor allem durch die Förderung der Homo- und Gender-Ideologie auf. Rubin stellte in den Raum, daß Franziskus die Gelegenheit nützen könnte, zu politischen Fragen in Argentinien Stellung zu nehmen.
Dort bemühen sich die weitgehend bergoglianischen Bischöfe eine Strategie zu entwickeln, um zwischen den drei großen Wahlbündnissen einen Konsens zu den wichtigsten Herausforderungen des Landes herzustellen.
Die Bischöfe nennen dabei Prioritäten wie die Bekämpfung der Korruption, die Unabhängigkeit der Justiz, den Einsatz für die Würde des Menschen, insbesondere der Ärmsten und Schwächsten, und den Schutz des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem natürlichen Ende, die Umsetzung einer Politik der nachhaltigen Entwicklung und der wirtschaftlichen Stabilität, die die Schaffung von menschenwürdiger Arbeit fördert und die notwendigen Investitionen erleichtert, sowie eine „Bildung (…) frei von jeder engstirnigen Ideologie zu stärken und zu erweitern“.
Bereits bei den beiden zurückliegenden Wahlen 2019 und 2015 hatten sich die Kirchenvertreter vor den Wahlen mit den Spitzenkandidaten getroffen und von diesen Zusagen erhalten, die dann aber – einmal gewählt – nicht eingehalten wurden, so Rubin.
Argentiniens Bischöfe gehen derzeit davon aus, daß sich die Krise verschärfen und die Hälfte der Argentinier, bei einer Inflation von jährlich über 100 Prozent, verarmen wird.
Schuld an der Spaltung im Land, so Sergio Rubin, sei der Kirchnerismus, in den auch Papst Franziskus hineingeraten sei, was es ihm erschwert habe, das Land zu besuchen.
Allerdings, was Rubin nicht sagt, war es Franziskus selbst, der, als Gefangener seiner eigenen politischen Wünsche und Strategien, den argentinischen Boden unter seinen Füßen verbrannte.
Wird sich das Klima im Land nach den kommenden Wahlen verbessern?
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons