
(Rom) Papst Franziskus startet heute zu einer Asienreise. Es handelt sich um die 32. Auslandsreise des amtierenden Kirchenoberhauptes. Sie führt ihn zunächst nach Thailand und dann nach Japan, zwei Länder „mit tausendjähriger, nichtchristlicher Tradition“, wie Erzbischof Victor Manuel Fernandez, der Ghostwriter des Papstes, schrieb. Die ihn begleitenden Journalisten interessiert anderes mehr:
„Wie immer richten sich die Erwartungen der 70 Journalisten in seinem Gefolge schon jetzt auf die nie fehlende Pressekonferenz, die er während des Rückflugs nach Rom halten wird“, so der Vatikanist Sandro Magister.
Zuletzt gab es eine solche fliegende Pressekonferenz schon auf dem Hinflug nach Afrika. Die improvisierten Antworten des Papstes auf die Journalistenfragen haben, da sehr öffentlichkeitswirksam, die Rolle des „ordentlichen Lehramtes“ von Jorge Mario Bergoglio übernommen. Das gilt für die Pressekonferenzen in luftigen Höhen und für die noch umstritteneren Interviews, die Franziskus gibt.
Nicht wenige Katholiken stoßen sich an diesem inoffiziellen päpstlichen Redefluß. Weniger wäre mehr, heißt es schon seit Herbst 2013. Entschuldigend wird auf das „südländische Naturell“ eines Argentiniers italienischer Abstammung verwiesen. Als wirklicher Trost gilt das allerdings nicht. „Pius XII. war auch Italiener“, wird gelegentlich entgegengehalten, um zu sagen, daß der aktuelle päpstliche Wortschwall sich damit allein wohl nicht erklärt.
Anders sieht es das päpstliche Umfeld. Der inzwischen gestürzte, aber weich gelandete, ehemalige Präfekt des Kommunikationssekretariats, Dario Edoardo Viganò (nicht verwandt mit dem papstkritischen, ehemaligen Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Viganò), rühmte bereits 2015 den „kommunikativen Stil“ des regierenden Papstes als geradezu unvergleichlich. Innerhalb der katholischen Kirche konnten ihm nicht alle zustimmen, denn die Quantität der päpstlichen Worte gehe nicht selten zu Lasten der Qualität. Vor allem an Klarheit fehle es zu wichtigen Fragen. Zweideutige Formulierungen erzeugen Verwirrung und Unsicherheit. Die Beispiele werden immer zahlreicher und die Konsequenzen daraus immer drückender, weshalb sie bei immer mehr Katholiken an eine Schmerzgrenze stoßen.
Die Bergoglio-Garde meinte auch schon, „in diesen Zeiten ist eine gewisse Verwirrung unvermeidlich“.
Bedenken gegen eine solche Haltung wurden nicht berücksichtigt. Der Hofstaat huldigt weiter. In der aktuellen Ausgabe der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica findet sich ein Aufsatz des argentinischen Jesuiten Diego Fares, der die Kommunikationstechnik von Papst Franziskus analysiert und mit „höchster Punktezahl“ benotet, so Sandro Magister.
Vorauszuschicken ist: Jede Ausgabe der Civiltà Cattolica braucht eine Druckerlaubnis des Heiligen Stuhls. Zu wichtigen Themen übernimmt Papst Franziskus, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die Aufgabe des Zensors selbst.
Grundlage der Analyse von Pater Fares ist das 2017 erschienene Gesprächsbuch „Lateinamerika“ des Papstes mit dem argentinischen Journalisten Hernan Reyes (siehe dazu auch Populist ist der neue Kampfbegriff der Ultraliberalen).
Die Sprache von Franziskus, so Fares, sei geradezu ein „Ereignis an neuer Kommunikation“. In diesem „vierhändig“ geschriebenen Buch, in dem sich der interviewte Papst „zum Co-Autor verwandelt“, habe sich „endgültig ein Kommunikationsstil konsolidiert, den Franziskus langsam, langsam entwickelt hat“. Pater Fares nennt als Beginn dieser Entwicklung das „erste Interview, das er P. Antonio Spadaro“ im September 2013 gab. Der Jesuit nennt zudem die fliegenden Pressekonferenzen als Hauptexerzierfeld, um diesen „Kommunikationsstil“ auszufeilen.
„Franziskus hat verstanden, daß Interviews eine Art sind, um an die Ränder der Sprache ‚hinauszugehen‘.“
Fares geht aber noch weiter:
„Hinausgehen in dem Sinn, daß er bei offiziellen Reden eine ‚vollständige‘ Rede überreicht, während in einem Interview sein Diskurs ‚unvollständig‘ ist und von dem vervollständigt wird, was der Andere sagt.“
Die Zweideutigkeit der Sprache, die von anderen bemängelt wird, ist laut Fares gewollt. Die Sprache von Franziskus sei gewollt „unvollständig“. Gewollt sei demnach auch die Vervollständigung etwa durch Eugenio Scalfari. An dieser Stelle wird die Analyse hochbrisant.
An dieser Stelle kommen zwangsläufig die umstrittenen Gespräche des Papstes mit Eugenio Scalfari, dem italienischen Journalisten, Intellektuellen und Atheisten aus freimaurerischem Haus, in den Sinn. Dessen Kolumnen über diese Gespräche sind nicht nur mit direkter Rede von Franziskus gespickt, sondern auch mit häretischen Vorschlägen, Ideen und Positionen – die Scalfari dem Papst zuschreibt. Das Spektrum umfaßt die „Abschaffung“ der Sünde, der Hölle, der Gottheit Jesu…
Der Vatikan „dementierte“, heißt es. Die Zweifel an der Kommunikationsart des Papstes wurden damit nicht ausgeräumt. Die Zweifel betreffen nämlich auch, ob der Vatikan wirklich dementierte, denn auch diesbezüglich blieb die Kommunikation „unvollständig“. Gewollt unvollständig? Das erste der umstrittenen Gespräche von Franziskus mit Scalfari wurde vom Vatikanverlag sogar in Buchform veröffentlicht. Eine Distanzierung sieht anders aus.
Laut Pater Diego Fares SJ und der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, ist alles gewollt „unvollständig“. Und da die Druckerlaubnis für den Aufsatz vom Heiligen Stuhl erteilt wurde, vielleicht von Franziskus persönlich, scheint man es dort nicht anders zu sehen.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: La Civiltà Cattolica (Screenshots)
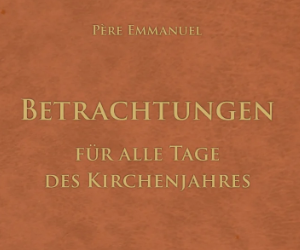
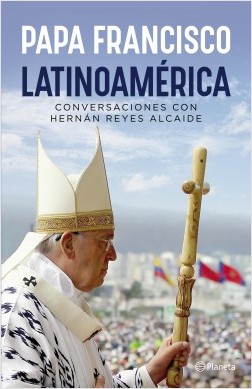

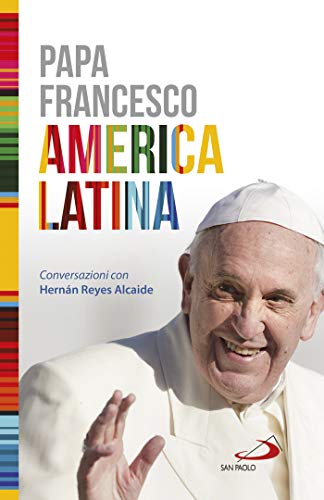




Der Jesuit Diego Fares versucht schlauerweise schönzureden, indem er aus der Not eine Tugend zu machen versucht. Die Sprache von Franziskus ist nicht „gewollt unvollständig“. Er kann offensichtlich nicht anders, weil seine intellektuellen Fähigkeiten schlichtweg nicht mehr hergeben. Einen Hinweis darauf mögen die mitunter recht naiv daherkommenden, sich oftmals selbst widersprechenden päpstlichen Santa-Marta-Improvisationshomilien geben.
Bergoglio weiß um seine eigene Schwäche, hatte dies zu Beginn seines Pontifikats zugegeben und anfänglich Interviews deswegen ausdrücklich abgelehnt. („Ich kann das nicht.“) Aber schon bald darauf hatte er irgendwie Spaß daran gefunden und überlässt es mittlerweile denen, die so denken wie er selbst, schwammige, mehrdeutige Interview-Sager so zu vervollständigen bzw. zu interpretieren, wie es ihm in die Agenda passt. Deshalb gibt es manchmal zwar etwas Spott in der Öffentlichkeit, aber keine ausdrücklichen Dementis seitens des Vatikans.
Man braucht nur das Buch „Der Diktatorpapst“
von Marcantonio Colonna lesen.
Dieser Papst der sich so bescheiden und volksnahe
gibt, ist seiner eigenen Macht voll bewusst.
Aber die Mächte der Unterwelt werden sie nicht
überwältigen.
Mt.16.18
Die Situation in der Kirche ist nicht mehr zu ertragen