
Das Jahr 2017 liegt zurück. Der Großteil davon fällt in das fünfte Jahr des Pontifikats von Papst Franziskus. Ein Rückblick auf das Jahr von Papst Franziskus soll für jeden Monat nur ein Stichwort in Erinnerung rufen, das Schwerpunkt des päpstlichen Handelns war. Dabei werden vor allem politische Fragen in den Fokus genommen, da Franziskus mit ihnen die größte Außenwirkung erzielt. Ein unvollständiger Jahresrückblick, der gänzlich unpolemisch gedacht war.
Januar 2017
Der Nazismus ist aus dem Populismus entstanden
Zeitgleich zur Amtseinführung von Donald Trump im Weißen Haus gab Papst Franziskus der linken, spanischen Tageszeitung El Pais ein Interview. Der Journalist fragte den Papst (und zitierte dabei den neuen US-Präsidenten und andere Beispiele), ob ihn das Phänomen „Populismus“ besorge. Das Kirchenoberhaupt gab zur Antwort:
„Das typischste Beispiel für die europäischen Populismen ist der deutsche von 1933. Nach Hindenburg und der Krise der 30er Jahre liegt Deutschland in Scherben, versucht sich wiederaufzurichten, sucht seine Identität, sucht einen Anführer, jemand, der ihm seine Identität zurückgibt. Und da gibt es einen jungen Burschen namens Adolf Hitler, der sagt: ‚Ich kann, ich kann‘. Und ganz Deutschland wählt Hitler. Hitler hat die Macht nicht geraubt. Er wurde von seinem Volk gewählt, und dann hat er sein Volk zerstört. Das ist die Gefahr.“
Die Botschaft dieser Aussage liegt nicht im historischen Befund oder in Ungenauigkeiten der päpstlichen Geschichtsstunde. Die Botschaft liegt im Vergleich: Der Papst verglich die neuen Kräfte, die sich in zahlreichen westlichen Staaten gegen das herrschende Establishment erheben, mit dem Nationalsozialismus und bediente sich damit einer ideologischen Konstante der politischen Linken.
Februar 2017
Den islamischen Terrorismus gibt es nicht

Im großen Wunsch, den religiösen Dialog zu fördern und attraktiv anzubieten, fühlte sich Papst Franziskus mehrfach gedrängt, einen religiösen Zusammenhang im islamischen Terrorismus zu leugnen. Um genau zu sein, gibt es eben diesen für ihn gar nicht. Es gibt laut Franziskus einen Terrorismus, aber keinen islamischen Terrorismus. Am vierten der von ihm initiierten Treffen der „Volksbewegungen“ nahm er erstmals nicht persönlich teil. Das hatte seinen Grund. In den USA regierte inzwischen Donald Trump, was zum Zeitpunkt der Organisation niemand voraussehen konnte und wollte. Mit seiner Teilnahme hätte Franziskus dem neuen US-Präsident genau am Beginn seiner Amtszeit die Aufwartung machen müssen. Der „Papst der Gesten“ wollte aber keine solche Geste, auch keine Fotos, die ihn neben dem neuen Präsidenten der Weltmacht Nummer Eins zeigen. Trump ist seit seinem Wahlsieg der meistgehaßte Mann der politischen Linken. Zum besseren Verständnis: Das Wall Street Journal schrieb kurz nach den US-Präsidentschaftswahlen:
„Papst Franziskus ist der neue Anführer der globalen Linken“.
Franziskus schickte daher seinen „Volksbewegungen“ lieber eine Botschaft. Darin sagte er:
„Kein Volk ist kriminell und keine Religion ist terroristisch. Es gibt keinen christlichen Terrorismus, es gibt keinen jüdischen Terrorismus und es gibt keinen islamischen Terrorismus. Es gibt sie nicht.“
Und weiter:
„Es gibt fundamentalistische und gewalttätige Personen in allen Völkern und in allen Religionen, die auch durch intolerante Verallgemeinerungen gestärkt werden und sich vom Haß und der Ausländerfeindlichkeit nähren.“
Der Papst redete einem kulturellen Eintopf das Wort, in dem sich jede konkrete Verantwortung im Prinzip eines „Allgemeinübels“ (statt des Allgemeinwohls) auflöst. Bereits vor und auch nach dieser Botschaft bemühte Franziskus irritierende, an den Haaren herbeigezogene Vergleiche, um den islamischen Terrorismus zu verharmlosen und Christen und vor allem Katholiken zu Gewalttätern und Quasi-Terroristen zu machen.
März 2017
Die Einwanderung ist allein unsere Schuld
 In einem Interview in der März-Ausgabe der Monatszeitschrift Scarp de’tenis gab Papst Franziskus zum Thema Migration eine ganze Reihe von klassischen Drittwelt-Klischees zum Besten:
In einem Interview in der März-Ausgabe der Monatszeitschrift Scarp de’tenis gab Papst Franziskus zum Thema Migration eine ganze Reihe von klassischen Drittwelt-Klischees zum Besten:
„Jene, die nach Europa flüchten, fliehen vor Krieg und Hunger. Und wir sind schuld, weil wir ihre Länder ausbeuten, aber keine Art von Investitionen tätigen, aus denen auch sie einen Nutzen ziehen könnten.“
Zudem betonte er die Notwendigkeit
„alle aufzunehmen, die man aufnehmen ‚kann‘, was die Anzahl betrifft. Es ist aber ebenso wichtig, darüber nachzudenken, ‚wie‘ man aufnehmen soll“,
denn
„aufnehmen heißt integrieren, denn wenn die Einwanderer nicht integriert werden, werden sie gettoisiert“.
Kein Wort äußerte der Papst über die kulturellen Unterschiede und Unvereinbarkeiten, die eine Integration objektiv behindern. Über diese Seite der Medaille ging er in diesem Interview wie insgesamt hinweg, als gäbe es sie nicht. Kurz darauf, im April, verglich er Flüchtlingslager mit Konzentrationslagern. Eine vernichtende Anklage gegen die europäischen Regierungen und Völker, zumal ihr jeder Bezug zur Realität fehlt. Dennoch verteidigte Franziskus diesen Vergleich, von Jörg Bremer von der FAZ auf dem Rückflug aus Ägypten darauf angesprochen, auch noch. Es sei „kein lapsus linguae“ gewesen, so der Papst. Den Beleg blieb er schuldig („Da gibt es vielleicht eins in Italien, eins anderswo … in Deutschland jedoch sicher nicht!“).
April 2017
Jesus hat sich zum Teufel gemacht
 In seiner morgendlichen Predigt in Santa Marta vom 4. April sprach Franziskus über das Kreuz. Wörtlich sagte das Kirchenoberhaupt Schockierendes. Das Kreuz sei ein
In seiner morgendlichen Predigt in Santa Marta vom 4. April sprach Franziskus über das Kreuz. Wörtlich sagte das Kirchenoberhaupt Schockierendes. Das Kreuz sei ein
„Gedenken an ihn, der sich zur Sünde gemacht hat, der sich zum Teufel gemacht hat, zur Schlange, für uns“.
Die Wortwahl ist „durch und durch zweideutig und nicht interpretierbar“, so der Publizist Antonio Socci, der dazu schrieb:
„Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um die Menschen zu erlösen. Er ist nicht Teufel geworden, um die Teufel zu erlösen, die ganz vom unauslöschlichen Haß gegen Gott erfüllt sind.“
Socci fügte noch hinzu:
„Es ist unvorstellbar, daß ein Papst dergleichen über Jesus sagen kann“.
Mai 2017
Kein Lächeln für Trump

Im Mai fand auf Sizilien der G7-Gipfel statt, an dem auch der neue US-Präsident teilnahm. Dessen Besuch in Italien machte einen Empfang im Vatikan unvermeidlich. Papst Franziskus weiß um die Wirkung von Gesten, die weit mehr bewegen können als Worte. Er weiß auch, daß jeder öffentliche Moment von Fernsehkameras und Fotografen festgehalten wird. So wählte er seine Form des Gestus in der Geste des unausweichlichen Staatsempfangs: Er setzte ein ernstes, finsteres Gesicht auf und vermied das geringste Lächeln.
Wenn es sich schon nicht vermeiden ließ, daß es gemeinsame Fotos vom Oberhaupt der politischen Weltmacht Nummer Eins und der religiösen Weltmacht Nummer Eins geben würde, dann sollte es aber keine geben, die irgendeine Sympathie für den neuen Bewohner des Weißen Hauses andeuten oder dahingehend ausgelegt werden könnten. Man beachte auch die ungewöhnlich schlechte Qualität des von Vatikan veröffentlichten Fotos.

Dabei kann der Papst lachen, und wie, vor allem wenn er auf linke Staatsführer trifft. Ein Vergleich mit den Bildern genügt, die Begegnungen mit Barack Obama festgehalten haben. Sie sprechen Bände.
Franziskus ließ schon frühzeitig vor den Wahlen keinen Zweifel daran, daß er keinen Republikaner und schon gar nicht Donald Trump im Weißen Haus sehen möchte. Franziskus griff im Vorwahlkampf, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den USA, in die Kür des republikanischen Präsidentschaftskandidaten ein, indem er Donald Trump direkt und mit ungewöhnlicher Aggressivität attackierte. Zum Image von Franziskus gehört es, nachsichtig zu sein. So hatte er keine Probleme mit Barack Obama, von dem man nicht einmal weiß, ob er Christ ist, zumal während seiner Amtszeit niemand sagen konnte, welcher christlichen Gemeinschaft er angehört. Dem Episkopalianer Trump sprach Franziskus hingegen, ein halbes Jahr vor den Wahlen, öffentlich sogar sein Christsein ab.
Juni 2017
Don Milani und die Ideologie der 68er
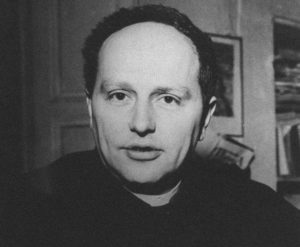 50 Jahre nach dem Tod von Don Lorenzo Milani besuchte Papst Franziskus dessen Schule von Barbiana. Offiziell wurde der Besuch vom Vatikan als „Wallfahrt nach Barbiana“ bezeichnet. Dort praktizierte der Priester seine Unterrichts- und Erziehungsmethode. Bergoglio bezeichnete Don Milani als „beispielhaften“ Diener des Evangeliums und rühmte dessen Erziehungsmodell. Dabei zitierte er Auszüge aus dessen „Brief an eine Lehrerin“.
50 Jahre nach dem Tod von Don Lorenzo Milani besuchte Papst Franziskus dessen Schule von Barbiana. Offiziell wurde der Besuch vom Vatikan als „Wallfahrt nach Barbiana“ bezeichnet. Dort praktizierte der Priester seine Unterrichts- und Erziehungsmethode. Bergoglio bezeichnete Don Milani als „beispielhaften“ Diener des Evangeliums und rühmte dessen Erziehungsmodell. Dabei zitierte er Auszüge aus dessen „Brief an eine Lehrerin“.
Nun ist aber leidlich bekannt, daß Don Milani ein erklärter Gegner von jedem schulischen Leistungsprinzip war. Auch Papst Franziskus äußerte sich im vergangenen Jahr mehrfach in diesem Sinn. Don Milani lehnte „Sitzenbleiben“ in der Schule strikt ab. Sein Modell entspricht dem der außerparlamentarischen Linken von 1968. Es ist kein Zufall, daß sein antiautoritärer „Brief“ in linken Kreisen zum Bestseller wurde. Auf die zumindest pädophil-homoerotischen Phantasien Milanis (wenn nicht mehr) soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
Bergoglios Ausflug nach Barbiana bestätigte eine ideologische Ausrichtung, die sich wie ein roter Faden durch sein Pontifikat zieht.
Juli 2017
Homo-Paare Welcome

Wenn es auch keine direkte Öffnung der Kirche gegenüber der „Homo-Ehe“ war, so doch eine indirekte. Diese indirekten Formen liebt Franziskus, denn sie sparen ihm Grundsatzdiskussionen und jede Rücksprache und Rücksichtnahme. Vor allem haben sie den Vorteil, bei Bedarf dementiert, bestritten und geleugnet zu werden. Und vor allem: Es war nicht die erste „Öffnung“. Bereits im September 2015 hatte Franziskus, als er noch bedenkenlos in die USA reisen konnte, weil noch ein linker Präsident im Weißen Haus regierte, ein „verheiratetes“ Homo-Paar empfangen. Die Sache war zwar offiziell als Besuch eines „ehemaligen Schülers mit Familie“ deklariert worden, doch wurde mit Bedacht Wert darauf gelegt, die Bilder der Begegnung über die Medien zu verbreiten: der Papst und das Homo-Paar. Die Öffentlichkeit verstand das Signal eindeutig.
 Im Juli 2017 sendete der Papst einem Homo-Paar seinen Segen. Toni Reis und David Harrad, zwei in Brasilien bekannte Homo-Aktivisten, sind „verheiratet“ und haben drei Kinder adoptiert. Als LGBT-Aktivisten schrieben sie dem Papst einen Brief und berichteten von der Taufe „ihrer“ Kinder. Und der Papst antwortete ihnen.
Im Juli 2017 sendete der Papst einem Homo-Paar seinen Segen. Toni Reis und David Harrad, zwei in Brasilien bekannte Homo-Aktivisten, sind „verheiratet“ und haben drei Kinder adoptiert. Als LGBT-Aktivisten schrieben sie dem Papst einen Brief und berichteten von der Taufe „ihrer“ Kinder. Und der Papst antwortete ihnen.
„Papst Franziskus weiß ihr Schreiben zu schätzen“, ließ das Staatssekretariat wissen.
„Er übermittelt ihnen auch seine Glückwünsche und erbittet für sie und ihre Familie die Fülle der Göttlichen Gnaden, auf daß sie konstant und glücklich das Christsein leben als gute Kinder Gottes und der Kirche“.
Ein Witz? Keineswegs. Im Vatikan sprach man, nachdem Kritik laut wurde, von einem Fauxpas irgendeines nachgeordneten Beamten und davon, daß es sich um ein Standardschreiben gehandelt habe, von denen täglich Tausende verschickt würden. Das Homo-Paar stellte jedenfalls klar, daß sie ihrem Brief ein Foto ihrer „Familie“ beigelegt hatten, also im Vatikan jeder zwei Männer mit drei Kindern sehen konnte.
Vielen denken seither, daß es sich keineswegs um ein bloßes Versehen gehandelt habe.
August 2017
Die „gesegnete“ Einmischung zum Staatsbürgerschaftsgesetz

Das Phänomen der Masseneinwanderung betrifft alle westlichen Staaten. Da die Grenzen durch die umstrittene Politik vieler Regierungen keinen wirklichen Schutz mehr bieten und im Mittelmeer, einzigartig in der Geschichte, die Militärmarine nicht dazu eingesetzt wird, die Grenzen zu sichern, sondern die illegale Einwanderung zu unterstützen, bildet das Staatsbürgerschaftsrecht den letzten, verbliebenen Schutzschild für die europäischen Völker westlich des einstigen Eisernen Vorhangs.
Die Globalisierungsideologen, vor allem Parteien der politischen Linken, fordern daher eine schnelle und zahlreiche Einbürgerung der Einwanderer. In Italien wollte die Linksregierung im Sommer die Staatsbürgerschaft nicht mehr an das Abstammungsprinzip (Ius sanguinis), sondern an das Territorialprinzip (Ius soli) koppeln. Wer auf dem Staatsgebiet geboren wird, als Kind von In- oder Ausländern, sollte automatisch die italienische Staatsbürgerschaft erhalten. Einwanderung, ob legal oder illegal, würde damit sofort zu einem irreversiblen Rechtsstatus verhelfen.
Dagegen regte sich in der italienischen Bevölkerung heftiger Widerstand. Um so massiver forderte jedoch Papst Franziskus die Einführung der Ius soli. Als im Hochsommer der Bootsansturm über die Mittelmeerroute besonders massiv war, und die Politik Frankreichs und Großbritanniens den italienischen Versuch, die Route durch einen Deal mit libyschen Küstenclans zu schließen, zunichte gemacht hatte, mußte die italienische Linksregierung ihren Gesetzentwurf unter den Protesten der Bevölkerung zurückziehen. Als sich genau das abzeichnete, veröffentlichte Papst Franziskus – viele Monate im voraus – seine Botschaft zum Weltmigrantentag 2018 und forderte:
„Die Staatsbürgerschaft ist im Moment der Geburt anzuerkennen und amtlich zu bescheinigen“.

Die Gegner einer Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes sprachen von einer „Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten des Landes. Europa habe bereits mit dem ungebetenen Phänomen eines Massenansturms zu ringen und nun wolle der Papst, daß dieses Phänomen auch noch zu tiefgreifenden, dauerhaften und rechtlich unumkehrbaren Veränderungen in den europäischen Staaten führe. Vor allem, daran ließ Franziskus mit seiner Botschaft, die an die ganze Welt gerichtet war, keinen Zweifel, wünsche er eine sofortige Anerkennung der Migration durch Gewährung der Staatsbürgerschaft von allen Staaten. Migration als neues, universales und uneingeschränktes Recht mit sofortiger Wirkung.
Der Papst positionierte sich mit dieser Forderung auf der äußersten Linken, jener radikalen Linke, von der auch die Parole Refugee Welcome stammt. Damit verbunden ist eine weitere Achsenverschiebung von großer Bedeutung. Bisher wies die politische Linke jede Stellungnahme eines Papstes zu politischen Fragen kategorisch als ungebetene „Einmischung“ zurück, ganz egal ob er Benedikt XVI., Johannes Paul II. oder Paul VI. hieß. Die Zeiten haben sich geändert und zwar radikal. In Sachen Einwanderung wurde diese Einmischung von der politischen Linken begrüßt und hochoffiziell abgesegnet.
September 2017
Die Psychoanalyse als zweiter Heilsweg
 Der Papst ist ein Mensch wie jeder andere. Er ist aber darüber hinaus auch Nachfolger des Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden. Er ist damit erster und oberster Lehrmeister und geistlicher Führer der Menschheit. Seine vorrangige Aufgabe besteht darin, die Glaubenswahrheit unverkürzt zu bewahren, sie zu verkünden und die Brüder im Glauben zu bestärken. Er hat den Kultus zu pflegen und die Menschen zum ewigen Seelenheil zu führen. In einer Krise dürfen sich die Gläubigen von ihm Orientierung erwarten. Berichtet er über eine persönliche Krise, würde man sich eine Erzählung über ein Gespräch mit seinem geistlichen Seelenführer erwarten, aber nicht eine Schilderung von Gesprächen mit einem Psychologen auf dessen Couch. Doch Bergoglio ist voller Überraschungen.
Der Papst ist ein Mensch wie jeder andere. Er ist aber darüber hinaus auch Nachfolger des Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden. Er ist damit erster und oberster Lehrmeister und geistlicher Führer der Menschheit. Seine vorrangige Aufgabe besteht darin, die Glaubenswahrheit unverkürzt zu bewahren, sie zu verkünden und die Brüder im Glauben zu bestärken. Er hat den Kultus zu pflegen und die Menschen zum ewigen Seelenheil zu führen. In einer Krise dürfen sich die Gläubigen von ihm Orientierung erwarten. Berichtet er über eine persönliche Krise, würde man sich eine Erzählung über ein Gespräch mit seinem geistlichen Seelenführer erwarten, aber nicht eine Schilderung von Gesprächen mit einem Psychologen auf dessen Couch. Doch Bergoglio ist voller Überraschungen.
„Ich habe eine jüdische Psychologin aufgesucht. Sechs Monate lang bin ich zu ihr nach Hause gegangen, einmal in der Woche, um einige Dinge zu klären.“
Damals war Franziskus noch nicht Franziskus, sondern ein Jesuit in Argentinien, der gerade aus dem Amt des Provinzials seines Ordens verdrängt worden war.
Seine Schilderung irritierte nicht wenig Gläubige und wurde in der Kirche mit betretenem Schweigen übergangen. Die Kirche hält seit über hundert Jahren kritische Distanz zu den atheistischen Thesen des geborenen Juden Sigmund Freud, den „Vater“ und Begründer der Psychoanalyse. Thesen, die mit gutem Grund in wesentlichen Teilen als unvereinbar mit dem Glauben gesehen werden. Der Weg zu einer vereinbaren Form der Psychoanalyse war schwierig, langwierig und komplex. Franziskus ging aber gar nicht zu einem christlichen Psychologen, sondern zu einer Jüdin.
In seiner Schilderung der Episode vermittelte er in gewohnter Unbeschwertheit den Eindruck, als würde der Heilsweg nicht nur über Christus und den Beichtstuhl führen.
Oktober 2018
Die Universität für alle
 Die Universität zu besuchen und zu studieren ist, folgt man den Aussagen von Papst Franziskus, heute weder nutzbringend noch von ethischer Bedeutung. Man studiert heute, immer laut Franziskus, nur um eine bessere Stellung zu erlangen, mehr Geld zu verdienen oder größeres soziales Ansehen zu erreichen. Wörtlich sprach Franziskus von einem
Die Universität zu besuchen und zu studieren ist, folgt man den Aussagen von Papst Franziskus, heute weder nutzbringend noch von ethischer Bedeutung. Man studiert heute, immer laut Franziskus, nur um eine bessere Stellung zu erlangen, mehr Geld zu verdienen oder größeres soziales Ansehen zu erreichen. Wörtlich sprach Franziskus von einem
„Synonym für eine höhere Position, als Synonym für mehr Geld oder größeres gesellschaftliches Ansehen“.
So erklärte er es den Studenten und dem Lehrkörper der Katholischen Universität von Portugal. Es sei gut, zu studieren, aber nicht für die vorhin genannten Ziele, sondern
„um ein größeres Verantwortungsbewußtsein für die Probleme von heute und die Bedürfnisse der Armen und der Umwelt“ zu erlangen.
Auch an dieser Stelle scheint der südamerikanische (oder marxistische) Pauperismus als Zugabe immer dabei.
Im Gleichnis der Talente lehrt Jesus Christus, daß jeder seine ihm gegebenen Fähigkeiten maximal nützen soll. Das scheint aber Papst Franziskus nicht anzusprechen. Es widerspricht den (linken) Gleichheitsvorstellungen. Wer mehr kann, diskriminiert den, der weniger kann, denn was könne der dafür, weniger zu können. Papst Bergoglio schwimmt mit diesem Denken, das in seinen Botschaften konstant durchschimmert, auf der Welle des perfekten Sozialstaates, „all inclusive for all“, der in Wirklichkeit einen Staatsdirigismus meint, um alle „gleich“ (arm) zu machen.
November 2017
Der Nazarener ist Rohingya und Muslim

Eine Sache ist es, sich mit einer von einem grausamen Regime verfolgten Minderheit zu solidarisieren. Eine andere Sache ist es, aus theologischer Sicht, diese Solidarisierung mit Synkretismus zu vermengen. Um so mehr, wenn diese Solidarisierung durch den Papst erfolgt. So sagte Franziskus bei seiner jüngsten Auslandsreise:
„Heute heißt die Gegenwart Gottes auch Rohingya.“
Mit diesen Worten nannte Franziskus die ethnisch-religiöse Minderheit, die von der buddhistischen Mehrheit Birmas verfolgt wird, erstmals beim Namen – allerdings erst im benachbarten, ethnisch verwandten und fast zur Gänze muslimischen Bangladesch. Der Papst ging damit aber viel weiter. Er definierte Gott selbst als Rohingya und identifizierte ihn damit mit einer muslimischen Minderheit.
Letzteres sprengt jeden Rahmen. Auch bei seiner berechtigten Solidarisierung vergaß er ganz, die nicht minder verfolgten, zahlenmäßig noch größeren, christlichen Minderheiten Myanmars (Birma) zu erwähnen – wenigstens zu erwähnen. Stattdessen bat er die Rohingya um Vergebung, als hätten er, die katholische Kirche oder die Christen ihnen etwas angetan.
Doch im Augenblick, aus welchen verborgenen politischen Interessen – für die Franziskus ansonsten besonders hellhörig ist – finden die muslimischen Rohingya internationale Aufmerksamkeit, die christlichen Minderheiten Myanmars hingegen nicht. Um genau zu sein, schert sich die internationale Staatengemeinschaft herzlich wenig um die weltweit verfolgten Christen. Franziskus steuert dem nicht entgegen, weder in Birma noch im Nahen Osten, sondern unterstützt das vorherrschende Denken in dieser Sache wie auch in anderen (Klimawandel, Migration, Globalisierung, „neue Menschenrechte“).
Ein Zusammenhang, warum dem so ist, wie es scheint, liegt auf der Hand: Die Personifizierung des Schöpfergottes mit den Rohingya, die zum Teil ins benachbarte, weil verwandte Bangladesch geflüchtet sind, nützt dem weit größeren politischen Migrationsdiskurs in Europa (muslimischer Migrant).
Überhaupt läßt sich aus Bergoglios Reden herauslesen, daß es dem Papst leichtfällt, Gott mit jedem Subjekt zu identifizieren, das seinem gerade aktuellen Diskurs nützlich ist. Man könnte den Verdacht eines gewissen Mißbrauchs Gottes für politische Angelegenheiten hegen. Vor allem wird dadurch im Umkehrschluß jeder Widerspruch abzuwürgen versucht, denn das käme ja fast einer Gotteslästerung gleich. Ähnlich argumentiert das päpstliche Umfeld, wenn Kritik am Papst und seiner Politik laut wird. Der Papst kokettiert zwar selbst damit, nicht Papst sein zu wollen („Bischof von Rom“), doch sobald Kritik gewagt wird, empören sich seine Vertrauten und bezichtigen Kritiker der Majestätsbeleidigung.
Im November wären auch die „Heiligen Worte“ von Franziskus zur Euthanasie zu erwähnen. Da aber nur ein Stichwort je Monat dargestellt wird, soll dazu auf andere Artikel verwiesen werden (siehe auch: Worte des Papstes brechen letzten Widerstand: Italien führt die Euthanasie ein und die Kirche schweigt mal wieder).
Dezember 2017
Christus gibt allen die Staatsbürgerschaft
 Die Masseneinwanderung ist das politische Hauptthema, dem Franziskus 2017 in Europa alle anderen Fragen, selbst den Klimawandel, untergeordnet hat. Er ist der sichtbarste „Patron“ der Migration. Und niemand sollte meinen, der Papst wisse nicht, daß durch die von ihm geforderte uneingeschränkte Einwanderung Europas Antlitz grundlegend und irreversibel verändert wird. Seine Migrationspolitik zu Ende gedacht, bedeutet, daß es Europa – das es als kulturelle, religiöse, ethnische und politische Einheit erst seit der Christianisierung gibt – nicht mehr geben wird.
Die Masseneinwanderung ist das politische Hauptthema, dem Franziskus 2017 in Europa alle anderen Fragen, selbst den Klimawandel, untergeordnet hat. Er ist der sichtbarste „Patron“ der Migration. Und niemand sollte meinen, der Papst wisse nicht, daß durch die von ihm geforderte uneingeschränkte Einwanderung Europas Antlitz grundlegend und irreversibel verändert wird. Seine Migrationspolitik zu Ende gedacht, bedeutet, daß es Europa – das es als kulturelle, religiöse, ethnische und politische Einheit erst seit der Christianisierung gibt – nicht mehr geben wird.
Selbst die Heilige Nacht hat er diesem politischen Thema untergeordnet. Er bezeichnete in seiner live in alle Welt übertragenen Predigt den Erlöser, als wäre er irgendein politischer Reformer, denn Er sei
„jener, der kommt, um uns allen die Staatsbürgerschaftsbescheinigung zu geben“.
In der offiziellen, deutschen Übersetzung des Vatikans wurde die Stelle zu folgender Aussage verharmlost: „um uns allen ein Bürgerrecht zu verleihen“. Der Papst hat es anders gesagt. Eine Predigt, die wenige Tage nach dem Aus für den zweiten Anlauf im Italienischen Parlament kam, im Staatsbürgerschaftsgesetz das Ius soli durchzusetzen. Der Papst forderte implizit zum dritten Anlauf auf.
Wörtlich interpretierte der Papst die Geburt Jesu in Bethlehem wie folgt:
„Hinter den Schritten von Maria und Josef verbergen sich viele Schritte. Wir sehen die Spuren ganzer Familien, die auch heute gezwungen sind, von zu Hause wegzugehen. Wir sehen die Spuren von Millionen Menschen, die nicht freiwillig gehen, sondern gezwungen sind, sich von ihren Lieben zu trennen, weil sie aus ihrem Land vertrieben werden. In vielen Fällen ist es ein Aufbruch voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft; in vielen anderen Fällen hat dieser Aufbruch nur einen Namen: Überleben. Die aktuellen Nachfolger des Herodes zu überleben, die zur Durchsetzung ihrer Macht und zur Mehrung ihrer Reichtümer nicht davor zurückschrecken, unschuldiges Blut zu vergießen.“
Diese These des Papstes hat nicht wenigen Vatikanisten, Publizisten und Intellektuellen, ob Katholiken oder nicht, das Weihnachtsessen verdorben.

Der ehemalige, italienische Senatspräsident und Wissenschaftstheoretiker Marcello Pera, ehemals Sozialist und Laizist, der sich durch die Freundschaft mit Joseph Ratzinger zum Christentum bekehrte, warf Franziskus im vergangenen Juli vor:
„ein Papst zu sein, der nur Politik macht. […] Das ist ein Papst, der seit dem Tag seiner Amtseinführung nur Politik betreibt. […] Ganz ehrlich, diesen Papst verstehe ich nicht. Was er sagt, liegt außerhalb eines rationalen Verständnisses.“
Franziskus lasse es in seiner Einwanderungspolitik selbst „an einem Minimum an Realismus fehlen, jenem Minimum, das von jedem gefordert ist.“
Was der Papst zur Einwanderung sagt, habe „absolut nichts“ mit dem von Christus gelehrten Evangelium zu tun, „genausowenig, wie es mit einer rationalen Motivation zu tun hat“.
„Ich kann mir darauf nur eine Antwort geben: Der Papst tut es, weil er den Westen verachtet, darauf abzielt ihn zu zerstören und alles tut, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn man der kritischen Schwelle nicht Rechnung trägt, jenseits der unsere Gesellschaften nicht mehr jeden aufnehmen können und ihnen nicht einmal mehr jene Mindestwürde garantieren können, die man jedem Menschen schuldet, werden wir bald Zeugen einer regelrechten Invasion werden, die uns überfluten und unsere Sitten, unsere Freiheit, ja sogar das Christentum in eine Krise stürzen wird. Es wird eine Reaktion folgen und ein Krieg. Wie kann das der Papst nicht verstehen? Und auf welcher Seite wird er stehen, wenn dieser Bürgerkrieg erst einmal ausgebrochen sein wird?“
Neuerdings wird die Haltung von Papst Franziskus zur Migrationsfrage als „Theologie der Invasion“ bezeichnet.
Das war ein Rückblick auf das Jahr 2017 mit Papst Franziskus. Das Jahr 2018 hat begonnen.
Text: Giuseppe Nardi (Pietro de Leo/Antonio Rapisarda, Il Tempo)
Bild: Wikicommons/Serviam/refugeesmigrants.un.org/Vatican.va/Radio Vaticana/MiL (Screenshots)





