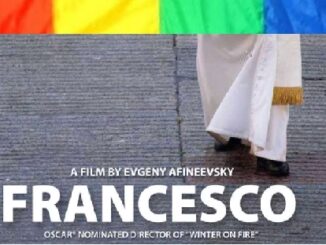Von Roberto de Mattei*
Am 17. August kehrte Leo XIV. endgültig in den Vatikan zurück, nach der Sommerpause in Castel Gandolfo. An diesem Tag waren zugleich die ersten 100 Tage seines Pontifikats vergangen, das am 8. Mai 2025 begann.
Reichen diese 100 Tage, in denen der Papst keine entscheidenden Ernennungen vorgenommen, keine Auslandsreisen unternommen oder bedeutende Reden gehalten hat, aus, um die künftige Ausrichtung seines Pontifikats vorauszusehen? Absolut nicht. Die Zeiten der Kirche folgen nicht denen der Politik, und drei Monate sind eine viel zu kurze Zeitspanne, um fundierte Aussagen über die Zukunft treffen zu können.
Das Pontifikat von Papst Franziskus war objektiv zerstörerisch – nicht so sehr wegen der Siege des Progressismus, der keines seiner radikalsten Ziele erreicht hat, sondern wegen der Verwirrung, die er in der gesamten katholischen Welt gestiftet hat, einschließlich der Spaltungen innerhalb der Traditionalisten, von denen sich ein Teil zunehmend vom Petrusprimat abwandte. Der Prozeß der Selbstzerstörung der Kirche ist also vorangeschritten, und es ist berechtigt, sich zu fragen, ob Leo XIV. ihn aufhalten wird – auch wenn es noch zu früh ist, eine endgültige Antwort zu geben.
Die ersten Eindrücke sind wichtig, und Leo XIV. vermittelte bei seiner Wahl den Eindruck eines Hirten, der sich bewußt ist, daß seine Mission allein in Christus verankert ist. Das Motto des neuen Papstes, In Illo uno unum („In Christus sind wir eins“), das auf die Worte des heiligen Augustinus zum Psalm 127 zurückgeht, zeigt, daß er überzeugt ist, nicht nach weltlichem Erfolg oder Innovationen beurteilt zu werden, sondern nach der Treue zum Evangelium. Ebenso deutlich zeigte sich schon bei seinem Besuch des Heiligtums von Genazzano zwei Tage nach der Wahl seine Marienfrömmigkeit.
Der Bezug zu Christus und damit zur übernatürlichen Natur der Kirche ist eine Konstante der ersten drei Monate seines Pontifikats. Außerhalb dieses Grundsteins gibt es keine Möglichkeit, das Programm von Leo XIV. umzusetzen, das er mehrfach betont hat: Einheit und Frieden in Kirche und Welt wiederherzustellen – gerade dort, wo das Pontifikat von Papst Franziskus gescheitert ist.
Konservative und traditionalistische Kritiker von Leo XIV. betonen, daß der neue Papst in seinen ersten 100 Tagen mehr als siebzig Mal Papst Franziskus zitiert und ihn als Bezugspunkt dargestellt hat. Sie weisen zudem darauf hin, daß er schädliche Dokumente wie Amoris Laetitia und Traditionis custodes weder ganz noch teilweise zurückgenommen hat, daß seine Aussagen darauf hindeuten, daß er den synodalen Weg fortsetzen will, daß er in einigen Reden eine für den Progressismus typische mehrdeutige Sprache verwendet hat und daß er alle Verantwortlichen der Kurienämter, beginnend mit Kardinal Parolin, auf ihren Posten bestätigt hat. Ihr abschließendes Urteil fällt hart aus: Leo XIV. erscheine als ein „Bergoglio mit menschlichem Antlitz“.
Gleichzeitig gilt aber auch: In keinem Bereich hat der Papst die Linie seines Vorgängers überschritten. Im Gegenteil, es gibt Zeichen einer Kurskorrektur: Am 31. Mai 2025 sagte er, daß „die Ehe kein Ideal, sondern das Gesetz der wahren Liebe zwischen Mann und Frau“ ist und korrigierte damit Amoris Laetitia. In seiner Ansprache an die Staatsoberhäupter am 21. Juni verteidigte Leo XIV. – auf der Linie von Benedikt XVI. – nachdrücklich das Naturrecht, „nicht von Menschenhand geschrieben, sondern universell und zu allen Zeiten als gültig anerkannt“. Am 9. Juli korrigierte er in einer Predigt in Castel Gandolfo die von Franziskus geschätzte „grüne“ Ideologie, indem er sagte, man müsse sich um die Schöpfung kümmern, aber ohne ihr Sklave zu werden und den Menschen zu relativieren; in der Audienz am 13. August erklärte er, daß Judas Iskariot sich durch seinen Verrat selbst vom Heil ausschloß – im Gegensatz zu Papst Franziskus, der gesagt hatte, er wisse nicht, ob Judas in die Hölle gegangen sei. In einem Brief an die Bischofskonferenz des Amazonas am 17. August verurteilte er die Anbetung der Natur und stellte Christus und die Eucharistie ins Zentrum der Evangelisierung.
Zudem bleiben die Bestätigungen von Mitarbeitern von Franziskus „donec aliter provideatur“, also bis zu einer anderen Entscheidung. Zugleich ernannte der Papst Kardinal Robert Sarah zu seinem Sondergesandten für die Feierlichkeiten am 25. und 26. Juli im Heiligtum Sainte-Anne‑d’Auray zum vierhundertjährigen Jubiläum der Erscheinungen, und Kardinal Dominik Duka, der Dubia zu Amoris Laetitia unterzeichnet hatte, zu seinem Sondergesandten für die Feiern zum hundertjährigen Bestehen des Erzbistums Danzig (Polen) am 14. Oktober 2025. Am 22. August empfing Leo XIV. Kardinal Raymond Leo Burke in Privataudienz, den Franziskus als einen seiner schlimmsten Gegner betrachtete. Bereits in einem Schreiben vom 17. Juni hatte der Papst Burke anläßlich seines Jubiläums für seinen „eifrigen Dienst“ für den Apostolischen Stuhl gedankt, „immer die Gebote des Evangeliums nach dem Herzen Christi predigend“.
In einem Interview mit der Zeitung La Stampa am 18. August erklärte Kardinal Burke:
„Das Pontifikat von Leo XIV. zeichnet sich durch Christozentrik aus, er spricht immer über den Herrn und seine Kirche. Es ist wichtig, daß die Kirche nicht auf eine NGO reduziert wird. Leo nimmt sich Zeit, um die richtigen Personen für zentrale Aufgaben zu ernennen. Das Papstamt ist unmöglich ohne die richtigen Mitarbeiter. Schon die Wahl des Namens Leo, der an Leo den Großen und Leo XIII. erinnert, zeigt seinen Willen, ein authentischer ‚Vater der Väter‘ zu sein – ein wahrer Hirte der universalen Kirche. Wir müssen für ihn beten und jeder in seiner Rolle helfen.“
Es handelt sich also um Hinweise, nicht um Beweise für eine wirkliche Veränderung. Gleichzeitig gibt es auch keine Beweise für das Gegenteil. Die kritischen Prognosen zum Pontifikat von Leo XIV. basieren auf diesen fragilen Hinweisen. Das Feld bleibt offen, mit drängenden Fragen, die über die Ernennungen hinausgehen, wie die Synodalität und die Beziehungen des Vatikans zu China.
Es ist einfach, dem Papst vorzuschreiben, was er tun sollte, oder gar zu verlangen, daß er es schnell umsetzt, ohne an seiner Stelle zu sein und die Verantwortung zu tragen. Aber wir müssen uns daran erinnern, daß Papst Pius X. vier Jahre wartete, bevor er den Modernismus verurteilte, obwohl er mit einem ihm nahestehenden Staatssekretär, Kardinal Rafael Merry del Val, zusammenarbeitete. Welches anti-modernistische Beraterteam könnte heute Leo XIV. bei seinen Entscheidungen unterstützen, der sicherlich kein Pius X. ist, wie seine kulturelle Ausbildung und pastorale Erfahrung zeigen?
Unter den großen Päpsten der letzten zwei Jahrhunderte zählen wir auch Pius IX., der erst drei Jahre nach seiner Wahl zum Antiliberalen wurde, nach einem harten Erwachen durch die revolutionäre Verfolgung und die Flucht aus Rom. Pius XII., ein milder und verhandlungsfreundlicher Papst, wurde vom Zweiten Weltkrieg überwältigt und mußte einige Jahre warten, bevor er seine großen Enzykliken Mystici Corporis (1943), Mediator Dei (1947), Humani Generis (1950) und Ad Coeli Reginam (1954) promulgierte.
Die Tugend der Klugheit – sowohl natürliche als auch übernatürliche – kann längere Zeitspannen erfordern, um ein Vorhaben zu verwirklichen, und äußere Ereignisse, wie die derzeit drohenden Kriege, können alles durcheinanderbringen. Ungeduld ist daher fehl am Platz; wir müssen wachsam sein, alle Hoffnung allein auf Gott setzen und für den Papst sowie für die Kirche in dieser düsteren Stunde der Geschichte beten.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana