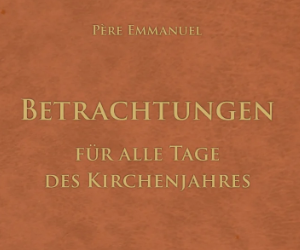(Rom) Obwohl das Jahr 2020 in Sachen priesterlicher Zölibat mit einem doppelten Paukenschlag begann, gehe es „Schritt für Schritt in Richtung verheiratete Priester“, so der Vatikanist Sandro Magister. Die beiden Fronten sind weiterhin der Amazonas und Deutschland.
Nach der Amazonassynode schien es in der Luft zu liegen, daß Papst Franziskus ein verheiratetes Priestertum zulassen werde. Die Paukenschläge, die folgten, waren zunächst das am 15. Januar veröffentlichte Buch „Aus der Tiefe des Herzens“ von Kardinal Robert Sarah und Benedikt XVI., dann die ausgebliebene „Revolution“, als Papst Franziskus am 15. Februar sein nachsynodales Schreiben Querida Amazonia vorlegte.
Die Frage des priesterlichen Zölibats und der Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum klammerte Franziskus darin gänzlich aus. Zunächst überwog bei vielen Beobachtern die Erleichterung, dann kamen Zweifel auf. Seither wurde viel über die Interpretation von Querida Amazonia geschrieben. Das gilt für die Verteidiger des Zölibats und ebenso für die Zölibatsgegner. Beide Seiten wirkten verunsichert. Der Grund dafür ist im Regierungsstil von Papst Franziskus zu suchen, dem es gefällt, sich nicht wirklich in die Karten schauen zu lassen. Das erlaube ihm, so einer seiner schärfsten Kritiker, der britische Historiker Henry Sire alias Marcantonio Colonna, Autor des Buches „Der Diktatorpapst“, bei Bedarf verschiedene Seiten gegeneinander auszuspielen und Abhängigkeiten zu schaffen.
Tatsache ist, daß konservative und traditionsverbundene Kirchenkreise der Ruhe von Querida Amazonia nicht trauen. Ebensowenig sind jene Kreise verstummt, die den priesterlichen Zölibat lieber heute als morgen abschaffen wollen, weil Franziskus in dem Schreiben die Einführung eines verheirateten Klerus nicht thematisierte.
Sieben Monate nach der Amazonassynode und drei Monate nach der Veröffentlichung von Querida Amazonia werden sie vielmehr „immer ungeduldiger und lauter“, so Magister. Dafür spricht das jüngste von Mauro Castagnero in der progressiven Dehonianer-Zeitschrift Il Regno (Das Reich) veröffentlichte Interview. Castagnero, ein italienischer Journalist, ist Vorsitzender der italienischen Sektion der schismatisierenden Gruppierung Wir sind Kirche. Castagnero publiziert auch im Jesuitenmagazin Jesus und in der linkskatholischen Schrift Popoli (Völker) Zugleich ist er Schriftleiter der Missionszeitschrift Missione oggi (Mission heute) der Xavenier Brüder, eines 1839 in Brügge gegründeten Missionsordens, der noch heute dem dortigen Bischof untersteht. Das Interview führte Castagnero, der sich in seinem Studium der Politikwissenschaften auf Lateinamerika spezialisierte, mit dem Theologen Antonio José De Almeida. Er gehört zu jenen Beratern, die bei der stark befreiungstheologisch durchdrungenen Brasilianischen Bischofskonferenz Gehör finden. Und er ist einer der führenden Vertreter der Anti-Zölibats-Bewegung. So spielte er auch im Vorfeld der Amazonassynode eine wichtige Rolle.

In dem Interview nennt er die Schritte, die zu setzen sind, um das angestrebte Ziel zu erreichen, was keine besondere Enthüllung ist. Bemerkenswerter ist, daß er dabei ganz selbstverständlich davon ausgeht, daß Papst Franziskus damit einverstanden ist.
Antonio José De Almeida ist Priester des südbrasilianischen Bistums Apucarana und Professor an der Päpstlichen Katholischen Universität von Paranà. Er griff die vom bayerischen Missionsbischof Fritz Lobinger entwickelten Thesen von „Basisgemeinden“ mit eigener Leitung auf. Was Lobinger, der von 1987 bis 2004 Bischof in Südafrika war, im Missionskontext entwickelte, will wesentliche Elemente der kirchlichen Organisation und ihrer hierarchischen Strukturierung überwinden. An der Spitze der Lobinger-Gemeinden stehen „Ältestenteams“ aus Männern, Frauen, Verheirateten und Zölibatären, die allesamt zu Priestern geweiht werden und das Recht haben, die Messe zu zelebrieren, was sie abwechselnd tun sollen.
Für Unruhe sorgt, daß Papst Franziskus zum Leserkreis Lobingers gehört und dessen Ideen schätzt, wie der emeritierte österreichische Missionsbischof Erwin Kräutler in seinem Ende Juli 2019 erschienenen Buch „Erneuerung jetzt“ schreibt. Kräutler, einer der Regisseure der Amazonassynode, veröffentlichte einige Details. Franziskus selbst hatte bekanntgegeben, Lobinger gelesen zu haben. Der Papst selbst brachte die Thesen des emeritierten bayerischen Missionsbischofs ins Gespräch, als er am 27. Januar 2019 auf dem Rückflug aus Panama auf Journalistenfragen antwortete. Caroline Pigozzi hatte ihn gefragt, ob es denkbar sei, daß er „jetzt, in der katholischen Kirche des lateinischen Ritus“ die Erlaubnis geben werde, daß verheiratete Männer Priester werden können. Die Antwort war eine der für das derzeitige Kirchenoberhaupt berüchtigten 180-Grad-Antworten, die zu einem umstrittenen Thema von einem anfänglichen Nein über ein Jein zu einem Ja werden:
„Im lateinischen Ritus … Mir kommt der Satz des heiligen Paul VI. in den Sinn: ‚Ich gebe lieber mein Leben, als das Zölibatsgesetz zu ändern.‘ Das kam mir in den Sinn, und ich möchte es sagen, denn das ist ein mutiger Satz, in einer schwierigeren Zeit als dieser, die Jahre um 1968/70 herum … Ich persönlich meine, dass der Zölibat ein Geschenk für die Kirche ist. Zweitens bin ich nicht damit einverstanden, den optionalen Zölibat zu erlauben, nein. Nur für die entlegensten Orte bliebe manche Möglichkeit – ich denke an die Pazifikinseln … Aber es ist eine Sache, dass man darüber nachdenkt, wenn es dort pastorale Notwendigkeit gibt; der Hirte muss an die Gläubigen denken. Es gibt ein Buch von Pater Lobinger [Bischof Fritz Lobinger, Preti per domani (Priester für Morgen), Emi, 2009], das ist interessant – das ist etwas, das unter Theologen diskutiert wird, es gibt keine Entscheidung von meiner Seite. Meine Entscheidung ist: kein optionaler Zölibat vor dem Diakonat, nein. Das ist meine persönliche Einstellung, ich werde es nicht tun, das bleibt klar. Bin ich hier ein ‚verschlossener‘ Typ? Vielleicht. Aber ich verspüre nicht den Mut, mich mit dieser Entscheidung vor Gott zu stellen. Zurück zu Bischof Lobinger; er sagte: ‚Die Kirche macht die Eucharistie, und die Eucharistie macht die Kirche.‘ Aber wo es keine Eucharistie gibt, in den Gemeinden – denken Sie an die Pazifikinseln …“
Auf dieselbe Art und Weise hatte Franziskus im November 2015 auf die Frage geantwortet, ob und wann Protestanten mit ihrem katholischen Ehegatten gemeinsam in der Messe die Kommunion empfangen können. Franziskus versicherte, daß er eine solche Interkommunion „nie“ erlauben werde. In Wirklichkeit sagte er in derselben Antwort, daß es eine Gewissensfrage des Einzelnen sei, und akzeptierte 2018 schweigend den Vorstoß deutscher Bischöfe, genau diese Interkommunion umzusetzen. Mehr noch, er verhinderte ein Eingreifen der Glaubenskongregation gegen die Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz unter Führung von Kardinal Marx.
Doch was sagt nun De Almeida?
Der Theologe schickt zunächst voraus, daß das Schweigen von Franziskus zur Zölibatsfrage „nicht bedeutet, daß er die Tür geschlossen habe“. Im Gegenteil: Gleich in den ersten Sätzen von Querida Amazonia fordert er dazu auf, das Schlußdokument der Amazonassynode „ganz zu lesen“, mit dem die Synodalen der Weihe von verheirateten Männern zugestimmt haben. Franziskus betont, das Schlußdokument weder „ersetzen“ noch „wiederholen“, sondern offiziell vorstellen“ zu wollen. Daran hätten viele Menschen mitgearbeitet, „die die Problematik Amazoniens besser kennen als ich und die Römische Kurie, da sie dort leben, mit ihm leiden und es leidenschaftlich lieben.“ De Almeida gibt zu verstehen, daß eine Distanzierung sich anders anhöre.
Schritt 1
Der erste Schritt werde darin bestehen, „die Gründe aufzuzeigen, warum eine Diözese beabsichtigt“, verheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Diesen ersten Schritt könne eine Diözese laut De Almeida auch alleine gehen.
Schritt 2
Es sei aber besser, und das wäre der zweite Schritt, eine solche Entscheidung „mit den benachbarten Diözesen zu treffen, eventuell auf der Ebene der Kirchenprovinz oder der regionalen Bischofskonferenz“.
Schritt 3
Ist das „Projekt“ ausgearbeitet, wird die Forderung dem Heiligen Stuhl vorgelegt.
Auf die Frage, ob der Heilige Stuhl die Forderung akzeptieren werde, antwortet De Almeida ohne zu zögern:
„Mit Sicherheit kann der Heilige Stuhl das tun. Im Amazonas-Kontext und wenn man den synodalen Prozeß bedenkt, der nach der Ankündigung der Amazonassynode begonnen wurde, habe ich keinen Zweifel.“
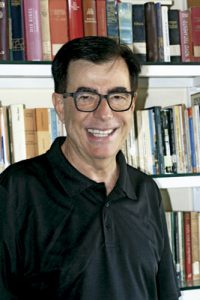
Die Umsetzung werde über das Kirchenrecht erfolgen, der in den Canones 1042 und 1047 erlaube, daß in besonderen Fällen der Heilige Stuhl die Priesteramtskandidaten von der Ehe als Weihehindernis dispensieren könne. Das gelte, wenn die Dispensierung „zum höheren Wohl der Gläubigen“ geschehe, wohlbegründet sei, wofür De Almeida den Zugang der Gläubigen zur Eucharistiefeier nennt, und den besonderen Gegebenheiten Rechnung trage, was im Amazonasgebiet „der absolute Mangel an einem zölibatären Klerus“ sei. Alle diese Punkte hält der Theologe im Zusammenhang mit der Zölibatsaufweichung offenbar a priori für gegeben. Anders ausgedrückt: Alle drei Kriterien sind laut De Almeida gewichtiger als der priesterliche Zölibat.
De Almeida zitiert zudem den Absatz 93 von Querida Amazonia, wo Papst Franziskus sagt:
„Es geht also nicht nur darum, eine größere Präsenz der geweihten Amtsträger zu ermöglichen, die die Eucharistie feiern können“, sondern auch darum, „neues Leben in den Gemeinden zu wecken“.
De Almeida sieht darin ein neues Priestermodell angedacht, das Modell eines „Gemeindepriesters“, Lobinger spricht von „Leutepriester“, weshalb es auch eine „Gruppe von solchen Priestern“ sein könne, die mit ihren Familien ständig in der Gemeinde leben und zusätzlich einem Broterwerb nachgehen oder auch nicht.
Schritt 4
Sobald das „Projekt“ Rom vorliegt, kann der Heilige Stuhl der Diözese „dauerhaft oder für eine bestimmte Zeit die Zuständigkeit übertragen, von der Ehe als Weihehindernis zu dispensieren, damit ein verheirateter Mann Zugang zur Priesterweihe erhält“.
„Das ist noch nicht alles“, so Magister. De Almeida sieht auch die Möglichkeit, daß in der Zwischenzeit in der Amazonasregion ein „amazonischer Ritus“ etabliert wird nach dem Beispiel einer Ecclesia sui generis, einer Kirche eigener Art, wie die mit Rom unierten Ostkirchen gesehen werden, die den verheirateten Diözesanpriester kennen.
In diesem Fall wäre „alles anders“, weil das verheiratete Priestertum dann Teil diese neuen, eigenständigen Ritus wäre. De Almeida kann in diesem Zusammenhang auf die Fußnote 120 verweisen, die seit der Veröffentlichung von Querida Amazonia besonders beäugt wird und Vergleiche mit der berüchtigten Fußnote 336 im umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia provozierte.
Die Fußnote 120 besagt:
„Bei der Synode wurde ein eigener „amazonischer Ritus” vorgeschlagen.“
Gerade diese lapidare Form gibt seit dem 15. Februar Rätsel auf. Tatsächlich ähneln sie darin den Fußnoten 336 und 351 von Amoris laetitia, die weitreichende Folgen nach sich zogen. Einzelne Bischöfe, Kirchenprovinzen und Bischofskonferenzen legten diese Fußnoten so weit aus, daß sie die Zulassung sogenannter wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten hineinpacken konnten. Die Reaktion von Papst Franziskus darauf legt nahe, daß er genau diese Entwicklung wollte.
Magisters Resümee ist ernüchternd:
„Die Perspektive einer rituellen Autonomie scheint noch fern zu sein. Inzwischen sind jedoch bereits viele bereit, die anderen von De Almeida genannten Schritte zu unternehmen. Nicht nur in Amazonien, denn es gibt noch eine andere Synode, in Deutschland, die bereits auf denselben Weg gebracht wurde. Mit besonderer Präferenz für eine noch größere Autonomie von Rom am Rande des Schismas.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: vatican.va/Il Regno (Screenshots)