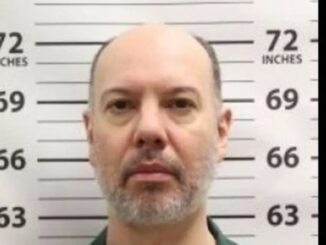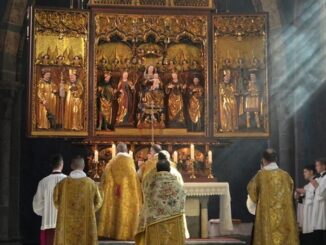(Rom) Papst Franziskus führte den neuen Begriff „Synodalität“ ein. Die von ihm einberufenen Bischofssynoden werden von ihm als Instrument gesehen, der Kirche Kursänderungen zu verordnen. Die Familiensynode 2014/2015 hatte sein umstrittenes Dokument Amoris laetitia zur Folge. Es löste große Unruhe in die Kirche aus, deren weitere Entwicklung nicht absehbar ist. Die Jugendsynode 2018 ging vor wenigen Wochen zu Ende und die Kirche wartet, in Teilen besorgt, auf die Veröffentlichung des nachsynodalen Schreibens. Für Oktober 2019 wurde von Franziskus bereits die Amazonassynode einberufen. Mit ihr hängt ein weiterer Neologismus zusammen, das neue Verb „amazonisieren“.
Dabei handelt es sich um die erste Bischofssynode dieses Pontifikats, die nur einen geographischen Teilbereich der Kirche betrifft, nämlich das südamerikanische Amazonasbecken. Das Ziel der Synode ist, wie ausreichend laut von verschiedenen Kräften in der Kirche zu verstehen gegeben wurde, die Aufhebung des priesterlichen Zölibats. Auch verheiratete, nicht zölibatär lebende Männer sollen zur Priesterweihe zugelassen werden. Begründet wird diese Forderung mit dem „Notstand“, der durch den Priestermangel in der seelsorglichen Betreuung der Indios herrsche.
An der realen Existenz dieses „Notstandes“ bestehen jedoch ernsthafte Zweifel. Kritiker bezeichnen ihn als Vorwand, den innerkirchliche Alt-68er erfunden haben, um doch noch ihre 68er-Agenda der Zölibatsbeseitigung durchzusetzen. Die treibenden Kräfte seien vor allem europäische Kreise in der Kirche. Es sei grundsätzlich bedenklich, ja verantwortungslos, Hand an das Weihesakrament der Kirche zu legen und einen Präzedenzfall zu schaffen, weil in irgendeinem begrenzten Raum ein Engpaß existiert. Die Missionierung von 250–300.000 Urwald-Indios stehe, praktisch gesehen, in keinem Verhältnis zur Gesamtzahl von 1,3 Milliarden Katholiken. Erst recht gelte das aus der theologischen Perspektive.
Bestätigt wird Vorwand-These durch die gleichzeitige Ablehnung von alternativen Lösungen. So war im Spätsommer 2017 angeregt worden, jeden Missionsorden der Kirche um die Entsendung von zwei Priestern in den Amazonas zu bitten. Damit wäre das Problem mehr als behoben. Der Vorschlag wurde von Kardinal Claudio Hummes, dem ranghöchsten Wortführer der Amazonas-Agenda aber energisch abgelehnt:
„Nein, nein, das will der Papst nicht!“
„Das will der Papst nicht!“ Man muß vor diesem Hintergrund kein Hellseher sein, um zu verstehen, daß auf eine geographische Teilsynode, im Handumdrehen weitere geographische Teilsynoden folgen würden, um den Zölibat aufzuheben. Die nächsten Synoden würden nicht mehr einem entlegenen und exotischen Winkel der Erde betreffen, sondern wohl den deutschen Sprachraum. Von dort kommen die meisten Stichwörter zur Agenda. Der Amazonas dient bloß als taktischer Umweg, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Der Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, gab bereits zu verstehen: Sollte die Amazonassynode für das Urwaldbecken den Zölibat als Voraussetzung für das Priestertum aufheben, werde in Deutschland eine Synode sofort nachziehen.

Für die Vorbereitung und Organisation der Amazonassynode wurde 2014 das Pan-Amazonische Kirchennetzwerk REPAM gegründet. Die beiden Anführer, Kardinal Claudio Hummes (REPAM-Gesamtverband) und der emeritierte Missionsbischof Erwin Kräutler (REPAM-Brasilien) sind überzeugte Anhänger der Zölibatsaufhebung. Seit Jahren fordern sie die Zulassung von verheirateten Priestern und auch des Frauenpriestertums.
Zu den Aufgaben von REPAM gehört es, den irrigen Eindruck zu verbreiten, die Indio-Gemeinschaften bräuchten dringend verheiratete Priester, weil sie sonst „ohne Sakramente“ blieben, und die Indio-Gemeinschaften wollten verheiratete Priester haben. Die Notwendigkeit ständiger Sakramentenversorgung wird durch die gesamte Missionsgeschichte der Kirche widerlegt. Zweiteres durch die Indios selbst. Der Priestermangel im Amazonas-Urwald besteht vor allem deshalb, weil die Indios selbst noch keinen wirklichen Zugang zum Priestertum (und auch den anderen Sakramenten) gefunden haben. Die Lösung könne, so Kritiker, daher nicht ein Entgegenkommen sein, indem die Sakramente abgeschwächt oder nicht gemacht werden, sondern durch die Vertiefung der Evangelsierung, wie es die Kirche bisher in allen Jahrhunderten und allen Missionsgebieten getan hat.
Die geeigneten REPAM-Kandidaten für das neue Amazonas-Priestertum
Die Verfechter eines Priestertums „mit Amazonas-Wurzeln“, also eines Amazonas-Priestertums, wollen „Älteste“ in jeder Indio-Gemeinschaft zu Priestern weihen. Die stünden bereits bereit, erklärte jüngst ein Befreiungstheologe.

Auf ihrer Internetseite stellt REPAM neuerdings „anerkannte Anführer“ von Indio-Stämmen vor, so im vergangenen Oktober Santiago Manuin Valera von den Awajun. Beobachter vermuten, daß damit bereits potentielle „Kandidaten“ für die Priesterweihe präsentiert werden.
Manuin Valera „qualifiziert“ sich für REPAM offenbar für Priestertum mit der Aussage, daß er „sein ganzes Leben für die Verteidigung und Förderung der Rechte der indigenen Völker eingesetzt hat“. Bei REPAM lesen wir über ihn:
„2009 wurde er durch mehrere Schüsse beim sogenannten Baguazo-Zwischenfall verletzt. Er erholte sich und konnte sich von der gegen ihn Anzeige wegen der Schießerei befreien. […] Seine Beziehung zur Kirche ist schon sehr alt, besonders über die Jesuiten. Bevor er auf einige Fragen antwortet, erzählt er, daß der große Ajutap (der Gott seiner Ahnen) in der Indiosprache Awajun zu ihm gesprochen hat, ohne Vermittler, ohne Missionare. Dieser Kontakt entspricht dem, der in der Bibel von Moses erzählt wird, als er den Auftrag erhielt, sein Volk zu befreien. Genau so, sagt Manuin, hat Ajutap auf Awajun ihm gesagt, sein Volk von der Unterdrückung zu befreien.“
Für Manuin haben die Missionare nur die Rolle eines dekorativen Beiwerks zu spielen, denn die „Protagonisten sind die Amazonas-Völker“.
Die Missionare, so der Indio-Führer, würden „sich nicht für die Geschichte und der Religiosität der indigenen Völker engagieren“.
„Die Missionare leben nicht mit dem indigenen Volk, sie vermitteln nicht dessen Geschichte, sprechen nicht über dessen Mythologie. Ich habe gesehen, daß die Amazonas-Indios sehr unterwürfig sind, weil (die Missionare) ihnen nicht das wahre Gesicht von Christus gezeigt haben. Der Awajun hingegen ist von Haus aus ein Kämpfer, er ist ein Krieger. Die Ausbildung, die ihm gegeben wurde, das Geheimnis des Evangeliums, das ihm eingeschärft wurde, hat unsere Bewegung des Kampfes gestärkt.“
Und weiter:
„Das Gesicht des Amazonas besteht darin, daß der Indio die Verantwortung übernimmt, nicht der Missionar.“

Im November stellte REPAM einen anderen Indio-Anführer, José Manuyama, vor. Er wird als „Umweltaktivist“ präsentiert. Manuyama sei ein engagierter Verteidiger des Wassers, der schon viele Jahre als „Umweltschützer“ tätig sei. Er kämpfe „für die Verteidigung der Flüsse und der Wälder und generell für die Menschenrechte und die Natürlichkeit“.
Es scheint, als sei es ihr politisches, soziales und ökologisches Engagement, das sie zu „geeigneten“ Kandidaten für das (Amazonas-)Priestertum macht. Auf eine klassische philosophisch-theologische Ausbildung soll ohnehin verzichtet werden, wie einer der Wortführer der Amazonas-Agenda frühzeitig erklärte. Es handle sich ja um „viri probati“, um „Dorfälteste“ und offensichtlich auch um engagierte Aktivisten.
Das ganze REPAM-Interview mit Manuyama dreht sich ausschließlich um Umweltfragen. Auch sein Kirchenverständnis ist distanziert und kritisch.
Manuyama: „Die Kirche nimmt teil [am Kampf für den Umweltschutz], stellt z.B. die Werkstatt für Menschenrechte zur Verfügung, die sie hat, sie unterstützt bei Rechtsfragen, zum Beispiel beim Hidrovias-Projekt. Es gibt Priester, die sich mehr engagieren als andere, aber es fehlt noch viel, weshalb die Leute, die Gläubigen nicht mitmachen. Die Kirche versammelt bei den großen religiösen Ereignissen viele Leute, und wenn sie diese Leute informieren und helfen würde, damit wir eine bessere Kontrolle der Wirtschaftsaktivitäten erhalten, würden wir bessere Bedingungen haben. Hier vermisse ich bei der Kirche eine starken Förderung und Verbreitung der Enzyklika Laudato si.“
Die beiden Beispiele lassen erkennen, welche Art von „Kandidaten“ REPAM für das Amazonas-Priestertum ins Auge faßt.
Das dargestellte Verständnis von der Kirche, dem Evangelium und besonders dem Priestertum wirft zahlreiche Fragen auf. Beide, Manuin Valera und Manuyama, scheinen die Kirche vor allem funktional als ein Hilfsmittel für ihre politischen Kämpfe zu sehen. Auch in Rom dürfte oder sollte allen Verantwortlichen aber klar sein, daß das Priestertum nicht dazu dient, den Urwald-Indios politische Vorkämpfer zu liefern oder die vorhandenen Vorkämpfer durch die Priesterweihe in ihrem politischen Kampf zu „sakralisieren“.
Es geht aber um weit mehr als den Amazonas.
Papst Franziskus sprach von einer „Kirche mit Amazonas-Wurzeln“. Daraus muß geschlossen werden, daß die ganze Weltkirche „amazonisiert“ werden soll. Manche Beobachter befürchten, daß Papst Franziskus in der Sache selbst schweigen werde, wie zur Zulassung wiederverheirateter Geschiedener (und anderer Menschen in irregulären Situationen) zu den Sakramenten, aber beispielsweise den Zölibat in die Zuständigkeit der Bischofskonferenzen übertragen könnte, was zu einer weiteren und tiefgreifenden Spaltung der Kirche führen würde.
Die Tatsache, daß er Kardinal Hummes und Bischof Kräutler zu den Organisatoren der Amazonassynode machte, spricht eine deutliche Sprache.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: