
Von Roberto de Mattei*
Die Politik der Zusammenarbeit von Papst Franziskus mit dem kommunistischen China hat seine direkten Vorläufer in der Ostpolitik von Johannes XXIII. und Paul VI. Gestern wie heute hatte die Ostpolitik starke Gegner, die es verdienen, daß man sich an sie erinnert. Einer von ihnen war der Slowake Pavol Maria Hnilica (1921–2006), an den ich erinnern möchte. Dabei stütze ich mich, neben meinen persönlichen Erinnerungen, auf eine gründliche Studie von Frau Professor Emilia Hrabovec über diese Persönlichkeit, die demnächst erscheinen wird. Ihr bringe ich meinen besonderen Dank zum Ausdruck, daß ich ihre Arbeit vorab einsehen und zitieren durfte.

Als die vatikanische Diplomatie in den 60er Jahren begann, die Ostpolitik umzusetzen, gab es in der Tschechoslowakei, wie heute in der Volksrepublik China, zwei Kirchen: die eine war die „patriotische“ Kirche, die von Priestern repräsentiert wurde, die sich dem kommunistischen Regime unterworfen hatten; die andere war die „Untergrundkirche“, die Rom und seinem Lehramt treu geblieben war. Msgr. Paul Hnilica, der aus Unatin in Gemer in der südlichen Mittelslowakei stammte, wurde nach seinem Eintritt in den Jesuitenorden von Msgr. Robert Pobozny, dem Bischof von Roznava (Rosenau), geheim zum Priester (1950) und zum Bischof geweiht (1951). Auf diese Weise konnte er seinerseits wiederum den damals 27jährigen, künftigen Kardinal Jan Chryzostom Korec (1924–2015) zum Bischof weihen, der nach neun Jahren, in denen er sein Bischofsamt im Untergrund ausgeübt hatte, 1960 verhaftet und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Als Bischof Knilica im Dezember 1951 gezwungen war, seine Heimat zu verlassen, ging er nach Rom. Pius XII. approbierte voll und ganz das Vorgehen der Kirche in der Slowakei, indem er die Gültigkeit der geheimen Weihen bestätigte und jedes Einverständnis mit dem kommunistischen Regime ablehnte. In der Radiobotschaft vom 23. Dezember 1956 sagte der Papst:
„Zu welchem Zweck sollte man sich, im übrigen, ohne eine gemeinsame Sprache verständigen, oder wie sollte es möglich sein, sich zu treffen, wenn die Wege verschieden sind, wenn also von einer Seite verbissen die allgemeinen, absoluten Werte geleugnet werden, und damit jede ‚Koexistenz in der Wahrheit‘ unmöglich gemacht wird?“
Nach dem Tod von Pius XII., am 9. Oktober 1958, wandelte sich das Klima, und Agostino Casaroli wurde zum Hauptakteur der Politik des Heiligen Stuhls gegenüber dem Osten, die von Johannes XXIII. gefördert, vor allem aber von Paul VI. verwirklicht wurde. In jenen Jahren hatte Bischof Hnilica Gelegenheit, Papst Montini häufig zu treffen und ihm verschiedene Denkschriften zu übergeben, in denen er ihn vor Illusionen warnte. Er macht ihn darauf aufmerksam, daß die kommunistischen Regime nicht auf ihren Plan verzichten, die Kirche zu beseitigen, sondern Gespräche mit dem Heiligen Stuhl allein deshalb akzeptierten, um daraus einseitige Vorteile zu ziehen. Unter anderem dank der dadurch gewonnenen Glaubwürdigkeit in ihren Ländern und außerhalb, ohne auf ihre kirchenfeindliche Politik verzichtet zu haben. „Hnilica“, so Emilia Hrabovec, „forderte, sich nicht mit kosmetischen Zugeständnissen zufriedenzugeben, sondern die Freilassung und die Rehabilitierung aller Bischöfe, Priester und Ordensleute und Gläubigen zu verlangen, die noch im Gefängnis saßen, die wirkliche Anerkennung der freien Glaubensausübung zu fordern, und nie der Entfernung der verhinderten Bischöfe aus ihrem Amt zuzustimmen, denn das wäre ‚die schlimmste Demütigung ihrer Person, und durch sie der ganzen Märtyrerkirche, vor den Verrätern, Feinden und der ganzen Öffentlichkeit‘. Der exilierte Bischof befürchtete, daß Verhandlungen, die über die Köpfe des heldenhaftesten Teils des Episkopats hinweg geführt werden, und ein Abkommen, das ohne nennenswerte Zugeständnisse abgeschlossen wird, in den Katholiken, vor allem den Besten, die mit Kraft und Treue der Verfolgung standgehalten hatten, Verwirrung auslösen würde und das Gefühl entstehen lassen mußte, sogar von der kirchlichen Obrigkeit im Stich gelassen worden zu sein.“
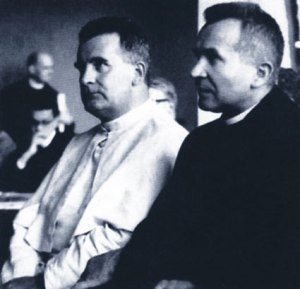
Während das Zweite Vatikanische Konzil stattfand, machte Paul VI. am 13. Mai 1964, die Bischofswürde von Msgr. Hnilica bekannt, die bis dahin geheimgehalten worden war. Der neue Status ermöglichte es dem slowakischen Bischof an der letzten Session des Konzils teilzunehmen, wo er sich den Konzilsvätern anschloß, die eine Verurteilung des Kommunismus forderten. Msgr. Hnilica sagte in der Konzilsaula, daß das, was das Schema Gaudium et Spes über den Atheismus sagte, so wenig war, „daß es dem gleichkommt, als würde man nichts sagen“. Er fügte hinzu, daß ein großer Teil der Kirche „unter der Unterdrückung durch den militanten Atheismus“ leidet, „was man aber dem Schema nicht entnehmen kann, obwohl es von der Kirche in der Welt von heute sprechen will!“. „Die Geschichte wird uns für diesen Schweigen zu Recht der Duckmäuserei oder der Blindheit anklagen.“ Der Bischof erinnerte daran, daß er nicht abstrakt über das Thema sprach, weil er zusammen mit 700 Priestern und Ordensleuten in einem Konzentrationslager interniert war. „Ich spreche aus direkter Erfahrung und der Erfahrung der Priester und Ordensleute, die ich in Gefangenschaft kennengelernt habe, und mit denen ich die Last und die Gefahr für die Kirche getragen habe“ (AS, IV/2, S. 629ff).
Zu jener Zeit führte Bischof Hnilica zahlreiche Gespräche mit Paul VI., um ihn von der Ostpolitik abzubringen. Vergeblich. Im Februar 1965 wurde der Erzbischof von Prag und Primas von Böhmen, Josef Beran (1888–1969) freigelassen und kam nach Rom. Paul VI. kreierte ihn zum Kardinal. Msgr. Hnilica warnte den Papst, daß er vermeintliche Erfolg der vatikanischen Diplomatie in Wirklichkeit ein Erfolg des kommunistischen Regimes war, daß sich mit der Exilierung des Erzbischofs, eines immer lästiger werdenden, internationalen Problems entledigte, ohne irgend etwas vom zaghaften, neuen Administrator des Prager Erzbistums befürchten zu müssen, der ein Mitglied der regimehörigen Bewegung der Friedenspriester war.
Emilia Hrabovec erinnert daran, daß es Rom gelungen war, 1964 ein Abkommen mit Ungarn zu unterzeichnen, dem 1966 ein Abkommen mit Jugoslawien folgte, und auf höchster Ebene diplomatische Treffen mit Spitzenvertretern der Sowjetunion einzuleiten. Die Gespräche mit der Tschechoslowakei erwiesen sich aber weiterhin als sehr schwierig und zeitigten weniger Ergebnisse denn je. „Die tschechoslowakischen Vertreter setzten sich an den Verhandlungstisch mit der ausdrücklichen Anweisung, auf Zeit zu spielen, jedes Zugeständnis abzulehnen und nur das zu akzeptieren, was einseitig ihnen einen Vorteil versprach oder die Gegenseite schädigte, sodaß die Verhandlungen sich meist darauf beschränkten, die jeweiligen, unvereinbaren Standpunkte zu formulieren mit der Zusage, die Treffen fortzusetzen.“
Kardinal Korec schilderte die Situation nach seiner Freilassung aus den kommunistischen Ketten so:
„Unsere Hoffnung war die Untergrundkirche, die im Stillen mit den Priestern in den Pfarreien zusammenarbeitete und junge Menschen formte, die zum Opfer bereit waren: Professoren, Ingenieure, Ärzte, die bereit waren, Priester zu werden. Diese Personen arbeiteten im Verborgenen unter der Jugend und in den Familien. Sie veröffentlichten im Geheimen Zeitschriften und Bücher. In Wirklichkeit hat die Ostpolitik diese unsere Aktivität verkauft für vage und unverbindliche Versprechen der Kommunisten. Die Untergrundkirche war unsere große Hoffnung. Stattdessen haben sie ihr die Pulsadern durchgeschnitten, haben sie Tausende von jungen Menschen angewidert, Väter und Mütter und auch viele Untergrundpriester, die bereit waren, sich zu opfern. […] Für uns war das wirklich eine Katastrophe, als hätten sie uns im Stich gelassen, weggefegt. Ich habe gehorcht, aber es war der größte Schmerz meines Lebens. Die Kommunisten bekamen so die öffentliche Seelsorge der Kirche in die Hand.“[1]Interview in der Tageszeitung Il Giornale, 28. Juli 2000.
Das vatikanische Staatssekretariat begann unter dem Druck der Prager Regierung auch die öffentlichen Aktivitäten des slowakischen Bischofs zu bremsen, und 1971 wurde er sogar aufgefordert, Rom zu verlassen und nach Übersee zu gehen. Der Vorwurf lautete, so Hrabovec, der Bischof sei zur Belastung für die Verhandlungen geworden, und damit der Grund, weshalb die Kirche in der Tschechoslowakei noch immer verfolgt werde, und er handle gegen den Willen des Papstes. Vorwürfe, die den Bischof schwer trafen, sodaß er sich bereit erklärte, Rom zu verlassen, aber nur, wenn der Papst oder sein Ordensgeneral es ihm ausdrücklich befiehlt. Da ein solcher Befehl weder von der einen noch der anderen Seite erfolgte, blieb Hnilica in der Ewigen Stadt und setzte seine Aktivitäten fort, wenn auch seine Kontakte mit dem Staatssekretariat beendet wurden.
Die Jahre der Ostpolitik waren auch jene des „Historischen Kompromisses“[2]Bemühungen für eine Zusammenarbeit zwischen der oppositionellen Kommunistischen Partei Italiens (PCI) und den regierenden Christdemokraten (DC), die mit der Entführung und Ermordung des ehemaligen … Continue reading Als vielen die kommunistische Verfolgung bereits ein Kapitel der Vergangenheit schien, und die Kommunistische Partei Italiens bis dahin nicht gekannte Wahlerfolge feierte, „warnte der Bischof weiter unermüdlich davor, daß die kommunistischen Regime nur ihre Taktik gewechselt hatten und raffiniertere Methoden anwandten, ohne auch nur einen Schritt von ihrem religions- und menschenfeindlichen Programm abzurücken, und daß die Kirche vor ihrem Gewissen verpflichtet war, sich nicht mit dem kommunistischen Regime und seinen Gesetzen abzufinden, sondern weiterhin dessen Verbrechen anzuklagen und vor den Gefahren, die es darstellte, zu warnen“.
Hrabovec schreibt weiter:
„Mit der Radikalität des Evangeliums, wie sie tiefreligiösen Menschen eigen ist, war Hnilica überzeugt, daß in einer Zeit der ‚Letztentscheidung für die Wahrheit oder gegen die Wahrheit, für Gott oder gegen Gott‘, eine neutrale Position unmöglich war. Er sich nicht auf die Seite der Wahrheit stellte, wurde zum Komplizen der Lüge und mitverantwortlich für die Ausbreitung des Bösen. Mit diesem Geist kritisierte Hnilica die westliche Politik der Entspannung und der Kompromisse mit den kommunistischen Regimen hart, ebenso die Schwäche und Gleichgültigkeit der Christen im Westen, die zu sehr auf sich selbst fixiert waren, zu sehr erpicht darauf, den eigenen materiellen Wohlstand zu verteidigen und zu wenig bereit, sich für die Brüder hinter dem Eisernen Vorhang zu interessieren und einzusetzen und zu wenig bereit, die eigenen christlichen Werte zu verteidigen. In Anlehnung an das bekannte Wort von Pius XI. aus den 30er Jahren klagte Hnilica das Schweigen der Politik, der Medien und der öffentlichen Meinung, auch der katholischen, zum kommunistischen Regime und der Verfolgung der Christen hinter dem Eisernen Vorhang als ‚Verschwörung des Schweigens‘ an. Er bemerkte damals, daß es früher üblich war, von der Kirche hinter dem Eisernen Vorhang als ‚Kirche des Schweigens‘ zu sprechen. Nun aber wäre es angebrachter, damit die Kirche (die Kirchen) des Westens zu bezeichnen.“
Bischof Paul Hnilica war ein zutiefst guter Mensch und manchmal auch etwas naiv. Als ich ihn 1976 kennenlernte, wurde er von seinem Sekretär Witold Laskowski begleitet, einem polnischen Aristokraten, polyglott und von makellosen Manieren, der in seinen Gesichtszügen und seiner ganzen Statur auf verblüffende Weise Winston Churchill ähnelte. Laskowski war nach Italien emigriert und hatte sich in den 20er Jahren der Armee von General Wladislaw Anders angeschlossen und sein Leben dem Kampf gegen den Kommunismus gewidmet. Er war eine Art „Schutzengel“ von Bischof Hnilica. Er durchkreuzte die Operationen und Manöver der kommunistischen Geheimdienste, die seine Gruppe infiltriert hatten. Sie bedienten sich dabei nicht nur eines dichten Agentennetzes, sondern auch der Hilfe der Kommunistischen Partei Italiens. Wäre Laskowski noch am Leben gewesen, wäre Msgr. Hnilica in den 90er Jahren nie in eine üble Geschichte verwickelt worden, als er sich vom Geschäftemacher und Freimaurer Flavio Carboni überreden ließ, ihm Geld zur Verfügung zu stellen, um die nötigen Dokumente zu sammeln, mit denen die Unschuld des Vatikans am Zusammenbruch des Banco Ambrosiano bewiesen werden sollte.[3]Die Insolvenz und der damit verbundene Finanzbetrug des Banco Ambrosiano, der 1982 liquidiert wurde, war seither ein Skandal, der in der Sache schon geeignet war, das Ansehen der Kirche zu … Continue reading
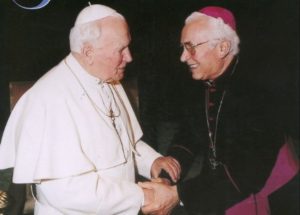
Msgr. Hnilica war ein großer Verehrer Unserer Lieben Frau von Fatima. Er war überzeugt, daß es sich bei dieser Erscheinung um eine der stärksten Manifestationen Gottes in der Menschheitsgeschichte seit der Zeit der Apostel handelte. In allen Kontakte, die er mit den Päpsten hatte, drängte er immer darauf, daß die Weihe Rußlands an das Unbefleckte Herz Mariens durchgeführt werde, wie es die Gottesmutter am 13. Juli 1917 gewünscht hatte. Johannes Paul II. schrieb, als er am 13. Mai 1981 bei einem Attentat schwerverletzt wurde, sein Überleben dem wunderbaren Schutz der Gottesmutter von Fatima zu. Deshalb drängte es ihn, deren Botschaft in Fatima zu vertiefen. Während seiner Genesung in der Gemelli-Klinik bat er Bischof Hnilica um eine vollständige Dokumentation zu Fatima. Am 13. Mai 1982 begab sich der Papst selbst auf Pilgerschaft nach Fatima, wo er der Gottesmutter „jene Menschen und Nationen“ anvertraut und weihte, „die dieses Anvertrauens und dieser Weihe besonders bedürfen“. Am Tag darauf kam es zur Begegnung zwischen Sr. Lucia und Bischof Hnilica, der von Don Luigi Bianchi und Wanda Poltawska begleitet wurde. Als sie die Ordensfrau fragten, ob sie die vom Papst durchgeführte Weihe für gültig halte, machte die Seherin mit der Hand eine Bewegung, mit der sie nein sagte, um dann den Anwesenden zu erklären, daß es eine ausdrückliche Weihe Rußlands brauche.
Eine zweite Weihe nahm Johannes Paul II. am 25. März 1984 auf dem Petersplatz in Gegenwart der Statue der Gottesmutter vor, die er eigens aus Portugal holen ließ. Auch in diesem Fall wurde Rußland nicht namentlich genannt. Es gab nur einen indirekten Bezug auf „die Völker, von denen Du Dir unsere Weihe und unser Anvertrauen erwartest“. Der Papst hatte den Bischöfen der ganzen Welt geschrieben und sie gebeten, sich mit ihm zu vereinen. Zu den wenigen, die darauf reagierten, gehörte Paul Hnilica, dem es in Indien, wo er sich gerade aufhielt, gelang, ein Touristenvisum für die Sowjetunion zu erhalten. Am selben 25. März begab er sich als Tourist in den Kreml, wo er hinter den großen Blättern der Prawda verborgen, die Worte für die Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens sprach.
Am 12. und 13. Mai 2000 war ich mit Bischof Hnilica in Fatima, als Johannes Paul II. die beiden Hirtenkinder Jacinta und Francisco seligsprach. Ich habe seinen überzogenen Optimismus über das Pontifikat von Johannes Paul II. nicht geteilt, aber die Erinnerung, die ich an ihn habe, mit dem ich 25 Jahr lang Kontakt haben durfte, ist die eines Mannes von großem Glauben, der heute an der Seite jener stehen würde, die gegen das kämpfen, was Kardinal Zen den „Ausverkauf der Kirche“ nennt.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana/Wikicommons/alianciazanedelu.sk (Screenshots)
-
| ↑1 | Interview in der Tageszeitung Il Giornale, 28. Juli 2000. |
|---|---|
| ↑2 | Bemühungen für eine Zusammenarbeit zwischen der oppositionellen Kommunistischen Partei Italiens (PCI) und den regierenden Christdemokraten (DC), die mit der Entführung und Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten und christdemokratischen Parteivorsitzenden Aldo Moro durch die kommunistische Terrororganisation Rote Brigaden (BR) 1978 endeten, Anm. des Übersetzers. |
| ↑3 | Die Insolvenz und der damit verbundene Finanzbetrug des Banco Ambrosiano, der 1982 liquidiert wurde, war seither ein Skandal, der in der Sache schon geeignet war, das Ansehen der Kirche zu beschädigen, und darüber hinaus international eifrig, von manchen bereitwillig, von anderen gezielt, zur Ansehensschädigung der Kirche mißbraucht wurde. Die Hauptzutat lieferte der Brite David Yallop mit seinem Buch „Im Namen Gottes?“, in dem er Wahrheit und Fiktion zu einer reißerischen Verzerrung vermengte und behauptete, Johannes Paul I. sei ermordet worden. Roberto Calvi, der Präsident des Banco Ambrosiano, war 1982 ermordet worden. Carboni trat später an Bischof Hnilica heran und behauptete, an die Aktentasche Calvis gelangt zu sein. Darin befänden sich Dokumente, welche die Unschuld des Vatikans im Bankenskandal belegen und den beschmutzen Ruf von Papst Johannes Paul II. wiederherstellen könnten. Bischof Hnilica kaufte Carboni die Tasche ab und wurde deshalb 1993 im Rahmen eines aufgeheizten Klimas in Italien („Mani pulite“), in dem offenbar selbst manche Richter für wahr hielten, was sie glauben wollten, wegen Hehlerei verurteilt. Ihm gelang es jedoch, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. 2000 wurde er von allen Vorwürfen freigesprochen. Eine bittere Erfahrung für ihn war der Vorfall dennoch, Anm. des Übersetzers. |




