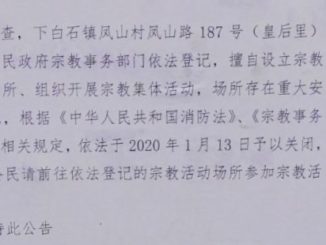(Rom) Der seit Ende Oktober amtierende „Schwarze Papst“, der Generalobere des Jesuitenordens, Pater Arturo Sosa SJ, fordert zu einer „Neuinterpretation“ von Jesus auf. „Unglaublich, aber wahr“, so der Vatikanist Sandro Magister über ein erschütterndes Interview des Schweizer Journalisten Giuseppe Rusconi mit General Sosa.
Papst zitiert im umstrittenen VIII. Kapitel von Amoris laetitia kein Jesus-Wort
„Im Achten Kapitel von Amoris laetitia, dem heißesten und kontroversesten, in dem Papst Franziskus der Zweitehe ‚zu öffnen‘ scheint, obwohl der vorherige Ehegatte noch lebt, fehlt jegliches Zitat eines Jesus-Wortes über die Ehe und die Scheidung, die vor allem im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums wiedergegeben sind“, so Magister.
„Viele Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten, und fragten: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete: Habt ihr nicht gelesen, daß der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und daß er gesagt hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm: Wozu hat dann Mose vorgeschrieben, daß man (der Frau) eine Scheidungsurkunde geben muß, wenn man sich trennen will? Er antwortete: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch: Wer seine Frau entläßt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm: Wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht – um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es.“
Dieses völlige Fehlen eines Zitates der Herrenworte „erstaunt“, so Magister, „wie auch an anderer Stelle das Schweigen von Franziskus zur selben Frage“.
„Warum dieses insistente Schweigen des Papstes zu unmißverständlichen Jesus-Worten?“
Am 4. Oktober 2015, einem Sonntag, wurde die zweite Bischofssynode über die Familie eröffnet. An jenem Tag wurde in allen katholischen Kirchen des lateinischen Ritus weltweit die Parallelstelle aus dem Markusevangelium 10, 2–9 zum Matthäusevangelium (19,2–12) vorgelesen (Erste Rede bei Bischofssynode hält der Heilige Geist – Exklusiv der vollständige Wortlaut). Beim Angelus erwähnte Papst Franziskus diese Stelle des Evangeliums jedoch mit keinem Wort, obwohl es direkt mit der Synode zu tun hatte, über die der Papst ausführlich sprach.
Dasselbe geschah am vergangenen 12. Februar, wieder ein Sonntag, mit einer analogen Stelle aus dem Matthäusevangelium (5,11–12), die an jenem Tag in den Heiligen Messen verkündet wurde. Erneut schwieg sich Papst Franziskus beim Angelus darüber aus. Weder zitierte er die Stelle noch legte er sie aus. Er erwähnte sie einfach nicht.
„Warum dieses insistente Schweigen des Papstes zu so unmißverständlichen Jesus-Worten?“, so Magister.
Neuer Jesuitengeneral will Jesus „neu interpretieren“

„Ein Hinweis findet sich“ so Magister, und zwar in einem Interview des neuen Generaloberen des Jesuitenordens, des Venezolaners Arturo Sosa Absacal, der Papst Franziskus, selbst Jesuit, sehr nahesteht. Das Interview führte der bekannte Tessiner Journalist Giuseppe Rusconi.
Bemerkenswert sind die Reaktionen des Ordensgenerals auf Fragen, mit denen ihn Rusconi in die Enge treibt. Er verschanzt sich hinter der Autorität des Papstes oder nimmt, vom Interviewer an einer Stelle mit dem Rücken zur Wand gestellt, Zuflucht zum Heiligen Geist, womit gewissermaßen alles im nebulösen Nichts entschwindet.
Das Interview ist ein erschütterndes Dokument über den geistigen Zustand eines Teils der obersten Führungsebene in der katholischen Kirche, der derzeit tonangebend scheint.
Die interessantesten Stellen im Wortlaut:
Ein erschütterndes Interview
Rusconi: Kardinal Gerhard Müller, der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, sagte bezüglich der Ehe, daß die Worte Jesu eindeutig sind, und „keine Macht im Himmel und auf Erden, weder ein Engel noch der Papst, weder ein Konzil noch ein Gesetz der Bischöfe, die Vollmacht hat, sie zu ändern“.
Arturo Sosa: Zunächst müßte man eine schöne Überlegung darüber beginnen, was Jesus wirklich gesagt hat. Zu jener Zeit hatte niemand ein Aufnahmegerät, um die Worte festzuhalten. Was man weiß, ist, daß die Worte Jesus in den Kontext zu stellen sind. Sie sind in einer bestimmten Sprache, in einem bestimmten Umfeld gesagt worden, sie sind an jemand bestimmten gerichtet.
Rusconi: Ja, aber, wenn alle Worte Jesu zu überprüfen und auf ihren historischen Kontext zurückzuführen sind, dann haben sie keinen absoluten Wert.
Arturo Sosa: In den vergangenen hundert Jahren gab es in der Kirche eine große Blüte von Studien, die versuchen, exakt zu verstehen, was Jesus sagen wollte … Das ist nicht Relativismus, aber belegt, daß das Wort relativ ist, das Evangelium ist von Menschen geschrieben, es ist von der Kirche anerkannt, die aus Menschen gemacht ist … Daher ist es wahr, daß niemand das Wort Jesu ändern kann, aber man muß wissen, welches eines ist!
„Man stellt nicht in Zweifel, man unterscheidet …“
Rusconi: Steht auch die Aussage von Matthäus 19,2–6 zur Diskussion: „Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen“?
Arturo Sosa: Ich identifiziere mich mit dem, was Papst Franziskus sagt. Man stellt nicht in Zweifel, man unterscheidet…
Rusconi: Aber die Unterscheidung ist eine Wertung, ist eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen. Gibt es keine Pflicht mehr, einer einzigen Interpretation zu folgen?
Arturo Sosa: Nein, die Pflicht gibt es immer, aber den Ergebnissen der Unterscheidung zu folgen.
„Ich bezweifle nicht das Wort Jesu, aber das Wort Jesu wie wir es interpretiert haben“
Rusconi: Aber die Letztentscheidung gründet sich dann auf ein Urteil zu verschiedenen Hypothesen. Ziehen Sie also auch die Hypothese in Betracht, daß der Satz „Der Mensch darf nicht trennen …“ nicht exakt das ist, was er scheint? Kurzum, bezweifeln Sie das Wort Jesu?
Arturo Sosa: Nicht das Wort Jesu, aber das Wort Jesu wie wir es interpretiert haben. Die Unterscheidung wählt nicht unter verschiedenen Hypothesen, sondern ist bereit, auf den Heiligen Geist zu hören, der – wie Jesus verheißen hat – uns hilft, die Zeichen der Gegenwart Gottes in der Geschichte der Menschen zu verstehen.
Rusconi: Aber wie soll man unterscheiden?
Arturo Sosa: Papst Franziskus unterscheidet, indem er dem Heiligen Ignatius folgt wie die ganze Gesellschaft Jesu: Der Heilige Ignatius sagte, es ist notwendig, den Willen Gottes zu suchen und zu finden. Das ist keine Suche zum Spaß. Die Unterscheidung führt zu einer Entscheidung: Man hat nicht nur zu bewerten, sondern zu entscheiden.
„Der Vorrang des persönlichen Gewissens“
Rusconi: Und wer hat zu entscheiden?
Arturo Sosa: Die Kirche hat immer den Vorrang des persönlichen Gewissens bekräftigt.
Rusconi: Dann schauen wir einmal, ob ich das richtig verstanden habe: Wenn also das Gewissen, nach einer Unterscheidung des Falles, mir sagt, daß ich zur Kommunion gehen kann, auch wenn die Norm es nicht vorsieht …
Arturo Sosa: Die Kirche hat sich in den Jahrhunderten entwickelt, sie ist kein Block aus Stahlbeton. Sie ist entstanden, hat gelernt, hat sich verändert. Deshalb macht man die ökumenischen Konzile, um zu versuchen, die Entwicklungen der Glaubenslehre zu fokussieren. Doktrin ist ein Wort, das ich nicht besonders mag, es vermittelt den Eindruck einer Härte von Steinen. Die menschliche Wirklichkeit hat viel mehr Schattierungen, sie ist nie weiß oder schwarz, sie befindet sich in einer ständigen Entwicklung.
Rusconi: Mir scheint, zu verstehen, daß es für Sie einen Vorrang der Praxis der Unterscheidung gegenüber der Lehre gibt.
Arturo Sosa: Ja, aber die Lehre ist Teil der Unterscheidung. Eine wahre Unterscheidung kann nicht von der Lehre absehen.
Rusconi: Sie kann aber zu anderen Schlußfolgerungen gelangen als die Lehre.
Arturo Sosa: Das ja, weil die Lehre die Unterscheidung nicht ersetzt und auch nicht den Heiligen Geist.
Zu Arturo Sosa siehe auch:
- „Schwarzer Papst“ mit „marxistischer“ Vergangenheit – Jesuiten haben neuen Ordensgeneral
- Die marxistische Vermittlung des christlichen Glaubens – Von Arturo Sosa Abascal (1978), dem neuen Jesuitengeneral
- Amoris laetitia: Neuer Jesuitengeneral nimmt zu „Zweifeln“ der vier Kardinäle Stellung
Erstveröffentlichung des Interviews: 18. Februar im Giornale del Popolo von Lugano (Auszüge) und bei Rossoporpora (vollständig).
Text/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: gesuiti.it/vatican.va (Screenshots)