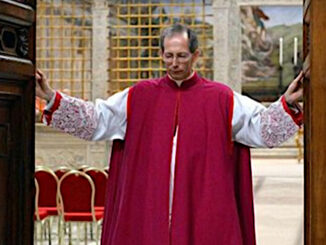Von Caminante Wanderer*
Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, daß Päpste Interviews geben. Eigentlich würde ich es vorziehen, wenn sie dieses Format ganz vermeiden würden, und ich hoffe nur, daß Leo XIV. nicht Gefallen daran findet, sodaß wir am Ende wöchentliche Interviews bekommen, so wie es bei seinem verstorbenen Vorgänger der Fall war. Aber da wir nun schon eine pontifikale Stellungnahme dieser Art haben, wollen wir sehen, was sich darüber sagen läßt.
I. Der Papst ist katholisch
Zunächst einmal, wie ich im vorherigen Artikel bereits sagte, ist klar, daß der Papst katholisch ist:
„Ich glaube fest an Jesus Christus, und das ist meine Priorität, denn ich bin der Bischof von Rom und Nachfolger Petri, und der Papst muß den Menschen helfen zu verstehen, besonders den Christen, den Katholiken, daß genau das unser Wesen ist. […] Aber ich habe keine Angst zu sagen, daß ich an Jesus Christus glaube, der am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, und daß wir gemeinsam dazu berufen sind, diese Botschaft zu teilen.“
Ich weiß, er wiederholt hier die Grundlagen des Katechismus, aber wir kommen aus der Erfahrung mit Franziskus, der so etwas nie gesagt hat, sondern eher das Gegenteil davon zum Ausdruck brachte oder andeutete. Leo XIV. ist katholisch und glaubt, anders als sein Vorgänger, an unveränderliche Wahrheiten:
„Ich weiß nicht, ob ich eine andere Antwort habe, als den Leuten weiterhin zu sagen, daß es die Wahrheit gibt, die authentische Wahrheit. Ich habe wenig Verständnis dafür, wenn ich höre, wie Leute sagen: ‚Das ist eine alternative Faktenlage‘, etwas, das wir in der Vergangenheit oft gehört haben.“
Ich wäre versucht, wenn ich einen Glockenturm bei mir zuhause hätte, sofort die Glocken läuten zu lassen. Seit der Zeit Benedikts XVI. haben wir keine so klaren und katholischen Aussagen mehr gehört.
Aber abgesehen davon, katholisch zu sein, weiß Leo XIV. auch sehr genau, was sein munus, sein Amt, ist:
„Papst zu sein, dazu berufen, andere im Glauben zu bestärken, was der wichtigste Teil ist, ist auch etwas, das nur durch die Gnade Gottes geschehen kann; es gibt keine andere Erklärung. Der Heilige Geist ist die einzige Art, das zu erklären. […] Ich hoffe, andere im Glauben bestärken zu können, denn das ist die grundlegende Aufgabe des Nachfolgers Petri.“
Wir hören hier die klassische Lehre über das Papsttum wieder, und darüber hinaus schließt er ausdrücklich die Phantasien einiger kürzlich amtierender Pontifexe aus, die sich für „Experten in Sachen Menschlichkeit“ hielten, wie Paul VI., oder für „Experten in Klimatologie und Migration“, wie Franziskus. Papst Leo XIV. sagt:
„Ich sehe nicht, daß meine Hauptaufgabe darin besteht, der Problemlöser der Welt zu sein. So sehe ich meine Rolle überhaupt nicht.“
Und er sieht sie nicht so, weil seine Rolle, sein Amt, sein munus darin besteht, uns im Glauben zu bestärken.
II. Die Synodalität
Auf die Frage der Journalistin nach der von Papst Franziskus eingeleiteten Synodalität versichert der Pontifex, daß er diesen Weg weitergehen wird, erklärt aber ohne viel Umschweife, daß das, was er unter Synodalität versteht, nichts anderes ist als das, was die Kirche über viele Jahrhunderte praktiziert hat: allen zuzuhören. Das waren und sind die ökumenischen Konzilien. So sehr, daß das Konzil von Trient (ja, das von Trient) Luther eingeladen hat, um dort zu sprechen. Dieser kam nicht, schickte aber seinen Delegierten Melanchthon. Wie gesagt, mir gefiel nicht, daß der Papst James Martin SJ oder die Schwester Caram (die völlig verrückt ist) empfangen hat, aber das war lange Zeit die übliche Vorgehensweise der Kirche. Ob Arius beim Konzil von Nicäa gehört wurde, ist nicht gesichert, aber sein Freund Eusebius von Nikomedien war anwesend und vertrat seine Ideen. Nestorius nahm aktiv am Konzil von Ephesus (431) teil, und Makarios von Antiochien verteidigte persönlich den Monothelitismus auf dem Dritten Konzil von Konstantinopel (680–681). Noch einmal: Mir gefällt das Bild von Martin oder Caram mit Leo XIV. nicht, aber vor Jahrhunderten hätte ich ähnliche Bilder gesehen, mit weit gefährlicheren Häretikern als der leichtfertigen Dominikanerin oder dem weichen Martin.
Deshalb besteht Synodalität, so wie Leo sie versteht, nicht darin, „zu versuchen, die Kirche in eine Art demokratische Regierung zu verwandeln, denn wenn wir uns viele Länder der Welt heute anschauen, ist Demokratie nicht notwendigerweise eine perfekte Lösung für alles“. Wenn wir das Zauberwort hören, mit dem der alte und verstorbene Jesuit die Leute bezauberte, müssen wir wissen, daß sein Nachfolger über ganz andere Dinge spricht.
III. Der Proselytismus
Ein weiterer Unterschied zu früheren Pontifikaten ist, daß Leo XIV. viele Jahre Missionar in Peru war, und wir wissen alle, daß nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und vor allem mit dem „Magisterium“ von Franziskus Missionare oft nicht die Aufgabe hatten, das Evangelium zu predigen: Proselytismus war verboten, und zwar nicht nur in Missionsländern, sondern auch in ehemals christlichen Ländern. Tatsächlich kenne ich mehrere Fälle, in denen französische und spanische Priester die Aufnahme von Konvertiten aus dem Islam oder christlichen Sekten verweigert haben. Leo XIV. hingegen feiert diese Hinwendung von Jugendlichen und Erwachsenen zur Taufe und zum Glauben:
„Gestern habe ich mich mit einer Gruppe junger Franzosen getroffen. Im letzten Jahr haben tausende junge Erwachsene frei die Taufe gesucht. Sie wollen zur Kirche kommen, weil sie gemerkt haben, daß ihr Leben leer ist, oder ihnen etwas fehlt, oder daß es keinen Sinn hat, und sie entdecken neu etwas, das die Kirche zu bieten hat.“
Und was sie zu bieten hat, ist nicht mehr und nicht weniger als Jesus Christus, an den er glaubt. Die Veränderung, auch wenn sie subtil vorgetragen wird, ist grundlegend.
IV. Die Weihe von Frauen
Dazu sagt er:
„Ich hoffe, den Schritten von Franziskus zu folgen, einschließlich der Ernennung von Frauen in bestimmte Führungspositionen auf verschiedenen Ebenen im Leben der Kirche, indem ihre Gaben und ihr Beitrag auf vielfältige Weise anerkannt werden.“
Und ohne dem Thema auszuweichen, stellt er klar, daß das eigentliche Problem ist, ob Frauen das Weihesakrament empfangen können. Er denkt nicht einmal daran, sich die Existenz von Frauen als Priesterinnen vorzustellen, sondern spricht von Diakoninnen. Und er bringt subtil ein Ad-hominem-Argument vor, das in wenigen Worten besagt:
„Das Zweite Vatikanische Konzil hat das ständige Diakonat wiederhergestellt, und in vielen Diözesen gibt es ständige Diakone, und trotzdem fragen wir uns immer noch, was sie sind und wozu sie dienen.“
Ergo, laßt uns keine Diakoninnen weihen.
Aber der deutlichste Satz dazu lautet:
„Ich habe momentan nicht die Absicht, die Lehre der Kirche zu diesem Thema zu ändern.“
Das heißt, solange ich Papst bin, wird es keine Diakoninnen geben. Was an dieser Stelle und auch beim Homo-Thema auffällt, ist die Formulierung „momentan“; es ist verständlich, daß das Unzufriedenheit hervorruft, und viele, meiner Ansicht nach zu Unrecht, annehmen, diese Formulierung impliziere zwangsläufig, daß der Papst in Zukunft eine Änderung dieser Lehre in Betracht ziehen könnte. Ich denke das nicht. Sehen wir es rein logisch: Leo XIV. ist schließlich Mathematiker. Die Formulierung beschränkt die Verneinung („Ich habe nicht die Absicht“) auf die Gegenwart (t), ohne sie auf zukünftige Zeitpunkte (t’) auszudehnen. Wenn die Aussage ¬I(y, C, t) lautet (wobei I „die Absicht zu ändern“ bedeutet, y der Sprecher, C die Lehre und t der gegenwärtige Zeitpunkt ist), dann betont „momentan“, daß die Verneinung nur für t gilt, der Zustand in t’ aber offen bleibt. Die kontroverse Formulierung macht die Aussage zu einer temporalen Konditionalen: ∀t’ (t’ = t → ¬I(y, C, t’)), wobei t die Gegenwart ist. Sie trifft keine Aussage über t’ ≠ t.
Bedeutet diese Aussage, daß der Papst glaubt, die Lehre werde sich künftig ändern? Nein. Logisch gesehen impliziert sie keine Erwartung eines Wechsels. Die Formulierung ist neutral bezüglich der Überzeugungen des Pontifex zur Zukunft; sie läßt nur die logische Möglichkeit eines Wechsels (oder Nicht-Wechsels) in t’ offen, ohne eine konkrete Überzeugung zu formulieren. Logisch folgt nicht, daß Leo XIV. an P (die Absicht zu ändern) für t’ glaubt, denn ¬I in t führt nicht zu einer Erwartung von I in t’.
Wenn wir die Überzeugung des Papstes ausklammern, bedeutet das, daß ein Wechsel erfolgen wird? Nein. Es besteht keine logische Implikation, daß ein Wechsel in der Zukunft stattfindet. Die Formulierung behauptet weder zukünftige Aktionen noch deren Verneinung; sie beschreibt nur das Fehlen der Absicht in t. Logisch bedeutet ¬I(y, C, t) nicht I(y, C, t’) noch die tatsächliche Durchführung des Wechsels (wofür nicht nur Absicht, sondern auch Fähigkeit und Handlung nötig wären).
Aus logischer Sicht kann dem Papst also keine Aussage oder Annahme über eine zukünftige Änderung der Lehre bezüglich des weiblichen Diakonats oder der Akzeptanz homosexueller Handlungen zugeschrieben werden. Daß die Logik uns dies sagt, bedeutet jedoch nicht, daß die Formulierung nicht problematisch ist, weil viele leicht zu einer ungültigen Schlußfolgerung kommen können, wie es tatsächlich geschehen ist. Warum hat der Papst sie dann benutzt? Ich sehe zwei Möglichkeiten: Entweder er glaubt tatsächlich, daß sich die katholische Lehre ändern könnte, oder er wollte die Aussage abmildern, um die Feministinnen, die ihn umgeben, zu beruhigen. Welche der beiden Optionen stimmt, weiß nur er, aber wie gesagt, Leo XIV. ist katholisch, weshalb ich eher an die zweite Möglichkeit glaube. Es versteht sich von selbst, daß es eine Naivität typisch US-amerikanischer Art ist, zu glauben, mit dieser Aussage würden sich die Wogen glätten. Es beruhigt niemanden, denn die Feministinnen sind wütend, ebenso wie die Homo-Gemeinschaft, die eher zornig ist über das, was der Papst gesagt hat. Ein Blick auf die neuesten Posts von Specola und die dort berichteten Nachrichten über die aktuellen Hysterien des „feministischen Kollektivs“ und des „LGBT-Kollektivs“ genügt. Leo XIV. spricht in dem Interview zu allen Katholiken und hat die „Sorge“, meiner Meinung nach vergeblich, niemanden – zumindest nicht zu sehr – zu beleidigen. Und das Ergebnis ist, daß er alle verärgert. Aber das Wesentliche ist, daß es logisch keinen Grund gibt anzunehmen, diese Aussage spiegele eine Meinung des Papstes über zukünftige Änderungen der Lehre in so sensiblen und heiklen Fragen wider.
Und für uns ist es beruhigend zu wissen, daß es für eine sehr lange Zeit – man erwartet ein langes Pontifikat – keine dramatischen Veränderungen geben wird, die wahrscheinlich zum Schisma führen würden. Wie ein Kommentator zum vorherigen Artikel sagte: „Wir haben Zeit gewonnen.“ Und darauf sind wir Argentinier gut vorbereitet.
V. Zu den LGBT
Kommen wir zum Thema LGBT. Ich gebe zu, daß mir diese Abkürzungen unangenehm sind, aber ich benutze sie einfach wegen ihrer Praktikabilität beim Verfassen eines Artikels.
Der Papst beginnt auf die Frage der Journalistin hin mit einer klaren Aussage:
„Es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, zumindest in naher Zukunft, daß sich die Lehre der Kirche in bezug auf Sexualität und Ehe ändert.“
Sehr deutlich, und zu der verwirrenden Formulierung „in naher Zukunft“ haben wir bereits oben ausführlich Stellung genommen. Kurz darauf bekräftigt er noch einmal:
„Die Lehre der Kirche wird so bleiben, wie sie ist, und das ist das, was ich im Moment dazu sagen kann. Ich halte das für sehr wichtig.“
Und andererseits erinnert er an die traditionelle Lehre:
„Familien müssen unterstützt werden, das, was man die traditionelle Familie nennt. Die Familie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Die Rolle der Familie in der Gesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten gelitten hat, muß anerkannt und wieder gestärkt werden.“
Und er betont:
„Die Familie ist ein Mann und eine Frau in einem feierlichen Bund, gesegnet im Sakrament der Ehe. Aber schon wenn ich das sage, weiß ich, daß manche das falsch verstehen werden.“
Er weiß, daß es den LGBTQ nicht gefallen wird, aber er sagt es ihnen trotzdem ganz offen.
Was viele am meisten verwirrt hat, ist eine weitere Aussage zum Thema:
„Was ich zu sagen versuche, ist das, was Franziskus sehr klar gesagt hat, als er sagte: ‚Alle, alle, alle.‘ Alle sind eingeladen.“
Doch hier gibt es einen fundamentalen Unterschied: Während Franziskus keine Bedingungen stellte, sodaß seine Worte als bedingungslose Aufnahme verstanden wurden, die nahe am Relativismus war, verwendet Papst Leo eine religiöse Sprache, die die Bedeutung dessen, was Franziskus sagte, umkehrt:
„Ich lade aber keine Person ein, weil sie eine bestimmte Identität hat oder nicht. Ich lade eine Person ein, weil sie Sohn oder Tochter Gottes ist.“
Das heißt, man tritt der Kirche nicht bei, indem man sich als schwul, bisexuell oder trans definiert und verlangt, daß alle einen so akzeptieren. Wir haben schon anderswo gesagt, daß es für die katholische Lehre keine anthropologische Kategorie „Homosexuelle“ gibt, und es ist eine Falle, diese Lüge zu übernehmen. Es gibt Männer und Frauen, die Versuchungen entgegen dem Sechsten Gebot mit Personen desselben Geschlechts haben, genauso wie es Menschen gibt, die versucht sind, Arme zu unterdrücken oder Arbeiter beim Lohn zu betrügen – alle diese Fälle sind Versuchungen, die, wenn sie sich verwirklichen, Sünden darstellen, die zum Himmel schreien. Gott ruft alle durch seine Kirche ohne Etikettierung, aber diese alle sollen sich auch nicht selbst etikettieren, um erkannt zu werden und stolz auf ihre Versuchungen und Sünden zu sein, die auf dem Etikett stehen. In die Kirche tritt man als Geschöpf ein, das Erlösung braucht. Kind Gottes zu sein bedeutet, daß die weltlichen Kategorien in der Suche nach Heiligkeit transformiert werden. Und genau das sagt Papst Leo: „Ich lade eine Person ein, weil sie Sohn oder Tochter Gottes ist“, das heißt, weil sie sich von der Gnade hat verwandeln lassen und ein neuer Mensch ist.
Um diese Idee zu verstärken, spart er nicht mit einer klaren Ansage an die Deutschen und Belgier:
„Im Norden Europas veröffentlicht man bereits Rituale, um ‚Personen zu segnen, die sich lieben‘, so drücken sie es aus, was ausdrücklich gegen das Dokument verstößt, das Papst Franziskus genehmigt hat, Fiducia supplicans.“
Er sagt ihnen: „Das dürft ihr nicht tun“, als Warnung: „Wenn ihr nicht damit aufhört, werde ich es verbieten.“
Viele sehen darin eine Bestätigung von Fiducia supplicans. Ich sehe jedoch eine kluge taktische Bewegung eines Kanonisten. Er sagt ihnen nicht, daß die Rituale an sich falsch sind, indem er sich auf den Liber Gomorrhianus des heiligen Petrus Damian stützt – das hätte keine Wirkung gehabt. Er beruft sich vielmehr auf ein aktuelles und geltendes Dokument; sie – die Deutschen – haben keine Argumente, es weiterhin zu tun. Das ist dieselbe Taktik, mit der man Monsignore Colombo oder Monsignore Lozano widerlegt, wenn sie die kniende Mundkommunion verbieten, nämlich mit dem Missale Romanum von Paul VI., das mir zwar nicht gefällt, aber eben gültig ist, und nicht mit den Texten von Pius V. oder Kardinal Ottaviani, denn die Argumentation würde bei letzteren keine Wirkung entfalten.
VI. Die traditionelle Messe
Kommen wir zum letzten Thema: die traditionelle Messe. Der Pontifex sagt:
„Es gibt ein weiteres Thema, das auch umstritten ist, und zu dem ich bereits mehrere Bitten und Briefe erhalten habe: die Frage, wie die Leute immer wieder die [Wieder-]Einführung der Messe in Latein erwähnen. Nun, man kann die Messe jetzt schon auf Latein feiern. Wenn es die Messe des Zweiten Vatikanums ist, gibt es kein Problem. Offensichtlich bin ich mir nicht sicher, wohin das gehen wird, wenn man die tridentinische Messe und die Messe von Paul VI. gegenüberstellt. Es ist offensichtlich sehr kompliziert.“
Im ersten Absatz möchte ich einige Punkte hervorheben. Erstens, es geht um den Ausdruck „Latin Mass“, mit dem sich englischsprachige Menschen fälschlicherweise auf die traditionelle Messe beziehen. Der Papst sagt, wenn es sich um eine „Messe in Latein“ im allgemeinen handelt, könne es sich um die Messe von Paul VI. handeln, die auf Latein gefeiert wird, „und das sei kein Problem“. Das Problem ist, daß es selbst dann Probleme gibt. Wir haben kürzlich erwähnt, daß mehrere argentinische Bischöfe ihren Gläubigen verbieten, auf den Knien zu kommunizieren, und schlimmer noch, es wird verboten, in ihren Pfarrmessen auf Latein zu singen. Jeder kann sich vorstellen, was mit einem Priester passieren würde, der auf die Idee käme, die Messe auf Latein zu zelebrieren, auch wenn es der Novus Ordo ist. Entweder weiß der Papst nicht, was tatsächlich in einem großen Teil der katholischen Welt geschieht, oder er versucht „den Hasen zu beschäftigen“, also das Thema zu umgehen.
Aber das tut er nicht, sondern spricht die Sache direkt an:
„Ich denke, manchmal waren die sogenannten ‚Abusus‘ [Mißbräuche] der Liturgie der Messe des Zweiten Vatikanums nicht hilfreich für Menschen, die eine tiefere Erfahrung des Gebets, der Begegnung mit dem Geheimnis des Glaubens suchten, die sie in der Feier der tridentinischen Messe zu finden glaubten. Noch einmal, wir sind polarisiert, sodaß wir sagen: ‚Nun, wenn wir die Liturgie des Zweiten Vatikanums richtig feiern, findest du wirklich so einen großen Unterschied zwischen dieser und jener Erfahrung?‘“
Hier sehe ich zwei Probleme: Die Mißbräuche der Messe des Zweiten Vatikanums waren nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen (die eine tiefere Erfahrung des Gebets und des Kontakts mit dem Geheimnis des Glaubens suchten) nicht hilfreich, sondern für alle Katholiken, für die römische Liturgie und für die Kirche selbst schädlich. Ein Abusus [Mißbrauch] kann nie nützlich sein und darf nie zugelassen werden. Und es scheint – und ich betone den Konditional – daß Leo eine Lösung anbietet: „Feiern wir die Messe von Paul VI. fromm und das Problem ist gelöst.“
In diesem Bereich muß man nicht weiter ausführen, daß das keine Lösung ist. Vielleicht kann der Papst das eigentliche Problem nicht erkennen und reduziert den ganzen Streit auf eine Frage unterschiedlicher pietistischer Empfindlichkeiten? Das ist wahrscheinlich und nicht überraschend.
Eine sehr kluge Freundin war besonders wütend über diese Aussage: „Leo XIV. versteht nicht, daß Liturgie etwas Empfangenes ist und Teil der Tradition und deshalb nicht von einer Gruppe Besserwisser oder einem Papst reformiert werden kann.“ Genau das sagte auch Papst Benedikt XVI. Aber das Problem ist, daß diesen wichtigen und sensiblen Punkt weder Paul VI., der die Reform autorisierte, noch Johannes Paul II., der sie festigte, noch Franziskus, der sie als einzigen Weg der Lex orandi etablierte, verstanden haben. Noch mehr, ich wage zu sagen, weil ich es gehört habe, daß auch ein Teil der Mitglieder der Priesterbruderschaft St. Pius X. und der Priesterbruderschaft St. Petrus das nicht versteht, für die gilt, „wenn die Reform der Messe von einem orthodoxen Papst gemacht worden wäre, sie sie akzeptiert hätten“, so wie sie die Reformen von Pius XII. und Johannes XXIII. akzeptiert haben. Es erscheint mir daher ungerecht, von Papst Leo, der in der schlimmsten Theologie der 70er Jahre ausgebildet wurde, Klarheit in einem Punkt zu verlangen, den nicht einmal die Anhänger der Tradition selbst besitzen, geschweige denn seine unmittelbaren Vorgänger.
Er endet mit einer guten Nachricht, ja, einer sehr guten Nachricht:
„Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, wirklich mit einer Gruppe von Menschen zusammenzusitzen, die sich für den tridentinischen Ritus einsetzen. Bald wird sich die Gelegenheit bieten, und ich bin sicher, daß es Gelegenheiten geben wird, darüber zu sprechen. Aber das ist ein Thema, bei dem wir, vielleicht auch mit der Synodalität, zusammenkommen und reden müssen. Es ist zu einem Thema geworden, das so polarisiert, daß die Leute oft nicht bereit sind, einander zuzuhören.“
Einige Hartnäckige haben dies übersehen, ohne zu bemerken, daß es eine Neuigkeit ist, die die Situation der Verteidiger der überlieferten Messe radikal verändern könnte. Der Papst setzt die Synodalität, wie er sie versteht, als Zuhören ein. Während Franziskus sich mit den Oberen der Petrusbruderschaft und des Instituts Christus König und Hohe Priester getroffen hat, waren das keine „synodalen“ Treffen, und damit meine ich Treffen, die darauf abzielten, die Gründe der anderen zu hören, um eine Entscheidung über ein konkretes Problem zu treffen. Die Entscheidung hatte er schon vorher mit Traditiones custodes getroffen – ebenso wie Johannes Paul II. mit Ecclesia Dei, bevor er den Oberen der neugegründeten Petrusbruderschaft empfing. Ich denke, daß die einzige „synodale“ Begegnung eines Papstes zum Thema der traditionellen Liturgie das Treffen war, das Paul VI. am 11. September 1976 mit Monsignore Marcel Lefebvre hatte – vor fast fünfzig Jahren – und dieses Treffen dauerte nur 38 Minuten. Vorhersehbarerweise brachte es nichts.
Konkret sagt ein Papst nach 50 Jahren, daß er eine Versammlung derjenigen einberufen wird, die die überlieferte Liturgie unterstützen und verteidigen, um ihnen zuzuhören und eine Lösung zu finden. Die vorherigen Päpste ließen sich von Mitgliedern ihrer Kurie beraten, um zu entscheiden; Leo will alle anhören. Ich weiß nicht, wie der Mechanismus dieses Treffens sein wird und wer eingeladen wird, aber allein die Tatsache, daß Leo XIV. sich öffentlich verpflichtet, eines einzuberufen, halte ich für eine Neuigkeit, die wir nur begrüßen können.
Im großen und ganzen scheint mir das Interview gut und vielversprechend zu sein. Es wird Dinge geben, die uns weniger gefallen, und andere, die uns überhaupt nicht gefallen, aber das rechtfertigt keineswegs die infame Behauptung, Papst Leo sei ein ‚Franziskus mit guten Manieren‘. Er ist katholisch; der Verstorbene war es nicht.
*Caminante Wanderer ist ein argentinischer Philosoph und Blogger.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Crux/Youtube (Screenshot)