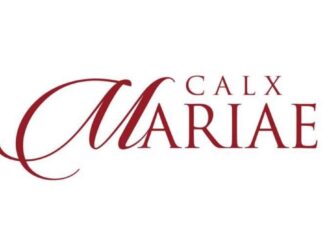Von Roberto de Mattei*
Der Krieg zwischen Israel und Iran, der sich mit jenem zwischen Rußland und der Ukraine überschneidet, macht die internationale Lage zunehmend beunruhigend. Wir lassen hierbei den historischen, politischen und wirtschaftlichen Kontext, aus dem diese Kriege hervorgegangen sind und sich weiterentwickeln, beiseite und verweilen bei dem sittlichen Problem, das sich am Horizont abzeichnet.
In der Zeit des Kalten Krieges wurde das Gleichgewicht zwischen den beiden Supermächten, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, durch die Strategie der Abschreckung, oder der sogenannten wechselseitigen gesicherten Vernichtung (mutual assured destruction – MAD), gewährleistet. Die Atomwaffen stellten aufgrund ihres zerstörerischen Potentials ein Mittel dar, um den Feind von einem Angriff abzuhalten, der eine verheerende Antwort zur Folge gehabt hätte. Die nuklearen Arsenale hatten als einzigen Zweck, „die Atomwaffen zunichtezumachen“ (Herman Kahn, Philosophie des Atomkriegs, dt. Ausg., Il Borghese, Mailand 1966, S. 138).
In der postmodernen Epoche nach dem Zusammenbruch der Berliner Mauer gibt es jedoch keine allgemein anerkannten internationalen Regeln mehr. Der Einsatz nuklearer Waffen wird heute, beispielsweise von Wladimir Putin, als Mittel in Betracht gezogen, das militärische Ungleichgewicht im Bereich konventioneller Waffen auszugleichen – oder, wie im Falle Irans, als strategisches Ziel zur Vernichtung des Staates Israel. Eine der Regeln der Abschreckung bestand einst darin, den Namen der Bombe nicht leichtfertig auszusprechen. Die derzeit zu beobachtende verbale Eskalation könnte rascher zu einem tatsächlichen Krieg führen, als man es sich vorstellen kann.
Die grundlegende Frage, die sich nun stellt, lautet: Wäre eine nukleare Antwort auf einen nuklearen Angriff sittlich erlaubt, oder ist ein Atomkrieg an sich und in seinem Wesen unmoralisch, wie es Papst Franziskus vertritt, der am 24. November 2019 in Hiroshima erklärte: „Der Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken ist unmoralisch, ebenso wie der Besitz von Atomwaffen.“ Ist dies die Lehre der Kirche?
Um dieses komplexe moralische Problem zu lösen, muß daran erinnert werden, daß die Kirche über ein Jahrtausend hinweg die Rechtmäßigkeit eines Krieges aus gerechtem Anlaß gelehrt hat. Diese Lehre wurde nach Augustinus und Thomas von Aquin in ihren verschiedenen Aspekten von den großen Theologen der spanischen Zweiten Scholastik entwickelt, wie dem Dominikaner Francisco de Vitoria (1492–1546) und dem Jesuiten Francisco Suárez (1548–1617), und im 20. Jahrhundert von bedeutenden katholischen Moraltheologen und Soziologen wie Pater Antonio Messineo (1897–1978) und Don Johannes Messner (1891–1984) dargelegt.
Die Neuzeit hat jedoch die Entstehung und Entwicklung von Waffen wie der nuklearen, chemischen und bakteriologischen Kriegsführung (ABC-Waffen) hervorgebracht, die sich nicht nur in ihrer Sprengkraft, sondern auch in ihrem Wesen von konventionellen Waffen unterscheiden. Sie sind Mittel unterschiedsloser Zerstörung, die Unschuldige oder auch Kombattanten in einem Maße schädigen, das in keinem Verhältnis zu den militärischen Zielen steht.
Papst Pius XII. befaßte sich mit dieser Frage in mehreren Ansprachen, vor allem jedoch in seiner Rede am 30. September 1954 vor dem VII. Weltkongreß katholischer Ärzte, in der er fragt:
„Ist der moderne ‚totale Krieg‘, insbesondere der ABC-Krieg, vom Prinzip her erlaubt? Es kann kein Zweifel daran bestehen, vor allem angesichts der Schrecken und des ungeheuren Leidens, das der moderne Krieg verursacht, daß seine Entfesselung ohne gerechten Grund (das heißt, wenn er nicht durch eine offensichtliche, schwerwiegende und in keiner Weise vermeidbare Ungerechtigkeit aufgezwungen wird) ein Verbrechen darstellt, das strengste nationale und internationale Sanktionen verdient. Ebenso darf die Frage nach der sittlichen Zulässigkeit des Atom‑, Chemie- oder Bakterienkriegs nur unter der Bedingung gestellt werden, daß seine Anwendung als absolut notwendig zur Verteidigung angesehen wird. Aber auch dann muß mit allen Mitteln versucht werden, ihn durch internationale Übereinkommen zu vermeiden oder seinen Einsatz auf sehr klare und enge Grenzen zu beschränken, damit seine Wirkungen auf das strikte Notwendige zur Verteidigung beschränkt bleiben. Wenn jedoch der Einsatz dieses Mittels eine solche Ausweitung des Übels nach sich zieht, daß es vollständig der menschlichen Kontrolle entgleitet, muß sein Gebrauch als unmoralisch verworfen werden. In einem solchen Fall handelt es sich nicht mehr um Verteidigung gegen Unrecht oder um den notwendigen Schutz rechtmäßigen Besitzes, sondern um die einfache und schlichte Vernichtung allen menschlichen Lebens im Wirkungsbereich. Dies ist unter keinem Vorwand erlaubt.“ (Discorsi e Radiomessaggi, Bd. XVI, S. 169)
Der Gebrauch von ABC-Waffen, so läßt sich aus den Worten Pius’ XII. schließen, ist nur dann erlaubt, wenn dieser durch eine äußerst schwere, in keiner Weise vermeidbare Ungerechtigkeit erzwungen wird, und wenn es möglich ist, die Auswirkungen zu kontrollieren.
Abbé Don Bernard de Lacoste Lareymondie, Direktor des Seminars von Écône der Priesterbruderschaft St. Pius X., hat in einem Artikel aus dem Jahre 2019 auf La Porte Latine die katholische Position zusammengefaßt:
„Nach dem fünften Gebot Gottes ist es niemals erlaubt, einen Unschuldigen unmittelbar zu töten. Das ist in sich böse und eine Todsünde gegen die Gerechtigkeit. Deshalb ist es auch im Rahmen eines gerechten Krieges schwerwiegend unmoralisch, eine große Zahl von Zivilisten zu töten, um den Feind zur Kapitulation zu zwingen. Wenn jedoch ein Unschuldiger indirekt getötet wird, ist die Frage subtiler. Dies ist unter folgenden Bedingungen erlaubt:
- Der Tod des Unschuldigen ist nicht gewollt, sondern nur vorhergesehen, erlaubt und geduldet (Thomas von Aquin, Summa Theologica, II–II, 64, 6);
- Der Tod des Unschuldigen bewirkt nicht das angestrebte Gute (Röm 3,8);
- Es liegt ein proportionaler Grund vor (Summa Theologica, II–II, 64, 7).“
„Letztere Bedingung – so Abbé Lareymondie – dürfte im Falle der Atombombe meist nicht erfüllt sein. Wenn ich etwa eine wichtige feindliche Militärbasis bombardiere und dabei zwei oder drei Zivilisten unabsichtlich töte, liegt eine proportionale Ursache vor. Wenn ich jedoch, um fünf feindliche Soldaten zu töten, das Risiko eingehe, hunderte Zivilisten zu töten, ist das nicht mehr verhältnismäßig. Die Atombombe ist extrem zerstörerisch. Ihr Einsatz ist nur dann sittlich erlaubt, wenn die Schäden unter den Zivilisten sehr begrenzt bleiben. Daher ist es sehr schwer, die Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 zu rechtfertigen.“
„Heißt das also, die Atombombe sei an sich unmoralisch? Gewiß nicht. Die Moralität einer Waffe ergibt sich nicht aus ihrer Natur, sondern aus dem Gebrauch, den die Menschen von ihr machen. (…) Die Schwierigkeit liegt in den zerstörerischen Wirkungen der Bombe: Sie sind schrecklich und schwer zu kontrollieren. Doch es ist nicht unmöglich, sich eine Situation vorzustellen, in der die Zahl unschuldiger Opfer sehr gering wäre – etwa wenn das militärische Ziel in einer isolierten Wüste oder auf einer kaum bewohnten Insel im Pazifik liegt. Dann könnte der Einsatz einer Atombombe sittlich erlaubt sein – vorausgesetzt, ihre Sprengkraft ist möglichst angemessen zur Größe des Ziels. Eine solche Bombe könnte auch auf einen feindlichen Flottenverband auf hoher See abgeworfen werden.“
„Man muß jedoch anerkennen, daß solche Situationen äußerst selten sind, und deshalb ist der Einsatz der Atombombe meistens nicht gerechtfertigt, wegen des Mißverhältnisses zwischen dem Tod zahlloser Unschuldiger und dem erhofften militärischen Ergebnis.“
Die Schlußfolgerungen, die sich klar von der Position Papst Franziskus’ unterscheiden, lauten:
„Die militärische Nutzung der Kernenergie ist nicht an sich unmoralisch. Es ist jedoch wahr, daß die Bedingungen, unter denen ihr Einsatz gerecht wäre, so eng gefaßt sind, daß der Einsatz der Atombombe in der Praxis nur äußerst selten sittlich erlaubt sein dürfte. Doch diese Schlußfolgerung reicht aus, um den Besitz von Atomwaffen als erlaubt anzusehen.“
Zusammenfassend läßt sich sagen: Damit ein Krieg gerecht sei, ist es notwendig, daß nicht nur das Ziel, sondern auch die Mittel, mit denen er geführt wird, gut und gerecht sind. In einem Atomkrieg kann das Ziel gerecht sein – zum Beispiel im Falle einer erlittenen Aggression –, doch es ist schwer vorstellbar, daß das eingesetzte Mittel gerecht sein könnte, wenn es den Tod von zehntausenden unschuldigen Zivilisten zur direkten Folge hat.
Die traditionelle Moral läßt nicht das machiavellistische Prinzip zu, wonach der Zweck die Mittel heilige. Kein Übel, das in guter Absicht begangen wird, kann entschuldigt werden:
„Wie einige sagen: Laßt uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ihre Verdammung ist gerecht“ (Röm. 3, 8).
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana