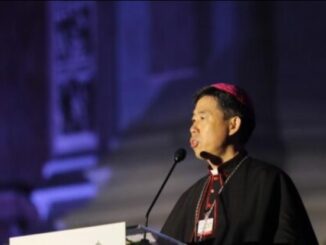Das Thema sprengt etwas den Rahmen von Katholisches.info, soll jedoch wegen seiner Bedeutung zur Einordnung und dem besseren Verständnis aktueller Ereignisse beitragen. Hier die Meinung von Andreas Becker, der den Lesern noch bekannt sein dürfte. Wir freuen uns, daß er nach einer längeren Pause wieder zu uns gestoßen ist:
Die „strategische Autonomie Europas“ in der NATO
Von Andreas Becker
In der EU – nicht in Europa – herrscht Wahlkampf. Am Sonntag wird in den 27 Mitgliedsstaaten das neue EU-Parlament gewählt. Da hört man allerlei seltsame Dinge, denn was tun Politiker nicht alles, um gewählt zu werden, und erst recht die Mächtigen, um an der Macht zu bleiben. Aus deren Reihen ist gerade verstärkt von einer „strategischen Autonomie Europas in der NATO“ die Rede. Macron sagt es, von der Leyen sagt es, und wo diese Richtung nicht regiert, wie in Italien, sagen es deren Oppositionsführer, unter anderem Elly Schlein, die überforderte Vorsitzende der italienischen Linksdemokraten (PD). Schlein träumt gerade in Anlehnung an den Wahlsieg der globalistisch vernetzten Linksnationalistin Claudia Sheinbaum in Mexiko – nach dem Motto: links, woke und (nicht praktizierend) jüdisch – von ihrem eigenen Aufstieg zu den Schalthebeln der Macht. Doch Unsinn bleibt dennoch Unsinn.
Rollen wir die Frage nach der NATO und der europäischen Sicherheitskonstellation aus der Perspektive von Elly Schlein auf, da diese nördlich der Alpen weniger bekannt ist als ihre Genossen Macron und von der Leyen. In ihrer „treffsicheren“ Ausdrucksweise hat die linke italienische Oppositionsführerin übrigens eine verblüffende Übereinstimmung mit Annalena Baerbock von den Grünen. Aussagen wie „Wir lieben heißes Eis am Stiel“, oder „Ich möchte der beste Torhüter der A‑Liga werden und auch der beste Torschütze“, oder „Er hatte ein ruhiges Leben voller Probleme“, haben schon fast, wenn auch wenig schmeichelhaften Kultstatus. Keine dieser widersprüchlichen und unsinnigen Phrasen übertrifft jedoch die jüngste Erklärung aus der Premiumklasse für hochmütigen Schwachsinn: „Wir wollen die strategische Autonomie der Europäischen Union in der NATO“.
In einem Wahlkampf, und noch dazu in der Opposition zur aktuellen Regierung der treuen Atlantikerin Giorgia Meloni, scheint es in unserer parlamentarisch-repräsentativen Parteienherrschaft normal geworden, Demagogie zu betreiben und unmögliche Dinge zu fordern, wie etwa die Erhöhung der öffentlichen Gesundheitsausgaben per Gesetz auf 7,5 Prozent des BIP. Das entspricht dem Ausgabenniveau in den Staaten des deutschen Sprachraums, wo es unter dem Corona-Vorwand hinaufgeschraubt, aber wenig nachhaltig eingesetzt wurde. Der Großteil der Mehrausgaben floß in sinnlose Ad-hoc-Maßnahmen ohne nachhaltige Wirkung. Einige haben damit allerdings ein Bombengeschäft gemacht, nicht aber die Allgemeinheit. Woher aber die Milliarden für die Erhöhung in Italien kommen sollen, schert Schlein offenbar nicht. Schlein redet, darauf angesprochen, von „mehr Ressourcen“, die durch ein „Wirtschaftswachstum“ zur Verfügung stünden, doch niemand weiß, wo dieses Wachstum gerade steckt und ob und wann es eintreten wird. Also bleibt nur der Rückgriff auf das ewig gleiche Mittel, die „Bekämpfung der Steuerhinterziehung“, was konkret eine immer strengere und repressivere Überwachung des Zahlungsverkehrs und der Geldmittel jener bedeutet, die ihre Steuern ohnehin bezahlen, und die Anzapfung der EU, sprich eine EU-interne Umverteilung, das Lieblingsinstrument linker Weltverbesserung. Damit wirklichkeitsfremde Politiker wie Elly Schlein immer genug Geld für zweifelhafte Projekte verteilen können.
Der Zweck der NATO
Die strategische Autonomie der EU in der NATO ist so ein unrealistisches „Projekt“. Ein Militärbündnis zwischen Staaten beruht auf einer strategischen Option. Bleiben wir beim Beispiel Italien, das sich auch für den deutschen Sprachraum gut eignet, da man sich meist in denselben Bündnissen wiederfand. Die Schweiz hielt sich klugerweise bisher davon fern, wenngleich die derzeitige Staatsführung gefährlich versucht scheint, in das „westliche Lager“ zu wechseln. Noch gibt es jedoch Gegenkräfte: So verhinderte der Ständerat, die zweite Kammer des eidgenössischen Parlaments, soeben eine wenig neutrale Milliardenhilfe für die Ukraine. In Österreich hindern nur noch formale Barrieren vor der Aufgabe der Neutralität. Dabei stehen die politischen Entscheidungsträger in beiden Fällen, sowohl in Österreich wie in der Schweiz, gegen den erklärten Mehrheitswillen des Volkes. Doch wen scheint es zu kümmern. Das politische System wirkt abfedernd und schützt die Systemparteien vor zu massiven Reaktionen, sprich, tatsächlichen Richtungswechseln.
Werfen wir einen Blick auf die Bündnisgeschichte der vergangenen 150 Jahre:
- Die Verträge des Dreibundes zwischen dem Deutschen Reich, dem Königreich Italien und der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn (1882 unterzeichnet und alle fünf Jahre erneuert, zuletzt 1912) zielten darauf ab, Frankreich einzuhegen, um es wegen des Verlusts der von Deutschen bewohnten linksrheinischen Länder Elsaß und Deutsch-Lothringen (Metz war allerdings französisch) von einem Rachefeldzug abzuhalten. Italien wechselte dann allerdings 1915 die Seiten, da die Westalliierten England und Frankreich im Ersten Weltkrieg größere Beute versprachen.
- Der Dreimächtepakt zwischen dem nationalsozialistischen Deutschen Reich, dem faschistischen Italien und dem kaiserlichen Japan vom September 1940 strebte nicht, wie oft behauptet, die „Weltherrschaft“ an, sondern war ein Produkt des bereits ausgebrochenen Weltkrieges, um die jeweiligen Einflußsphären der drei Mächte in Europa und in Fernost festzulegen. Die drei Mächte unterlagen im Krieg und die Siegermächte taten ihrerseits das, was sie selbst nicht mehr tun konnten, indem sie Einflußsphären festlegten und Europa und Teile Asiens unter sich aufteilten.
- Schließlich die NATO: Sie wurde 1949 von den USA gegründet, um die sowjetische Bedrohung in der US-Einflußsphäre Westeuropa einzudämmen.
Dabei waren es die USA, die der Sowjetunion gegen Hitler das Überleben gesichert hatten. Die Sowjetunion stellte im Gegenzug Millionen von Soldaten, die auch für die Interessen der USA an der Front kämpften. Das nennt sich Stellvertreterkrieg, worin es die USA zur Meisterschaft gebracht haben. Dahinter stand die Zielsetzung Washingtons, sowohl den Nationalsozialismus als auch den Kommunismus bekämpfen zu wollen, aber nur nacheinander handeln zu können, um die eigenen Kräfte nicht zu überfordern. Die Frage war also, mit welchem Gegner man sich zuerst verbündet, um mit dessen Hilfe den anderen Gegner zu besiegen, um dann im nächsten Schritt den bisher verbündeten Gegner zu erledigen. Diese wenig moralische, aber strategische Denkweise war auf allen drei damals beteiligten Seiten vorhanden, auch in Moskau und in Berlin.
Trotz der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Pakts im Jahr 1991 besteht die NATO heute als politisch-militärisches Bündnis fort, das darauf abzielt, den Einflußbereich Rußlands in Europa abzubauen und mögliche Gegenmaßnahmen zu kontern. Die erste Phase fand zwischen 1994 (Beschluß zur NATO-Osterweiterung um mittel-osteuropäische Länder, die zuvor dem Warschauer Pakt angehört hatten) und 2020 (Beitritt Nordmazedoniens) statt, die zweite seit 2014 (Beginn der russischen Militäroperationen im Donbaß und Besetzung der Krim) und heute (russischer Einmarsch in der Ukraine). Die Frage, inwiefern und wie weit die NATO an der Eskalation, die zur zweiten Phase führte, beteiligt war, soll an dieser Stelle ausgeklammert werden. Auch das höchst ungeschickte Verhalten, mit dem in der Ukraine das westliche Abschreckungspotential verspielt wird und schließlich auch die von einigen übereifrigen NATO-Kreisen betriebene und wenig verantwortungsvolle Kriegstreiberei.
Papst Franziskus sprach vom „zu lauten Bellen“ der NATO vor der russischen Haustür.
Es darf Putin geglaubt werden, wenn er gegenüber Tucker Carlson davon sprach, in der Frühphase seiner Präsidentschaft gegenüber zwei US-Präsidenten Rußlands Interesse an einer NATO-Mitgliedschaft bekundet zu haben. Die Gründe, warum Washington einen so epochalen Schritt ablehnte, liegen auf der Hand: Die US-Hegemonie über die NATO wäre mit einem Mitglied Rußland und der damit verbundenen Stärkung Europas nur mehr schwer aufrechtzuerhalten gewesen. Wer gibt schon gern ein Machtinstrument aus der Hand. Die Folgen für die US-Wirtschaft und den Dollar als Weltleitwährung wären nicht absehbar.
Wesentlich an der NATO seit ihrer Gründung ist, daß die beteiligten Staaten zumindest formell (letzteres gilt derzeit für Ungarn und die Slowakei) die strategischen Ziele (der USA) und deren Vorrang vor anderen teilen.
Der Mehrheitsaktionär der NATO
Die USA sind der Gründer und der unumstrittene Mehrheitseigner der NATO. Würde einer der 31 weiteren NATO-Mitgliedsstaaten seine „strategische Autonomie“ beanspruchen, d. h. die Freiheit, seine eigenen strategischen Prioritäten gegen US-Interessen zu definieren, würde er damit ein Spannungsverhältnis zur NATO als Ganzes schaffen. Dies gilt erst recht, wenn die EU dies tun würde. Davon haben manche überzeugte Europäer wie Otto von Habsburg geträumt, indem sie eine bevorzugte Partnerschaft mit den USA beibehalten, aber die EU zu einem eigenständigen Akteur neben den USA machen wollten, auch militärisch. Nichts dergleichen ließ sich verwirklichen, und das hat mit dem Mehrheitseigner zu tun, der dies bisher zu verhindern wußte.
Die USA sind nicht nur die Paten, sondern mit 68 Prozent aller Militärausgaben des Bündnisses auch der Hauptzahler. Sie sind also Hauptanteilseigner und Hauptentscheidungsträger der strategischen Entscheidungen der NATO. Die Mitgliedschaft der anderen Staaten war, wie bei allen Bündnissen dieser Art, nur bedingt eine freie Entscheidung. Von den einstigen westlichen Verbündeten in Europa wurde sie als sicherheitspolitische Notwendigkeit erkannt, während die besiegten Staaten, Deutschland und Italien, keine wirkliche Wahlmöglichkeit hatten.
Die strategische Ausrichtung der NATO entspricht also seit 1949 ganz offensichtlich den Interessen der USA.
Die USA können übrigens ein Ungarn oder eine Slowakei tolerieren, die von der US-Linie abweichen, zwei relativ kleine Staaten, um ihr Territorium nicht zu verlieren und vor allem, um zu verhindern, daß sie vielleicht „die Seite wechseln“. Sie werden aber kein Italien und erst recht keine Bundesrepublik Deutschland tolerieren, die von der offiziellen strategischen Linie abweichen. Beide Länder wurden von den USA besiegt und militärisch besetzt. In der allgemein gebräuchlichen freundlicheren Fassung heißt es, diese Länder wurden von den USA „befreit“, um darin Regierungen zu installieren, die es genau so sehen, bei denen also eine gleiche Sichtweise herrscht (den Vorrang der USA nicht in Frage zu stellen). Und es gab gute Gründe für die genannten Länder, dies nach dem Krieg so zu sehen und danach zu handeln.
Völlig ausgeklammert bleiben bei diesem Hollywood-Blick auf die Geschichte die immer als wesentlich wichtiger (als die ideologischen Gegensätze) erachteten Wirtschaftsinteressen, die das Deutsche Reich durch seinen Ausstieg aus dem Welthandelssystem zu einem Alternativmodell für andere Staaten machte und damit nicht nur zum ökonomischen Konkurrenten, sondern indirekt auch zu einer Bedrohung der US-Interessen in Lateinamerika, das von den USA seit dem 19. Jahrhundert als „Hauskolonie“ betrachtet wird. Und wo man damals, da devisenschwach, einen Ausweg aus der erdrückenden Umklammerung durch den „Großen Bruder“ suchte. Dieses Konfliktpotential, für das die USA bereit waren, Krieg zu führen, bestand, und das ist wesentlich, unabhängig vom Nationalsozialismus auch dann, wenn dieser Weg von einer anderen Reichsregierung gegangen worden wäre.
In diesem Kontext ist auch die völlig künstliche, aber vielschichtige Krah-Affäre zu sehen, obwohl sie mit dem traditionalistischen Katholiken Krah und seiner gegenüber einer italienischen Zeitung getätigten Äußerung herzlich wenig zu tun hat. Es geht darum, die Bundesrepublik Deutschland eingehegt zu halten und die AfD in das transatlantische Boot zu zwingen oder sie weiter auszugrenzen (und bei Wahlen möglichst niederzuhalten).
Entscheidend für das heutige Verständnis ist jedoch, daß die USA ein Ausscheren der EU als solcher schon gar nicht dulden würden. Im Klartext: Es ist undenkbar, daß die USA eine EU tolerieren werden, die in einer für die US-Führung wichtigen außenpolitischen Frage (Ukraine, Israel, China) die NATO-Linie im Namen einer eigenen „strategischen Autonomie“ verlassen würde.
Die Präzedenzfälle Macron, Michel, Von der Leyen
Es war nicht Schlein, die den Begriff von der „strategischen Autonomie Europas“ (gemeint ist natürlich die EU) ins Spiel brachte: Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen und Charles Michel haben ihn in den vergangenen Jahren schon in den Mund genommen. Jeder von ihnen aus seinem Blickwinkel: Michel ist Belgier, und kleine Länder wie Belgien sehen die EU als Multiplikator ihrer Bedeutung auf der internationalen Bühne, sodaß jeder Slogan, der nach einer Betonung des EU-Projekts klingt, egal wie realitätsfremd er ist, es verdient, gefördert zu werden. Von der Leyens BRD hat unter der Kanzlerschaft von Schröder, aber auch Merkel einige Jahre versucht, die Option einer europäischen strategischen Autonomie als Schutzschild zu benutzen, um besondere Beziehungen zu Rußland (billige Energiequellen) und zur Volksrepublik China (billige Waren und Finanzströme) zu schützen. Seit die US-Wirtschaft schwächelt, wird dem konsequent ein Ende gesetzt. Der Leichtfuß Macron verwendet den Begriff nicht nur auffallend locker, sondern auch ungeduldig. Er hat mit erheblichen innenpolitischen Problemen zu kämpfen und benützt das außenpolitische Parkett, um davon abzulenken. Vor allem aber steht hinter ihm die französische Rüstungsindustrie, die in einer „strategischen Autonomie Europas“ den Türöffner sieht, um in der EU eine hegemoniale Stellung zu erringen. Der Kommentar der Financial Times nach Macrons Rede an der Sorbonne am 25. April bringt es zum Ausdruck:
„Insgesamt hat Macron den Eindruck nicht zerstreut, daß seine Initiativen in erster Linie darauf abzielen, die militärisch-industriellen Interessen Frankreichs zu stärken und den schwindenden Einfluß einer zerfallenden Mittelmacht zu untermauern.“
Die gegensätzlichen Interessen der europäischen Staaten
Diese Anmerkung läßt ein weiteres wesentliches und unlösbares Problem erkennen: Die „strategische Autonomie“ der EU impliziert, daß es ein starkes gemeinsames strategisches Interesse aller 27 EU-Mitgliedsstaaten gibt. Auch das ist weit von der Realität entfernt. Oft hört man: „In einer Welt der Großen, China, USA, Rußland, können die einzelnen europäischen Länder nicht konkurrieren; sie müssen sich zusammenschließen.“ Dieser Diskurs hat zwar etwas mit neuen Machtambitionen zu tun und auch dem Wunsch nach mehr Eigenständigkeit, aber noch wenig mit einem gemeinsamen strategischen Interesse.
Was es hingegen gibt, sind gegensätzliche Interessen. Man erinnere sich an die Haltung Frankreichs in Libyen und in der Sahelzone, um Italien und die Türkei zu schwächen, die als Rivalen um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum gelten. Paris hat deshalb lange Zeit Haftar und die Kräfte in Bengasi gegen die Regierung in Tripolis unterstützt, die schließlich von allen EU-Ländern und der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt wurde.
In der Sahelzone haben die Franzosen wiederholt eine Beteiligung der EU oder einzelner EU-Mitgliedstaaten an ihren Militäroperationen gefordert. Als Vorwand zur Durchsetzung der französischen Interessen in seinen ehemaligen Kolonien diente der Kampf gegen den Dschihadismus und die Stabilisierung örtlicher Regierungen. Die zu leistende Hilfe sollte jedoch immer nur als Ergänzung der französischen Armee erfolgen, kurzum Hilfstruppen für Frankreichs Interessen, über die Paris mit Argusaugen wachte. Frankreich sieht die Aufrechterhaltung seines Einflusses in der Sahelzone als Bedingung, um seine Stellung als Mittelmacht zu behaupten. Heute, da der russische Einfluß in der Zone immer stärker wird, bejammert Paris seine begangenen Fehler.
Und wenn die NATO scheitern sollte?
Die NATO wird, ob man das in Europa will oder nicht, der strategische Bezugsrahmen für die EU-Länder bleiben, solange die USA die Kraft haben, ihr hegemoniales Spiel auf der Weltbühne zu spielen. Und sollte diese Kraft einmal nicht mehr vorhanden sein (durch massive weltpolitische Veränderungen oder eine nicht mehr auszuschließende Systemkrise in den USA), wird nach heutigem Ermessen an ihre Stelle die strategische Autonomie einzelner europäischer Staaten oder Konstellationen europäischer Staaten (z. B. die Bundesrepublik Deutschland und ökonomisch und mentalitätsmäßig nahestehende Länder) treten, aber sicherlich nicht das Phantom einer „strategischen Autonomie Europas“, sprich, der heutigen EU.
Vielleicht deshalb leisten es sich Parteien wie Italiens Linksdemokraten, um noch einmal auf das Ausgangsbeispiel zurückzukommen, für die EU-Wahlen sowohl NATO-Befürworter (Mercedes Bresso und Elisabetta Gualmini) als auch NATO-Gegner (Cecilia Strada und Marco Tarquinio) und dazu noch eine Parteivorsitzende Elly Schlein aufzustellen, die sich dazwischen mit ihrer Parole nach einer „strategischen Autonomie Europas in der NATO“ wie Alice im Wunderland verhält.
*Andreas Becker, politischer Analyst, studierte Politikwissenschaften und Vergleichendes Verfassungsrecht.
Bild: Wikicommons