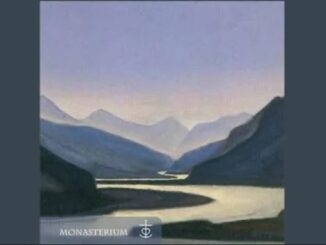(Rom/Mexiko-Stadt) In viereinhalb Monaten wird im Vatikan die von Papst Franziskus einberufene Amazonassynode beginnen. Ihre tiefere Agenda ist die Aufhebung des priesterlichen Zölibats und die Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum. Deshalb erstaunt die Zurückhaltung in der Frage von Bischof Felipe Arizmendi, der an „vorderster Front“ gegen „ein anderes Priestertum“ stand. Dabei hatte Papst Franziskus Arizmendis Bistum San Cristobal de las Casas frühzeitig als Bezugspunkt in Sachen Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum genannt.
Blickt man zurück, kann die Audienz des österreichischen Missionsbischofs Erwin Kräutler Anfang April 2014 als Ausgangspunkt der Amazonassynode ausgemacht werden. Von einer solchen war damals zwar noch keine Rede, aber ihre Agenda wurde bereits abgesteckt, auf höchster Ebene. Als Kräutler wenige Tage später gegenüber den Salzburger Nachrichten die Audienz rekapitulierte, erwähnte er auch „ein mexikanisches Bistum“, das Papst Franziskus als Bezugspunkt in Sachen Zulassung verheirateter Männer zum Weihesakrament genannt habe.
Ein bestimmtes Bistum
Im Februar 2016 besuchte Papst Franziskus Mexiko, ein Land, das 96 Diözesen zählt. Franziskus wollte aber ein bestimmtes Bistum aufsuchen, San Cristobal de las Casas, über das er bereits mit Kräutler gesprochen hatte.
Die Diözese umfaßt den Chiapas, den Staat mit dem höchsten Indio-Anteil in Mexiko. Die Gegend war viele Jahre unruhig und in den 90er Jahren das Zentrum bewaffneter Kämpfe einer maoistischen Guerillaorganisation. Das Bistum Chiapas gehört zu den ältesten Amerikas. Es wurde bereits 1539 errichtet. In ihm setzte der 2000 verstorbene Bischof Samuel Ruiz Garcia das sogenannte Chiapas-Experiment um.
Ruiz Garcia stand der marxistischen Befreiungstheologie nahe, weshalb er beste Kontakte zur marxistischen Zapatisten-Guerilla unterhielt. Offiziell trat er als Vermittler auf und wurde dafür international ausgezeichnet.
In seinem Bistum setzte er eine besondere Variante der Befreiungstheologie um, die Teologia india die sogenannte „Indio-Theologie“. In ihr finden sich viele Elemente, die auch anderen lateinamerikanischen Links-Strömungen weltlicher oder kirchlicher Richtung eigen sind und in den einzelnen Varianten in unterschiedlicher Intensität auftreten: Marxismus, Antiamerikanismus und Antiimperialismus. Daraus folgen irrationale, anti-identitäre Ressentiments, die sich gegen die eigene Geschichte und Kultur der vergangenen 500 Jahre richten. Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und die Hispanisierung sei imperialistisch und ausbeuterisch gewesen. Daraus resultiert in einem Teil dieser Strömung auch eine Ablehnung der Christianisierung. Als Ersatz wird eine mythische, indigene Kultur und teilweise auch eine Rückkehr zu heidnischen Religionen propagiert. Diese Richtung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der sowjethörigen Linken gefördert, um die sozialistische Revolutionsbewegung über eine lateinamerikanische Variante der Entkolonialisierung auszubreiten und den Einfluß der USA und des Westens insgesamt zurückzudrängen. Die Auswirkungen auf bestimmte christliche Kreise, die von einer Allianz zwischen Sozialismus und Christentum träumten, blieben nicht aus.
Die Befreiungstheologie schien mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks 1989 endgültig erledigt zu sein. In Wirklichkeit verlagerte sie sich und tritt unter dem derzeitig regierenden Papst wieder verstärkt an die Öffentlichkeit.
Von der Befreiungstheologie zur Indio-Theologie
Das Scheitern der Sowjetunion machte eine Neuorientierung notwendig. Sie wurde im Zuge der 500-Jahrfeiern der Entdeckung Amerikas 1992 gefunden und konstituierte sich als erkennbare Denkrichtung in der „Indio-Theologie“. An dieser Stelle soll nur mehr indirekt darauf eingegangen werden, denn der Blick gilt dem Bistum San Cristobal de las Casas und der Amazonassynode. Der Brückenschlag findet sich in der vorsynodalen Betonung der indigenen Bevölkerung Amazoniens, womit die verstreut lebenden Ureinwohner gemeint sind, die selbst nach optimistischen Schätzungen nur 250.000–300.000 Personen umfassen.
Im Bistum San Cristobal de las Casas amtierte ab 1959 Bischof Samuel Ruiz Garcia. Er versuchte seit den 80er Jahren in seinem Bistum schleichend und unbeachtet den Priesterzölibat abzuschaffen. Statt zölibatärer Priester weihte er nur mehr verheiratete Diakone. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte zwar nicht den priesterlichen Zölibat aufgehoben, wie es eine bestimmte Gruppe anstrebte, aber mit den sogenannten „viri probati“ verheiratete Diakone zugelassen. Ein „Kompromiß“, mit dem die Zölibatsgegner zwar nicht ihr eigentliches Ziel erreichten, aber den Fuß in der Tür hatten.
Am Ende der Amtszeit von Ruiz Garcia war der Priesterstand in seiner Diözese heillos überaltert. Die Gewichtsverlagerung war eindeutig: Auf jeden Priester kamen sechs verheiratete Diakone. Zieht man die Ordenspriester ab, gab es im Jahr 2000 in dem südmexikanischen Bistum nur mehr 24 Diözesanpriester, aber 336 verheiratete Diakone. Jedem der meist betagten Diözesanpriester standen 14 verheiratete Diakone gegenüber. Ruiz Garcia sprach von „indigenen Diakonen“ und begründete deren Einführung mit besonderen kulturellen Notwendigkeiten: Der indigenen Bevölkerung sei das zölibatäre Priestertum nämlich nicht zu vermitteln. Gemeint war aber ein marxistischer Kulturkampf: die Förderung des „Indigenismus“ gegen den „europäischen Kulturimperialismus“. Die Ausbildung dieser ständigen Diakone erfolgte über ein Schmalspurprogramm außerhalb der bestehenden Bildungseinrichtungen. Zudem nahm Ruiz Garcia mit der Weihe der verheirateten Männer auch eine Segnung ihrer Frauen vor. Es blieb unklar, inwieweit Ruiz Garcia eine Einbindung der Frauen in das Weiheamt versuchte. Der Weiheakt vermittelte jedenfalls einen solchen Eindruck.
Zugleich begann Bischof Ruiz Garcia eine anschwellende Klage über einen drückenden Priestermangel in seinem Bistum. Daß er ihn maßgeblich selbst verursacht hatte, sagte er nicht. Parallel begann er Vorbereitungen zu treffen, wegen des herrschenden „Notstandes“ verheiratete Diakone zu Priestern zu weihen.
Roms Eingreifen
Dazu kam es nicht mehr, weil die Sache nicht unbeobachtet blieb, und Rom spät aber doch einschritt. Nachdem Ruiz Garcia ein Koadjutor zur Seite gestellt worden war (der ein Kapitel für sich ist), wurde 2000 mit Msgr. Felipe Arizmendi Esquivel, der aus einem anderen Bistum herbeigerufen wurde, der Bischofsstuhl neu besetzt und die Weihe von ständigen Diakonen untersagt.

Bischof Arizmendi begann wieder mit der Förderung von Priesterberufungen. Die Zahl der ständigen Diakone sank bis 2014 leicht auf 316, während die Zahl der Priester auf 108 verdoppelt werden konnte. Davon waren 67 Diözesanpriester. Anders als von seinem Vorgänger Ruiz Garcia behauptet, war es durchaus möglich, ein einheimisches, indigenes Priestertum aufzubauen. Und noch ein wichtiger Punkt: Das Priesterseminar des Bistums, das unter Ruiz Garcia leer stand, war nun wieder gut belegt.
So wie 2000 ein Wendejahr war, wurde aber auch 2014 zu einem Wendejahr. Nun setzte Papst Franziskus Bischof Arizmendi einen Koadjutor zur Seite und hob das Weiheverbot für verheiratete Diakone wieder auf. Die Zahl der Diözesanpriester wuchs zwar weiter, weil Kandidaten geweiht wurden, die bereits im Priesterseminar studierten, zugleich wurde aber auch die Weihe von ständigen Diakonen wiederaufgenommen. 2017, als Franziskus Bischof Arizmendi emeritierte, standen 125 Priester (davon 78 Diözesanpriester) 450 ständigen Diakonen gegenüber.
Nachdem Papst Franziskus das Bistum San Cristobal de las Casas als Bezugspunkt nannte, war erwartet worden, daß sich Bischof Arizmendi zur Amazonassynode äußern und eine Stimme gegen den Versuch der Zölibatsaufweichung erheben würde (siehe Die „Amazonas-Kirche“ als Neuauflage des gescheiterten „Chiapas-Experimentes“). Der Bischof, der am 1. Mai 79 wurde, hielt sich aber trotz seiner Erfahrung an einem Brennpunkt bedeckt.
„Indio-Theologie auf dem Vormarsch“
Gestern meldete er sich nun doch zu Wort, allerdings auf eine ganz unerwartete Weise, die auch sein bisheriges Schweigen erklärt. Die mexikanische Tageszeitung Diario de Yucatan druckte eine Kolumne von ihm mit der vielsagenden Überschrift:
„Die Indio-Theologie auf dem Vormarsch“
Aus dem ausführlichen Text, den auch der spanische Zenit-Dienst übernahm, soll nur die aussagekräftigste Stelle wiedergegeben werden:
„Jene, die diese Theologie nicht kennen und jene, die ihr mißtrauen oder sie geringschätzen, ersuchen wir um Offenheit, um das geheimnisvolle Wirken des Geistes in den ursprünglichen Kulturen, wie auch in den aktuelle und den kommenden zu unterscheiden.“
Die Befreiungstheologie oder Indio-Theologie, wie sie im Chiapas und anderen Gegenden seit den frühen 90er Jahren genannt wird, die Bischof Arizmendi nach langem Schweigen nun verteidigt und als geistgewirkt darstellt, hat im Chiapas noch andere, bisher nicht erwähnte Folgen provoziert. Der Anteil der Katholiken ist in den vergangenen Jahrzehnten massiv eingebrochen.
Als Garcia Ruiz sein Bistum übernahm, bekannten sich fast 98 Prozent der Bevölkerung zum katholischen Glauben. Als er emeritiert wurde, waren es nur mehr 65 Prozent. Diese Entwicklung entsprach keineswegs der gesamtmexikanischen Entwicklung. Mexiko ist das einzige Land Lateinamerikas, wo die katholische Kirche dem Vordringen evangelikaler Gemeinschaften standhielt. Im Chiapas verlief es anders. Dort wanderte ein Viertel, manche Quellen sprechen sogar von bis zu 40 Prozent der Katholiken zu protestantischen Freikirchen ab, und das nicht, weil die Kirche „zu rückwärtsgewandt“ sei, sondern weil sie zu marxistisch, zu „indigenistisch“ ist und zu wenig auf die religiösen Bedürfnisse der Menschen eingeht.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Rede Cristianas/Vatican.va (Screenshots)