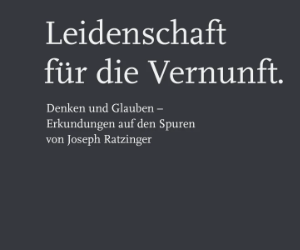Ein Gastkommentar von Hubert Hecker
In seiner Weihnachtsansprache an die Römische Kurie schlägt Papst Franziskus wieder mal auf den konservativen Kirchensektor ein. Das Eindreschen gegen die Theologie in traditioneller Ausrichtung ist seit einiger Zeit in mehreren Papstansprachen festzustellen. In diesem Fall polemisiert er gegen eine „Fixierung“ auf eine unflexible Bibelauslegung.
Zunächst erläutert Franziskus seine Überlegung mit dem abstrakten, für die Bibel unpassenden Begriffspaar Form und Substanz: Es sei „ein Fehler, die Botschaft Jesu auf eine einzige, allzeit gültige Form festlegen zu wollen. Die Form muss sich jedoch immer wieder verändern können, damit die Substanz dieselbe bleibt.“ Heißt das, die Form etwa des Weihnachtsevangeliums, der Bergpredigt oder der Lehre von Christi Erlösungstod müsste ständig verändert werden? Wie soll denn die Substanz der Botschaft Jesu ohne deren Form verstanden werden? Solche pompös-hohlen Parolen der Progressiven nach dem Motto: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu – sind wenig hilfreich für den Auftrag der Kirche, das Evangelium in Wahrheit und Treue zu verkünden. Sie führen letztlich auf den (synodalen) Irrweg, ein anderes Evangelium als Grundlage der Kirche zu fabrizieren.
Im Anschluss an seinen Form-Substanz-Vergleich fährt Franziskus richtig schwere kirchentheologische Geschütze auf gegen die bibel- und glaubenstreuen Theologen und Katholiken:
„Die wahre Häresie besteht nicht nur darin, ein anderes Evangelium zu predigen (vgl. Gal 1,9), wie Paulus sagt, sondern auch darin, es nicht mehr in die jeweils aktuelle Sprache und Kultur zu übersetzen.“ Der Völkerapostel Paulus habe „gerade das getan“. Auch heute bedeute das Bewahren der Botschaft Christi sie „lebendig zu halten und nicht, sie einzusperren“. Demnach wäre nicht das biblische Evangelium das wahre, sondern die aktualisierte, zeitgemäße Fassung.
Die zentrale Anáthema-Behauptung von Franziskus
Wer das Evangelium nicht in die jeweils zeitgenössische Sprache und Kultur übersetze, begehe eine Häresie, wie wenn er ein anderes Evangelium predigen würde.
Aber hat Franziskus‘ Gewährsmann Paulus wirklich das Evangelium in die damalige Weltkultur des Hellenismus übertragen? Hat der Völkerapostel etwa in Athen den christlichen Glauben an den einen Schöpfergott und die Herabkunft des einen gottmenschlichen Erlösers in die griechisch-römische Religionskultur des Polytheismus und der menschlichen Halbgötter übertragen – oder nicht gerade den Gegensatz zur Vielgötterei gepredigt? Hat er die Lehre von der leiblichen Auferstehung Christi und der Christen an die damals herrschende platonische Auffassung angepasst, nach der der Leib des Menschen der Kerker für die Seele wäre? In Wahrheit predigte er gegen alle altgriechische Vernunft die „Torheit“ der Auferstehung des Fleisches. In der Hafenstadt Korinth waren die epikureische Lustphilosophie und die sophistische Praxis des ‚Alles ist erlaubt, wenn es mir Lust und Vorteile bringt‘, weit verbreitet. Hat nun Paulus die christliche Lehre an die heidnische Lebenswirklichkeit angepasst oder hat er die Praxis von Unzucht, Ehebruch, Verleumdung, Diebstahl und Habgier scharf verurteilt (vgl. 1 Kor 6)?
Differential-Enkulturation ist der Weg des Christentums – auch für die heutige Zeit
Statt auf Anpassung musste die frühe Kirche auf Konfrontationskurs gehen gegen heidnisch-antike Unkultur, in der ungeborene Kinder abgetrieben und geborene ausgesetzt wurden, wo Jungen an Knabenliebhaber ausgeliefert und Mädchen zur Prostitution verkauft wurden. Mit seiner klaren Botschaft konnte die Kirche die hellenistische Kultur umformen. Die christliche Lehre von der Gottebenbildlichkeit aller Menschen sowie ihrer Erlösung durch Jesus Christus hat langfristig die hellenistische Kultur der menschlichen Ungleichheit und Sklaverei überwunden. Der frühchristliche Grundsatz lautete eben: Prüfet alle kulturellen Strömungen, verwerft das Unchristlich-Unmoralische, aber behaltet das Gute. Nach letzterer Empfehlung übernahm Paulus die stoischen Grundsätze des Naturrechts (Den Heiden ist das Gesetz ins Herz geschrieben….) und die Kirchenväter formulierten mit Platons Wahrheitslehre christliche Dogmen – gegen den sophistischen Relativismus.
Mit diesen Ausführungen ist jedenfalls klar geworden:
Die pauschale päpstliche These, Paulus habe das (jüdische) Evangelium in die (hellenistische) Kultur der Antike übersetzt, übertragen, ist ebenso falsch wie sein Häresie-Fluch gegen alle, die die christliche Lehre nicht pauschal an die jeweilige zeitgeistige Kultur anpassen wollen. Denn Paulus, die Kirchenväter, die späteren Germanen- und Slavenmissionare und mittelalterlichen Theologen begegneten den jeweiligen (Missions-) Kulturen in selektiver Weise, indem sie dem Evangelium widerstrebende Kulturtendenzen wie etwa die Gewaltbereitschaft der Germanen zurückdrängten, aber die bestehenden Frömmigkeitsformen auf den einen Schöpfergott und Erlöser Jesus Christus lenkten. Das Prinzip der am Evangelium orientierte Differential-Enkulturation gilt auch für die heutige Zeit.
Der Papst hingegen bestärkt mit seiner als kulturelle Pauschal-Anpassung verstandenen Rede jene neuheidnischen Kräfte, die antibiblische Trends der Gegenwart in die Kirche einführen wollen:
- Die Genderfanatiker von Butler bis BDKJ wollen die biblische Lehre von der Schöpfung und bipolaren Zuordnung von Mann und Frau aufheben in die geschlechterfluide Beziehungslosigkeit von polyamoren Sozialkontakten.
- Die libertarische Philosophie der menschlichen Autonomie als totale Selbstgesetzlichkeit verwirft biblische Offenbarung, Orientierung an der Hl. Schrift, kirchliche Gebote, Lehre und Lehramt. Eine Anpassung an dieses postmoderne Denksystem hieße die suizidale Selbstauflösung der bibelfundierten Kirche zu propagieren und zu praktizieren.
- Kann und darf die Kirche das Evangelium des Lebens „übersetzen“ in die zeitgeistige Strömung der absoluten Selbstbestimmung, die eine antichristliche Kultur des Todes mit vermeintlichen Rechten auf Abtreibung, Euthanasie und Suizidbeihilfe fordert und fördert?
Die drei genannten Zeitgeistströmungen stehen im Hintergrund des Synodalen Wegs, sind in dessen Orientierungstext angelegt und werden insbesondere von ZdK-Delegierten aggressiv als alternativlose Reformagenda propagiert.
Die verbreitete Allerlösungslehre verfälscht die biblische Lehre
Gleichzeitig werden die glaubenstreuen Bischöfe, Priester und Laien in Häresie-Nähe gerückt, wenn sie darauf bestehen, die biblisch-kirchliche Lehre unverkürzt und unverbogen gegen neuheidnische Trends zu verteidigen. Papst Franziskus selbst beteiligt sich an der schon tief in die Kirche eingedrungenen Aushöhlung und Verkürzung der biblischen Aussagen, indem er etwa die Allerlösungslehre propagiert. Durch die Stimme seines Interviewpartners Scalfari ließ er verlauten, dass jeder Mensch unabhängig von seinen Taten von Gott aufgenommen werde, falls er nur seinem Gewissen folge. Doch wenn subjektive Gewissheiten der Maßstab von Erlösung wären, würden biblische Weisungen und Lehren überflüssig sein.
In der Bibel dagegen heißt es durchgehend, dass die Menschen nach ihren Taten gerichtet werden. Im Neuen Testament kommt an zwei Dutzend Stellen die Rede auf Lohn und Strafe, Ausschluss, Zurückweisung bis hin zum Abscheiden in die gottferne Finsternis. Die biblische Lehre von Gottes Liebe, Langmut und Barmherzigkeit würde zu einer lieblosen Unverbindlichkeit verkommen, wenn menschliche Bosheit als Ablehnung von Gott und seinen Weisungen letztendlich keine Folgen hätte. Doch die Schrifthinweise von Gottes Gericht und Gerechtigkeit sind vielfach verpönt und werden von progressiven Kirchenleuten – auch von Franziskus – als „Rigidität“ abgekanzelt. Denn sie stören das vorherrschende Theologenkonstrukt vom allgütigen Allerlösergott. Oder man überblendet die biblische Verdammung des Verräters Judas z. B. mit einer fabulierenden Kunst-Geschichte.
Von der Verkürzung der biblischen Lehrgeschichten …
Im Religionsunterricht der Korrelationsdidaktik werden die Bibeltexte von Gericht und Ausschluss prinzipiell nicht behandelt. Im Gottesdienst sind einige in der Lesejahr-Ordnung vorgesehen, werden aber gewöhnlich in der Predigt als unpassende oder peinliche Zumutung übergangen oder verdreht. Die Perikopenbücher bieten den Zelebranten als Alternative die Kurzform der Texte an, bei der die störenden Passagen einfach weggelassen werden. Bei der Lesung zur Einsetzung der Eucharistie in 1 Kor 11 fällt der letzte Satz vom unwürdigen Empfang als Gericht unter den Tisch. Die Kurzform vom Evangelium zum königlichen Hochzeitsmahl Math 11 endet mit der Zwischenpassage: ‚Die Knechte holten (ungeladene) Hochzeitsgäste von der Straße, Gute und Böse. Saal und Tische wurden voll.‘ Das passt zur Allerlösungslehre. Unterschlagen wird der original biblische Perikopenschluss: ‚Der König sprach zu einem Gast: Freund, warum bist du hergekommen ohne hochzeitliches Gewand? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt.‘
Bei anderen biblischen Geschichten kann man den unpassenden Schluss einfach nicht umgehen – wie bei dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen am dritten Adventssonntag: Für die verspäteten Lampenträgerinnen bleibt der Hochzeitssaal verschlossen. Der Bräutigam weist sie ab: „Ich kenne euch nicht!“
Die traditionelle Auslegungstheologie sieht in dem ausreichenden Vorrat von Lampenöl bei den klugen Frauen die stetige Ansammlung von geistlichem Rüstzeug und auch guten Taten in lebenszeitlicher Perspektive, während die törichten Frauen glauben, sich mit Lauheit durchs christliche Leben zu lavieren. Die Botschaft des Evangeliums lautet, dass beide Lebenshaltungen am Schluss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen.
… zum Konstrukt eines anderen Evangeliums
Die Zentralredaktion der Kirchenzeitungen in der Verlagsgruppe Bistumspresse für acht deutsche Diözesen, auch für Bischof Bätzings Bistum Limburg, macht in der Ausgabe zum 11. 12. 2022 keine Anstrengungen, den Sinn des Gleichnisses zu verstehen. Sie stößt sich an dem anscheinend rabiaten, kleinlichen und vermeintlich unmenschlichen Ausschluss der törichten Jungfrauen. Dass ihnen Licht und Lampenöl ausgegangen waren, lag doch vor allem an der elend langen Warterei auf den Bräutigam! „Immerhin gaben sie sich Mühe, versuchten in der Nacht noch Öl zu bekommen.“ Im Übrigen seien doch alle Jungfrauen pünktlich zum Treffpunkt erschienen. Wer zu spät kam, war allein der Bräutigam.
Werden mit der Ausschluss-Geschichte nicht weitere Katholiken von der Kirche verprellt? Da muss ein neuer Schlussteil her mit einer inklusiven Botschaft. Die Kirchenzeitung findet ihn in einem modernen griechischen Roman, in dem Jesus die Schlusspassage anders, eben zeitgemäß erzählt: „Der Bräutigam lässt die Tore öffnen und die Jungfrauen eintreten mit den Worten: ‚Alle sollen essen und trinken und fröhlich sein. Lasst die gedankenlosen Jungfrauen hereinkommen und sich die Füße waschen, denn sie sind weit gelaufen.‘“
Mit dieser zeitgemäß-populistischen Neukonzeption einer biblischen Gleichnisgeschichte wird Folgendes offenbar:
In der modernen Theologie der Allerlösungslehre ist die ‚Häresie des anderen Evangeliums‘ angelegt.
Zu solchen toxischen Ergebnissen führt auch der päpstliche Pfad des Einschlagens auf die „rigiden“ konservativen Geistlichen mit ihrer „unflexiblen“ Bibelauslegung. Franziskus bezichtigt die, die sich der Treue zum authentischen Bibelwort verpflichtet wissen, als Häretiker. Doch die Zeigehand der falschen Beschuldigung zeigt mit drei Fingern auf ihn selbst: Er zieht sich das Gericht zu, wenn er die bibel- und glaubenstreuen Priester und Katholiken drangsaliert, aber jene Kräfte fördert, die die Kirche in eine zeitgeistnahe und bibelferne Wohlfühlorganisation verwandeln wollen, in der niemand mit den Konsequenzen seines Handelns rechnen müsste.
In den Nachrufen von Papst Franziskus und Bischof Bätzing ist der verstorbene Papst em. Benedikt zutreffend als „Diener des Evangeliums“ gewürdigt worden. Aber angesichts der gegenwärtigen Verdrehungen, Verfälschungen und Wahrheitsrelativierungen der Offenbarungsschrift ist das Diktum unbedingt zu präzisieren: Benedikt war ein treuer Diener des Evangeliums, der die hl. Schrift logos- und wahrheitsgemäß, unverkürzt und unverbogen ausgelegt und verkündet hat. Gemessen an diesem Maßstab apostolischer Schrifttreue können die obengenannten Sprecher den Titel „Diener des Evangeliums“ nicht für sich beanspruchen.
Bild: Vatican.va (Screenshot)