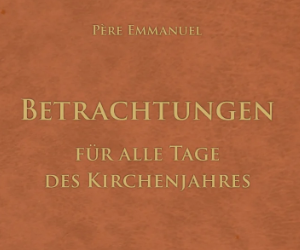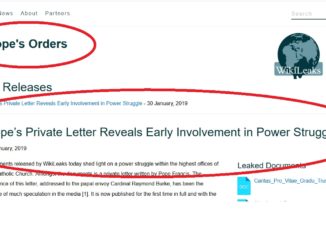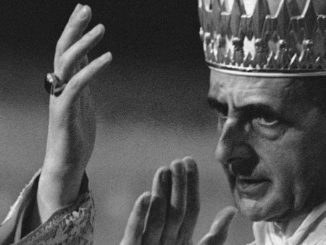Von Roberto de Mattei*
Weihnachten ist bekanntlich eine Zeit der guten Wünsche, und es ist verständlich, daß Papst Franziskus diesen Moment gewählt hat, um in die Häuser der Italiener einzutreten, und zwar durch das Interview, das er am 18. Dezember dem Fernsehsender Canale 5 zum Thema „Das Weihnachten, das ich mir wünsche“ gab. Die Themen, die er ansprach, sind solche, für die jeder empfänglich ist, wie Krieg, Armut, Hunger, der demografische Winter, Sport und Kinder. Seine Äußerungen schienen von natürlichem gesundem Menschenverstand inspiriert zu sein, dabei verzichtete er jedoch darauf, die grundlegenden Fragen des Glaubens und der Moral zu berühren, die unser tägliches Leben auch herausfordern. Viele dieser Fragen werden in zwei Büchern behandelt, die soeben erschienen sind und die versuchen, das Pontifikat und die Persönlichkeit von Papst Franziskus zu beleuchten.
Es handelt sich, das muß gleich gesagt werden, um ernste wissenschaftliche Studien und nicht um Pamphlete. Das erste Buch trägt den Titel „François, la conquête du pouvoir. Itinéraire d’un pape sous influences“ („Franziskus – die Eroberung der Macht. Weg eines beeinflußten Papstes“ Contretemps, Versailles 2022, 386 Seiten, 25 Euro) und stammt von Jean-Pierre Moreau, einem französischen Spezialisten für die Befreiungstheologie. Das zweite Buch, mit dem Titel „Super hanc petram. Il Papa e la Chiesa in un’ora drammatica della storia“ („Super hanc petram. Der Papst und die Kirche in einem dramatischen Moment der Geschichte“, Fiducia, Rom 2022, 276 Seiten, 22 Euro), stammt von Pater Serafino Lanzetta, einem begabten italienischen Theologen, der seinen Dienst in England und Schottland ausübt.
Moreau begibt sich auf die Suche nach den „maîtres à penser“, den Lehrmeistern, von Papst Franziskus und findet sie in den Schöpfern der „Theologie des Volkes“ (auch „Volkstheologie“), einem Zweig der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, der vom Katakombenpakt inspiriert wurde, der am 16. November 1965 in Rom gefeiert wurde, als etwa vierzig Bischöfe, darunter Monsignore Helder Câmara, die Notwendigkeit einer Rückkehr zur Praxis des historischen Jesus durch eine „dienende und arme Kirche“ proklamierten. Im selben Jahr wurde Pater Pedro Arrupe, Autor eines Reformprojekts, das die Kirche in ihren Grundfesten erschütterte, zum Generaloberen der Gesellschaft Jesu gewählt. Der Seligsprechungsprozeß von Monsignore Câmara und von Pater Arrupe wurde unter dem Pontifikat von Papst Franziskus eingeleitet, was bei kritischen Kennern der Befreiungstheologie wie Julio Loredo de Izcue, empörtes Erstaunen hervorrief, die sich zu Recht fragten, ob wir nicht vor einer „Seligsprechung des Schlechten“ stehen.
Laut Moreau hätte sich der Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, der 2013 Papst Franziskus wurde, angeregt von der „Theologie des Volkes“, zum Ziel gesetzt, den politisch-religiösen Arrupe-Plan zu verwirklichen, der 1981 durch dessen Rücktritt und die anschließende kommissarische Verwaltung des Jesuitenordens durch Johannes Paul II. unterbrochen wurde. Moreau geht jedoch noch weiter zurück und spürt in dem argentinischen Diktator Juan Domingo Peron, der von 1940 bis zu seinem Tod 1975 eine entscheidende Rolle in der Politik seines Landes spielte, den eigentlichen Mentor von Jorge Mario Bergoglio auf. Aus dieser Perspektive wäre Papst Franziskus in erster Linie ein „Peronist“, kein Ideologe, sondern ein pragmatischer und populistischer Mann der Tat, der sich eher von der politischen als von der übernatürlichen Dimension des katholischen Glaubens angezogen fühlt.
Der Ansatz von Moreau ist historisch-politisch geprägt, jener von Pater Lanzetta dagegen theologisch. Die Worte und Taten von Papst Franziskus werden in seinem Buch mit einem streng kritischen Geist, aber zugleich kindlicher Hingabe an das Papsttum untersucht, um die Gefahr aufzuzeigen, wenn der Pastoral Vorrang vor der Lehre eingeräumt wird, dem Handeln vor dem Sein, der Person des Papstes vor der Institution der Kirche. Sehr eindringlich sind die Seiten, die der Autor der neuen, heute weit verbreiteten Form des Nominalismus widmet, bei der Worte nicht mehr der Realität entsprechen, sondern verwendet werden, um etwas anderes zu sagen, als ihrer ursprünglichen und authentischen Bedeutung entspricht. Der Nominalismus ist historisch gesehen der Königsweg, der zum Pragmatismus führt, d. h. zur Auflösung des Denkens durch die Auflösung der Sprache. Die Begriffe Orthodoxie und Häresie verflüchtigen sich im nominalistischen Primat der Praxis. Mehr noch als die Ausbreitung der Häresie besteht das eigentliche Problem der Kirche heute in dem, was Pater Lanzetta als „flüssige Apostasie“ bezeichnet, die ihre Wurzeln in dem Versuch hat, „den doktrinären Aspekt der Offenbarung vom pastoralen zu trennen, indem der Anfang der Verkündigung nicht in den zu glaubenden Wahrheiten gesehen wird, sondern darin, wie man glauben soll, indem Angemessenheit und Modalitäten beurteilt werden“.
Die religiöse Krise geht also tief, aber Papst Franziskus selbst sagte beim Angelus am Sonntag, dem 18. Dezember, daß Gott in Krisenzeiten neue Perspektiven eröffnet, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten, vielleicht nicht so, wie wir es erwarten, aber Er. Wer hätte zum Beispiel die Aussagen erwartet, die am 18. Dezember gegenüber der spanischen Tageszeitung ABC gemacht wurden?
Der Papst, der bei der Amazonassynode 2019 die Weisheit der Eingeborenen der Arroganz der spanischen Eroberer gegenüberstellte, sagt heute:
„Die Hermeneutik für die Interpretation eines historischen Ereignisses muß jene der damaligen Zeit sein, nicht die der Gegenwart. Es ist offensichtlich, daß dort (in Lateinamerika) Menschen getötet wurden, es ist offensichtlich, daß es Ausbeutung gab, aber die Indianer haben sich auch gegenseitig umgebracht. Die Kriegsatmosphäre wurde nicht von den Spaniern exportiert. Und die Eroberung gehörte allen. Ich unterscheide zwischen Kolonisierung und Eroberung. Es gefällt mir nicht, zu sagen, daß Spanien einfach nur ‚erobert‘ hat. Man kann darüber streiten, soviel man will, aber es hat kolonisiert. Wenn man die Anweisungen der spanischen Könige jener Zeit liest, wie ihre Vertreter zu handeln hatten, dann hat kein König eines anderen Landes so viel getan. Spanien ist in das Gebiet vorgedrungen, die anderen imperialen Mächte blieben an der Küste. Spanien hat keine Piraterie betrieben. Das muß man berücksichtigen. Dahinter verbirgt sich nämlich eine Mystik. Spanien ist immer noch das Mutterland, was nicht alle Mächte von sich behaupten können.“
Hat der Philosoph und Publizist Marcello Veneziani recht, wenn er sagt, daß Papst Franziskus seit einiger Zeit seine Positionen ändert (La Verità, 17. Dezember 2022), oder erleben wir die Entfaltung eines politischen Programms, das sich an einer kohärenten Philosophie der Praxis orientiert?
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana