
Von Stefano Fontana*
Der Schweizer Theologe Hans Küng ist tot. Er machte oft Schlagzeilen auf den Titelseiten, wenn er mit schwerem Geschütz auf die katholische Glaubenslehre feuerte. Seiner Ausbildung nach Hegelianer, wollte er die ökumenische und demokratische Reformation der Kirche. Jahrzehntelang trat er laut an die Öffentlichkeit, säte aber leise im Stillen. Die Früchte ernten wir heute: Viele sind der Meinung, daß wir uns bereits mitten im Dritten Vatikanischen Konzil befinden, das er erhofft hatte.
Gestern ist der Theologe Hans Küng im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Tübingen verstorben. Der 1928 in Sursee in der Schweiz geborene Küng hatte sich dem Theologiestudium verschrieben und wurde mit 32 Jahren ordentlicher Professor an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Tübingen.
Jeder, auch jemand, der fast nichts über Theologie weiß, kennt zumindest den Namen Hans Küng und stellt ihn sich als den Antagonisten der katholischen Lehre schlechthin vor. Unter diesem Gesichtspunkt ist Küngs theologisches Leben das genaue Gegenteil der Anleitungen, die von der Glaubenskongregation 1990 in ihrer Instruktion Donum veritatis zur kirchlichen Berufung des Theologen gegeben wurden. Darin wurden die Theologen zur Klugheit ermahnt. Es wurde ihnen nahegelegt, sich nicht an die Medien zu wenden, theologische Positionen, die dem Lehramt zuwiderlaufen, nicht zur Schau zu stellen und nicht mehr die vom Lehramt einmal definierten Aussagen anzuzweifeln. Küng hingegen hat sich immer auf die Bühne gestellt und in Szene gesetzt, seit er Kardinal König von Wien zum Konzil in den Vatikan begleiten durfte. Und mit Sicherheit hat er nie die „kirchliche“ Klugheit angewandt, die das Lehramt von Theologen verlangt.
Wenn das bei einem Theologen geschieht, wie im Fall von Küng, bedeutet es vielleicht, daß der Theologe mehr oder weniger bewußt denkt, daß die Zukunft der Kirche von ihm oder zumindest vor allem von ihm abhängt. Diese persönliche Einstellung führt dann zu einer historistischen und progressistischen Theologie, was wiederum diese persönliche Einstellung theoretisch belebt. Sein Gefährte Karl Rahner erklärte offen, der Initiator einer neuen Kirche sein zu wollen, und nach seinem Leben und seiner Theologie zu urteilen, dachte auch Hans Küng so. Die Persönlichkeit ist also mit dem theologischen Bekenntnis in jener Idee verschweißt und umgekehrt, die den Reformatoren und Häretikern besonders am Herzen liegt, daß die Erlösung in der Zukunft liegt, daß die Zukunft die Erlösung ist und daß sie den Schlüssel zur Zukunft haben.

Küng war philosophisch viel, aber vor allem war er Hegelianer. In diesem Schlüssel fällt die Wirklichkeit der Kirche mit dem Selbstbewußtsein der Kirche in eins, und dieses Selbstbewußtsein ist ständig im Werden. Nicht daß es wird, sondern es ist Werden, und das Werden wird von der Zukunft geleitet, nicht von der Vergangenheit, sodaß es keinen gültigen theologischen Begriff geben kann, der nicht auch neu ist.
Genau das hatte Reginald Garrigou-Lagrange befürchtet, als er sich 1946 fragte, wohin die Nouvelle Théologie gehen würde – deren Kind im Grunde auch Küng ist, wenn auch rücksichtsloser als andere –, und noch dramatischer sich auch fragte, ob eine wahre Theologie noch möglich sei, auch wenn sie nicht neu ist. Es ist auch Küng geschuldet, wenn viele Theologen, ohne zu wissen, daß sie Küngianer sind, heute so denken: Jede theologische Position, um wirklich eine solche zu sein, muß neu sein. So denkt auch der Vorsitzende der deutschen Bischöfe, Msgr. Georg Bätzing. Der Schweizer Küng war ganz deutscher Theologe.
Hans Küng war auf ein Drittes Vaticanum ausgerichtet und erwartete ungeduldig, einem Johannes XXIV. begegnen zu können. Er glaubte, daß die Kirche von unten konstituiert sei und sich auch von unten erneuern würde. Er sagte, daß die neue Kirche von unten bereits begonnen habe. Er beschuldigte die Kirche des männlichen Chauvinismus und hätte sich eine weibliche Rückeroberung der Frauenrechte gewünscht, von der Empfängnisverhütung bis zum Priestertum. Die Bischöfe hätten von unten und frei gewählt werden sollen. Er drängte sehr auf einen neuen und radikaleren Ökumenismus, prangerte an, was er als „starrköpfige Betonung von Unterschieden“ bezeichnete, forderte die Aufhebung der Verurteilungen gegen Luther und Calvin und wollte mit den Kirchen der Reformation eine „eucharistische Gastfreundschaft als Ausdruck einer bereits verwirklichten Glaubensgemeinschaft“. Er hielt es für nicht vertretbar seitens der katholischen Kirche, daß es nur eine legitime Religion gebe, und sah diese Haltung als Folge des „europäischen Kolonialismus und des römischen Imperialismus“. Ihm zufolge hätte die Kirche das Infragestellen des Wahrheitsanspruchs durch andere Religionen anzunehmen.
Intern hätte die Kirche die regionalen und lokalen Ortskirchen zu Ehren des „Reichtums an Vielfalt“ gegen „dogmatische Arroganz“, „dogmatische Unbeweglichkeit“ und „moralistische Zensur“ autonom machen müssen. Die Kirche hätte seiner Meinung nach eine „Gemeinschaftsbeziehung“ zu leben und das Modell einer Kirche „von oben, starrsinnig, beruhigend, bürokratisiert“ aufzugeben. So wie die UdSSR ihre Dissidenten rehabilitierte, hätte auch die Kirche ihre eigenen Dissidenten rehabilitieren sollen, von Helder Camara bis Leonardo Boff. Die Zukunft der Kirche sah er neben der Ökumene auch im Pazifismus und in einem neuen Ökologismus.
Spitzentheologen im Sinne von spitz im Ton bekommen die Titelseiten von Zeitungen, wenn sie nur scharf genug schießen, und in der Tat schießen sie oft scharf, so Küng zum Beispiel, als er die Unfehlbarkeit des Papstes attackierte: Alle erinnern sich daran. Es ist aber nicht gesagt, daß ihr Vermächtnis in diesen Angriffen liegt, die ihnen Rampenlicht verschafften. Ihre wirkliche Aussaat erfolgt, sobald die Scheinwerfer ausgehen und in der Praxis der Kirche ihre Anleitungen stillschweigend im Dunkeln, abseits der Aufmerksamkeit, gelebt und verkörpert werden.
Man lese noch einmal den kurzen Überblick über Küngs Positionen der vorhergehenden Absätze. In der deutschen Kirche von heute und ihrem „Synodalen Weg“ finden wir sie alle wieder. Einige werden vielleicht etwas freundlicher vorgebracht, aber wir finden sie alle. Schauen wir dann auf die Weltkirche. Auch hier finden wir sie mehr oder weniger alle wieder: Leonardo Boff schreibt die päpstlichen Enzykliken und Msgr. Camara soll heiliggesprochen werden. Viele denken, daß wir uns bereits im Dritten Vaticanum befinden und daß ein Johannes XXIV. bereits gekommen ist. Luther und Calvin wurden wieder in den Schafstall eingelassen, die eucharistische Gastfreundschaft ist in manchen Orten bereits Standard und die Frauen nähern sich immer mehr dem Altar.
Während die Medien sich auf die Geschosse konzentrierten, die er auf die Kirche abfeuerte, war Hans Küng damit beschäftigt, seine Saat in der Kirche auszusäen.
*Stefano Fontana ist Direktor des International Observatory Cardinal Van Thuan for the Social Doctrine of the Church (Kardinal-Van-Thuan-Beobachtungsstelle für die Soziallehre der Kirche) und Chefredakteur der Kirchenzeitung des Erzbistums Triest, das von Erzbischof Giampaolo Crepaldi geleitet wird. Fontana promovierte in Politischer Philosophie mit einer Arbeit über die Politische Theologie. Ab 1980 lehrte er Journalistische Deontologie und Geschichte des Journalismus an der Universität Vicenza, seit 2007 Philosophische Anthropologie und Philosophie der Sprache an der Hochschule für Erziehungswissenschaften (ISRE) von Venedig. Autor zahlreicher Bücher. Zu den jüngsten gehören „La nuova Chiesa di Karl Rahner“ („Die neue Kirche von Karl Rahner. Der Theologe, der die Kapitulation vor der Welt lehrte“, Fede & Cultura, Verona 2017), gemeinsam mit Erzbischof Crepaldi „Le chiavi della questione sociale“ („Die Schlüssel der sozialen Frage. Gemeinwohl und Subsidiarität: Die Geschichte eines Mißverständnisses“, Fede & Cultura, Verona 2019).
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: NBQ
- Franziskus, der „absolute Monarch“ und das Unfehlbarkeitsdogma nach Hans Küng
- „Revision des Unfehlbarkeitsdogmas“ – Glückwunsch-Appell von Hans Küng an Papst Franziskus
- Hans Küng ist „hocherfreut“ über Papst Franziskus — „Muß nicht mehr als Papstkritiker auftreten“
- Von „schamloser Heuchelei“ und verzerrter Wahrnehmung — Die Realsatire des Hans Küng
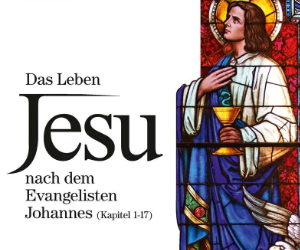

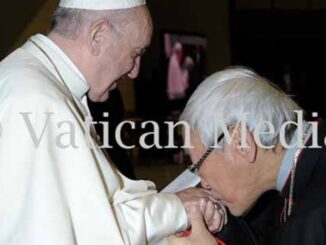


Auch bei Hans Küng gilt die wichtige Unterscheidung zwischen subjektiv (Personenbezogen) und objektiv (Sachbezogen)
Wie es subjektiv in ihm aussah weiß nur er und Gott allein, da steht uns kein Urteil zu, das ist verboten.
Objektiv aber war er ein Häretiker und viel schlimmer noch ein Seelenmörder. Wie viele sind durch seine Einlassungen gegen den Glauben, die Kirche, die Tradition vom Glauben abgefallen ?
Das wird er vor dem Stifter der Kirche verantworten müssen, beten wir für seine arme Seele.
Eine erneute, weltumspannende Bischofsversammlung im Vatikan wäre für die progressiven Kräfte in der Tat eher kontraproduktiv. Riefe es doch weltweite Aufmerksamkeit innerhalb und außerhalb der Kirche hervor, welche in der Regel zu einer positiven oder negativen Erwartungshaltung führen würde. Diese Erwartungshaltung hätte eine interessierte und intensive Rezeption der Konzilsdokumente zur Folge mit dem Ergebnis Widerstand oder enttäuschte Erwartung.
Eine „elegantere“ Möglichkeit ist, die „normative Kraft des Faktischen“ zu nutzen, da man die absolute Hegemonie über die kirchlichen Strukturen errungen hat. Wird die real massiv veränderte Lebenswirklichkeit nicht förmlich dokumentiert, weckt man nicht die sprichwörtlichen „schlafenden Hunde“ und gibt Kritikern keine förmliche Handhabe. Auch vermeidet man eine überzogene Erwartungshaltung am ultraprogressiven Flügel, weil sich modernistische Heißsporne von einem Konzil noch viel mehr Veränderung erwartet hätten.
Zudem hat jeder (auch der soweit wie irgend möglich formulierte) Tatbestand doch letztendlich einen Wortlaut und damit auch eine Auslegungsgrenze. Der Regelungscharakter etwaiger Konzilskonstitutionen und ‑dekrete eines formellen „Dritten Vatikanums“ sowie die umsetzenden Instruktionen wären kritischen Blicken konzilskonservativer Kreise (und deren Bemühungen, diese so zurückhaltend wie möglich auszulegen) ausgesetzt.
Zuerst dachte ich, dass Foto zeigt einen Kanoniker des Instituts Christus König und Hoherpriester, aber dass Küng am Ende seines Lebens in Griciliano eingetreten wäre, schließe ich dann doch aus.