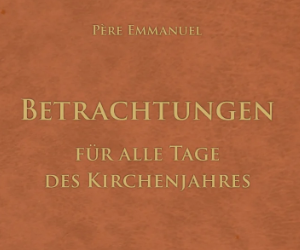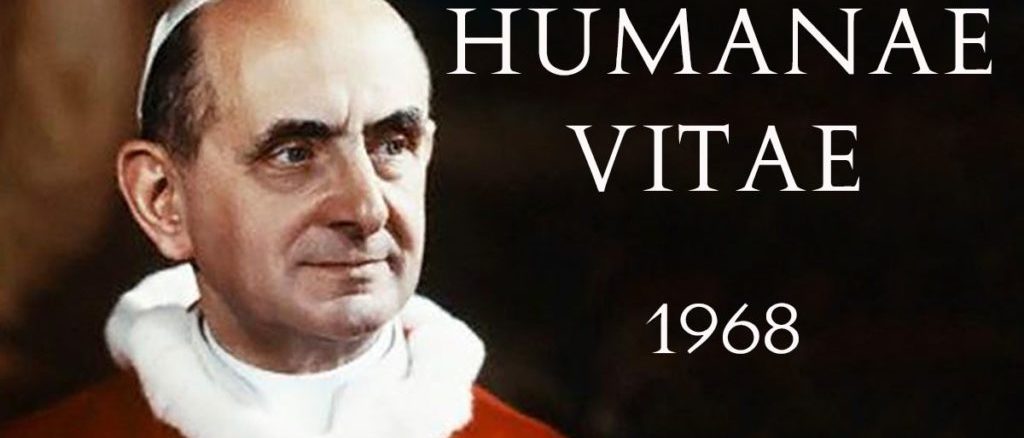
Vor 50 Jahren, am 25. Juli 1968, wurde von Paul VI. die Enzyklika Humanae vitae veröffentlicht. Der katholische Intellektuelle Roberto de Mattei erklärt, warum es sich dabei zwar um eine mutige, aber nicht um eine „prophetische“ Enzyklika handelte. Zudem erörtert er, woran Ehe und Familie heute kranken und nennt die Mittel, die Abhilfe schaffen können. LifeSiteNews führte dazu ein Interview mit ihm.
Diane Montagna: Am 25. Juli 1968 promulgierte Paul VI. die Enzyklika Humanae vitae. Wie lautet das historische Urteil 50 Jahre nach diesem Ereignis?
Prof. Roberto de Mattei: Humanae vitae ist eine Enzyklika von großer historischer Bedeutung, weil sie die Existenz eines unveränderlichen Naturrechts in einer Zeit in Erinnerung gerufen hat, in der der Bezugspunkt von Kultur und Sitten die Leugnung beständiger Werte in der Geschichte war.
Das Dokument von Paul VI. war auch eine Antwort auf eine kirchliche Revolution, die nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils die Kirche von innen angegriffen hat. Wir haben Paul VI. dafür zu danken, daß er dem sehr starken Druck der Medien und der kirchlichen Lobbys, die diesbezüglich eine Änderung der kirchlichen Lehre forderten, nicht nachgegeben hat.
Diane Montagna: Im Gegensatz zu vielen anderen halten Sie Humanae vitae aber nicht für eine prophetische Enzyklika. Warum?

Prof. Roberto de Mattei: Im allgemeinen Sprachgebrauch wird als prophetisch die Fähigkeit bezeichnet, durch die Gnade erleuchtet im Licht der Vernunft künftige Ereignisse vorherzusagen. Unter diesem Aspekt waren die 500 Konzilsväter „Propheten“, die während des Zweiten Vatikanischen Konzils eine Verurteilung des Kommunismus gefordert hatten, während jene, die sich einer solchen Verurteilung widersetzten, weil sie der Überzeugung waren, daß der Kommunismus etwas Gutes enthielt und noch Jahrhunderte dauern werde, keine „Propheten“ waren. Zur gleichen Zeit verbreitete sich in jenen Jahren der Mythos einer drohenden Überbevölkerung, und alle sprachen von der Notwendigkeit einer Geburtenkontrolle.
Keine Propheten waren jene wie Kardinal Suenens, die den Gebrauch von Verhütungsmitteln erlauben wollten, um die Geburten zu reduzieren, während jene Konzilsväter wie die Kardinäle Ottaviani und Brown Propheten waren, die sich dieser Forderung widersetzten, indem sie an die Worte der Genesis erinnerten: „Seid fruchtbar und vermehrt euch“. Das Problem, vor dem heute der Westen steht, ist mit Sicherheit nicht die Überbevölkerung, sondern der demographische Zusammenbruch. Humanae vitae war keine prophetische Enzyklika, weil sie das Prinzip der Geburtenkontrolle in Form der „verantworteten Elternschaft“ akzeptierte. Sie war allerdings ein mutiges Dokument, weil sie die Verurteilung künstlicher Verhütungsmittel und der Abtreibung bekräftigte. Unter diesem Gesichtspunkt verdient sie, gefeiert zu werden.
Diane Montagna: Manche haben nahegelegt, Humanae vitae enthalte eine neue Lehre, weil darin die Untrennbarkeit der beiden Ehezwecke betont wird, die Zeugung und die Einheit, die auf dieselbe Stufe gestellt wurden. Stimmen Sie dem zu?
Prof. Roberto de Mattei: Die Untrennbarkeit der beiden Ehezwecke ist Teil der kirchlichen Lehre und Humanae vitae ruft sie richtigerweise in Erinnerung. Um aber Mißverständnisse zu vermeiden, ist auch an die Existenz einer Hierarchie der Zwecke zu erinnern. Gemäß der Lehre der Kirche ist die Ehe ihrem Wesen nach eine Institution rechtlich-moralischen Charakters, die vom Christentum zur Würde eines Sakraments erhoben wurde. Ihr Hauptzweck ist die Zeugung von Nachkommen, was nicht eine bloß biologische Funktion meint, sondern untrennbar mit dem Geschlechtsakt verbunden ist.
Die christliche Ehe hat den Zweck, Gott und der Kirche Kinder zu schenken, damit aus ihnen künftige Bürger des Himmelreiches werden. Wie der heilige Thomas von Aquin lehrt (Contra Gent. 4,58), macht die Ehe die Eheleute zu „Verbreitern und Bewahrern des geistlichen Lebens gemäß einem Amt, das zugleich körperlich wie geistig ist“, das darin besteht, „den Nachwuchs zu zeugen und zum göttlichen Kultus zu erziehen“ (Ef 5,28). Die Eltern übergeben das übernatürliche Leben ihren Kindern nicht direkt, sondern müssen deren Entwicklung sicherstellen, indem sie ihnen beginnend mit der Taufe das Erbe des Glaubens weitergeben. Daher gehört zum Hauptzweck der Ehe auch die Erziehung des Nachwuchses: Ein Werk, wie Pius XII. in seiner Rede vom 19. Mai 1956 sagte, das wegen seiner Tragweite und seinen Folgen über die betreffende Generation hinausragt.
Diane Montagna: Welche lehramtliche Autorität kommt Humanae vitae zu?
Prof. Roberto de Mattei: Im Bemühen den doktrinellen Konflikt mit den Verhütungs-Verfechtern unter den Katholiken abzumildern, wollte Paul VI. dem Dokument nicht den Charakter einer Letztentscheidung geben. Die Verurteilung der Verhütungsmittel kann aber als unfehlbarer Akt des ordentlichen Lehramtes verstanden werden, wo es bekräftigt, was schon immer gelehrt wurde: Jeder Gebrauch von künstlichen Verhütungsmitteln beim Geschlechtsakt in der Ehe, um die Zeugung von Leben zu verhindern, verletzt das Naturrecht und stellt eine schwere Schuld dar.
Auch der Vorrang des Zeugungszweckes der Ehe kann als unfehlbare Lehre des ordentlichen Lehramtes betrachtet werden, weil er auf feierliche Weise von Pius XI. in Casti connubii und von Pius XII. in seiner Grundsatzrede an die Hebammen vom 29. Oktober 1951 bekräftigt wurde. Pius XII. stellte klar und deutlich fest:
„Die Wahrheit ist, daß die Ehe, als einer natürlichen Einrichtung, kraft des Willens des Schöpfers, nicht die persönliche Vervollkommnung der Ehegatten zum ersten und innigsten Zweck hat, sondern die Zeugung und Erziehung des neuen Lebens. Die anderen Zwecke, obwohl auch Teil ihres Wesens, stehen nicht auf derselben Ebene wie die Vorgenannten, und schon gar nicht über diesen, sondern ihrem Wesen nach diesen untergeordnet. Dies gilt für jede Ehe, auch wenn sie unfruchtbar ist; so wie von jedem Auge gesagt werden kann, daß es beabsichtigt und geformt ist, um zu sehen, auch wenn es in Ausnahmefällen wegen besonderer innerer und äußerer Bedingungen nie zur visuellen Wahrnehmung imstande ist.“
Der Papst erinnerte an dieser Stelle, daß der Heilige Stuhl mit einem öffentlichen Dekret des Heiligen Offiziums „verlautbarte, daß keine Urteile von einigen jüngsten Autoren zulässig sind, die leugnen, daß der Hauptzweck der Ehe die Zeugung und Erziehung des Nachwuchses ist, oder lehren, daß die zweitrangigen Zwecke nicht dem Hauptzweck untergeordnet, sondern gleichwertig und diesem unabhängig sind“ (S.C.S. Officii, 1. April 1944 – Acta Apostolicae Sedis„ Bd. 36, Jg. 1944).
Diane Montagna: In einem Aufsatz haben Sie hervorgehoben, daß sich im neuen Buch von Msgr. Marengo ein neues Element findet, nämlich der vollständige Text des Erstentwurfes der Enzyklika von Paul VI., die ursprünglich den Titel De nascendi prolis erhalten sollte. Diese Enzyklika wurde dann zu Humanae vitae umgewandelt. Können Sie uns etwas über diese Umwandlung sagen?
Prof. Roberto de Mattei: Die Entstehungsgeschichte von Humanae vitae ist komplex und gequält. Am Beginn steht die Ablehnung des vorbereiteten Schemas über die Familie und die Ehe durch die Konzilsväter, das von der Vorbereitungskommission für das Zweite Vatikanische Konzil ausgearbeitet und von Johannes XXIII. approbiert worden war. Der Hauptakteur der Wende war Kardinal Leo-Joseph Suenens, der damalige Erzbischof von Brüssel, der maßgeblichen Einfluß auf Gaudium et Spes hatte und die Ad-hoc-Kommission zur Geburtenregelung „steuerte“, die Johannes XXIII. ernannt und Paul VI. erweitert hatte.
Diese Kommission erarbeitete 1966 einen Text, in dem sich die Mehrheit der Experten für künstliche Verhütungsmittel aussprach. Die beiden folgenden Jahre waren kontrovers und konfus, wie die neuen, von Msgr. Marengo veröffentlichten Dokumente bestätigen. Dem Mehrheitsbericht, der 1967 vom National Catholic Report veröffentlicht wurde, stand der Minderheitsbericht gegenüber, der sich dem Gebrauch künstlicher Verhütungsmethoden widersetzte. Paul VI. ernannte daher eine neue Studiengruppe, die von seinem Haustheologen, Msgr. Colombo, geleitet wurde. Nach vielen Diskussionen gelangte man zu De nascendi prolis, doch dann kam es zu einer neuen Wendung, weil die französischen Übersetzer massive Einwände gegen das Dokument vorbrachten. Paul VI. nahm neue Änderungen vor und am 25. Juli 1968 wurde endlich Humanae vitae veröffentlicht.
Der Unterschied zwischen beiden Dokumenten bestand darin, daß ersteres mehr „doktrinärer“, das zweite hingegen mehr „pastoraler“ Art war. Man spüre darin, so Msgr. Marengo, „den Willen, es zu vermeiden, daß die Suche nach doktrinärer Klarheit als unsensible Strenge verstanden werden könnte“. Die traditionelle Doktrin der Kirche wurde bekräftigt, aber die Lehre von den Ehezwecken wurde nicht mit der nötigen Klarheit ausgedrückt.
Diane Montagna: In Ihrem Artikel schreiben Sie, daß Johannes Paul II. kraftvoll die Lehre von Humanae vitae bekräftigte, aber das Verständnis der ehelichen Liebe, die sein ganzes Pontifikat durchzog, Grund für zahlreiche Mißverständnisse war. Können Sie uns dazu etwas mehr sagen?
Prof. Roberto de Mattei: Ich bin Johannes Paul II. dankbar für die klare Bekräftigung des Sittengesetzes in Veritatis splendor. Die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., die zum Teil Eingang in das neue Kirchenrecht und den neuen Katechismus gefunden hat, bringt ein Eheverständnis zum Ausdruck, das fast ausschließlich auf der Liebe der Ehegatten beruht. Nach 50 Jahren muß man den Mut haben, die Frage einer objektiven Überprüfung zu unterziehen, die allein vom Wunsch der Wahrheitssuche und des Seelenheils angetrieben ist.
Die Früchte der neuen Pastoral stehen vor aller Augen. Die Verhütung ist in der katholischen Welt weitverbreitet und die Rechtfertigung, die dem gegeben wird, stellt eine verzerrte Sicht der Liebe und der Ehe dar. Wenn nicht die Hierarchie der Zwecke wiederhergestellt wird, besteht die Gefahr, daß gefördert wird, was man vermeiden will: Spannung, Konflikt und schließlich die Trennung der beiden Ehezwecke.
Diane Montagna: Aber ist der Ehebund nicht auch ein Symbol der innigen Verbundenheit Christi mit der Kirche?
Prof. Roberto de Mattei: Natürlich, aber der berühmte Satz des heiligen Paulus (Eph 5, 32) wird fast immer auf den Geschlechtsakt bezogen, während die eheliche Liebe nicht nur gefühlsmäßige Liebe meint, sondern vor allem rationale Liebe. Die rationale Liebe, von der Caritas erhöht, wird zu einer Form der übernatürlichen Liebe, die die Ehe heiligt. Die gefühlsmäßige Liebe kann verzerrt werden, sogar soweit, den Ehegatten als Lustobjekt zu sehen. Diese Gefahr kann auch aus einer Überbetonung des bräutlichen Charakters der Ehe kommen.
Zudem sagte Pius XII. bezüglich des Bildes von der Verbindung Christi mit seiner Kirche: „Im einen wie im anderen ist die Selbsthingabe total, exklusiv und unumkehrbar: im einen wie im anderen ist der Bräutigam das Haupt der Braut, die ihm zugeordnet ist wie dem Herrn (vgl. ibidem 22–23). Im einen wie im anderen wird das gegenseitige Schenken zum Prinzip der Ausbreitung und der Quelle des Lebens“ (Rede an die Brautleute vom 23. Oktober 1940).
Heute liegt der Akzent nur auf dem gegenseitigen Sich-Schenken, während verschwiegen wird, daß der Mann das Haupt der Frau und der Familie ist, so wie Christus das Haupt der Kirche ist. Die implizite Leugnung des Vorranges des Ehemannes über die Ehefrau entspricht analog der Unterschlagung des Vorranges der Zeugung vor der ehelichen Gemeinschaft. Dadurch wird eine Rollenverwirrung in die Familie hineingetragen, deren Folgen wir heute deutlich sehen.
Erstveröffentlichung: LifeSiteNews
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana