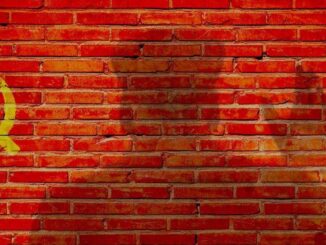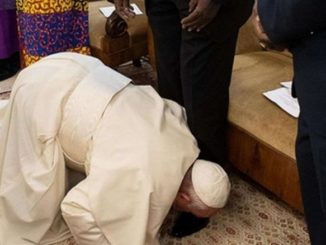Von Roberto de Mattei*
Der brüchige Waffenstillstand im Gazastreifen darf keine Illusionen nähren – weder hinsichtlich der Zukunft dieses Abkommens noch in bezug auf die Möglichkeit eines baldigen Friedensschlusses zwischen Rußland und der Ukraine. Zwischen den beiden gegenwärtig andauernden Konflikten besteht zudem ein grundlegender Unterschied. Das Abkommen von Gaza war vor allem deshalb möglich, weil es dort einen Sieger und einen Besiegten gab – Israel einerseits, die Hamas andererseits. Zum Zweiten konnte es nur durch die breite Zusammenarbeit arabisch-muslimischer Staaten zustandekommen, die entschlossen waren, jene Ordnung wiederherzustellen, welche die Hamas mit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 erschüttert hatte.
In der Ukraine hingegen gibt es bislang weder einen eindeutigen Sieger noch einen eindeutig Unterlegenen – und erst recht fehlt es an einer breiten Koalition von Staaten, die bereit wäre, Rußland zu isolieren. Denn anders als die Hamas ist Rußland ein riesiges Land mit atomarer Schlagkraft. China, von dem Rußland heute in hohem Maße abhängig ist, hat jedes Interesse daran, das Engagement der USA in Europa einzufrieren, um so deren Kräfte vom indo-pazifischen Raum abzuziehen – mit dem Ziel, jenen tödlichen Schlag gegen Taiwan zu führen, auf den sich Peking seit Jahren vorbereitet.
Um seine militärische Präsenz im Indo-Pazifik ausweiten zu können, möchte US-Präsident Trump sich von der europäischen Front zurückziehen, wobei er verkennt, daß das, was in der Ukraine auf dem Spiel steht, das Schicksal des gesamten Westens betrifft. Denn innerhalb dessen, was wir „den Westen“ nennen, mag Europa zwar in wirtschaftlicher, politischer und militärischer Hinsicht die jüngere Schwester der USA sein – in geistiger und kultureller Hinsicht aber ist es deren Mutter. Die amerikanische Zivilisation wurzelt tief in jenem intellektuellen, religiösen und moralischen Erbe, das Europa hinterlassen hat.
Die Ukraine – das historische Reich von Kiew – gehört ihrer Geschichte und ihrer heutigen politischen Ausrichtung nach unzweifelhaft zu Europa, nicht zum moskowitischen Rußland. Sie im Stich zu lassen, wäre ein Akt moralischer Feigheit und politischer Kurzsichtigkeit.
Trump läuft – in seinem Bestreben, den Ukrainekonflikt rasch zu beenden – Gefahr, denselben Fehler zu begehen wie Putin: nicht so sehr in der Fehleinschätzung der Persönlichkeit Selenskyjs, eines Schauspielers, der sein Leben zu einer Bühne gemacht hat, sondern vielmehr in der Unterschätzung des unbeugsamen Widerstandsgeistes des ukrainischen Volkes – eines Volkes, das, ohne sich zu beugen, den Holodomor überlebt hat, jenes von Stalin herbeigeführte Hungersterben der Jahre 1932–1933, dem rund vier Millionen Menschen zum Opfer fielen, und das zwischen 1941 und 1960 den entschlossensten militärischen Widerstand gegen die Sowjetmacht in Osteuropa leistete. Ein Abkommen, das diesem Volk unannehmbare Bedingungen aufzwingt, dürfte schwerlich Bestand haben.
Wir stehen heute vor Knoten, die sich kaum noch lösen lassen. Präsident Trump kennt gewiß weder die Schriften, welche Joseph de Maistre (1753–1821) und Juan Donoso Cortés (1809–1853) Rußland gewidmet haben, noch vermutlich jene des amerikanischen Historikers Henry Adams (1838–1918), der in Rußland eine territoriale und menschliche Realität von ungeheurer Dimension sah – ein Phänomen, das sich schwerlich begreifen oder regieren lasse, eher eine Naturgewalt als ein Staat im westlichen Sinne (vgl. The Education of Henry Adams. An Autobiography, Modern Library, New York 1996, S. 438f).
Ob Trumps vorrangiges Ziel die Größe Amerikas oder vielmehr die Selbstverherrlichung seines eigenen Ichs ist – etwa durch die Erringung eines längst diskreditierten, ihm jedoch offenbar bedeutungsvollen Friedensnobelpreises –, bleibt ungewiß. Dennoch ist anzuerkennen, daß der US-Präsident von einem Stab fähiger Berater umgeben ist, die seine Fehlkalkulationen zu korrigieren versuchen. Putin hingegen, wie alle Diktatoren, ist in seinen Entscheidungen tragisch isoliert – niemand wagt es, ihm zu widersprechen.
Trump blickt auf Lorbeeren, die über seine Präsidentschaft hinausreichen; Putin weiß, daß er bis zu seinem Lebensende herrschen muß – will er nicht riskieren, nach seiner Herrschaft selbst den Tod zu finden. Aus diesem Grund scheint sich in ihm ein selbstzerstörerischer Impuls zu regen. Der Präsident der Russischen Föderation hat seine Gegner im In- und Ausland ermorden lassen und läßt Hunderttausende seiner eigenen Landsleute in einem der desaströsesten Feldzüge der russischen Geschichte abschlachten.
Die russische Sommeroffensive neigt sich ihrem Ende zu – und wie Marta Serafini in der Tageszeitung Corriere della Sera vom 20. Oktober berichtet, hat der russische „Zar“ keines seiner erklärten Ziele erreicht: Pokrowsk, seit über einem Jahr in Bedrängnis, ist nicht gefallen; auch hat die russische Armee nie die vollständige Kontrolle über die von Putin beanspruchten Oblaste Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson erlangt. Der russische Diktator weiß, daß er nicht siegen kann – und ist doch zu allem bereit, nur um nicht zu verlieren. Seine künftigen Schritte sind so schwer vorhersehbar wie jene Trumps, der das Improvisierte und das Überraschende liebt.
Das Problem ist: Einst waren die internationalen Beziehungen einem Schachspiel vergleichbar – einem Duell erfahrener Spieler, die all ihre intellektuellen Fähigkeiten einsetzten. Heute jedoch beherrscht ein Wirrwarr an Leidenschaften die Bühne – sie sind die eigentliche Ursache der globalen Instabilität. Robert Kaplan spricht in diesem Zusammenhang von einem „shakespeareschen Niedergang“ und meint damit jene inneren Dämonen, die die politischen Führer in einen Zustand des Wahns treiben (Das fragile Jahrhundert. Chaos und Macht in einer Welt dauerhafter Krisen, Marsilio, Venedig 2025, S. 100). Doch fehlt es den heutigen Machthabern an jener tragischen Einsicht und seelischen Größe, die Shakespeares Figuren auf ihrem Weg in den Untergang auszeichnen.
An die Stelle des elisabethanischen Theaters ist eine digitale Welt getreten, in der jeder – ob Machthaber, Influencer oder einfacher Zuschauer – seine Rolle vor einem unsichtbaren Publikum spielt, während soziale Netzwerke die Reichweite ungeordneter Leidenschaften vervielfachen. Wie in Shakespeares Dramen dominieren Emotionen über die Vernunft – doch die inneren Dämonen eines Macbeth oder Othello zeigen sich heute als soziale Abhängigkeit von Algorithmen.
Zorn, Rachsucht, Haß und Ressentiment sind zu den beherrschenden Triebkräften einer labilen kollektiven Psyche geworden, die sich in der virtuellen Welt nährt – vor einem globalen Publikum. In diesem Umfeld vollzieht sich der innere Verfall einer Zivilisation, die – wie Shakespeares tragische Gestalten – von ihren eigenen Dämonen verzehrt wird. Nur daß sich der Wahnsinn heute nicht mehr in der Stille eines Palastes abspielt, sondern sich selbst inszeniert – vor dem Bildschirm, als globale Tragödie in Echtzeit.
Die Psychologie von Individuen und Massen entzieht sich jeder ideologischen Deutung: Denn die Gegenwart wird nicht mehr von Ideen, sondern von kollektiven Stimmungen und einem unkontrollierbaren Pathos beherrscht. In der Welt der realen und virtuellen Leidenschaften lösen sich sämtliche Ideologien auf. Bestand hat allein die zerstörerische Kraft des Kommunismus – neu belebt durch Chinas Präsident Xi Jinping in Peking und von Wladimir Putin in Moskau in politische Praxis übersetzt.
Die Prophezeiung von Fatima erfüllt sich – und die katholische, apostolische, römische Kirche bleibt mit ihren unfehlbaren Wahrheiten in Glaube und Moral der letzte feste Punkt im gegenwärtigen Chaos. Wenn alles vom Strudel der Gegenwart verschlungen wird, wenn die Zeit zu einem Strom zielloser Ereignisse wird, in dem alles möglich und alles unvorhersehbar ist, wird historische und theologische Reflexion zur Notwendigkeit. Gottes Eingreifen ist in jedem Augenblick möglich – und es genügt ein einziger Akt der Treue oder des Verrats durch einen Menschen, um den Lauf der Geschichte zu wenden.
Im 5. Jahrhundert verriet der römische General Bonifatius, Comes Africae und Statthalter der römischen Provinz Afrika (ca. 422–432 n. Chr.), seinen Glauben und das Reich, indem er sich mit den einfallenden Vandalen verbündete (Prosper von Aquitanien, Chronicon, zum Jahr 429). Der heilige Augustinus, der ihn zum Widerstand aufrief, starb während der Belagerung der Stadt Hippo – in der Betrachtung des Untergangs des Römischen Reiches, das nicht nur durch die Macht der Barbaren, sondern auch durch den Verrat und das Versagen seiner eigenen Verteidiger zerfiel. Und doch sollte gerade auf den Trümmern dieses Reiches die christliche Zivilisation des Mittelalters erstehen.
Die Theologie der Geschichte des heiligen Augustinus – jenes Zeugen des Verfalls des Imperium Romanum – ist bis heute die einzige geistige Deutung, die dem Herzen wahre Hoffnung zu schenken vermag. Sie offenbart, daß inmitten des Zerfalls ein höherer Sinn verborgen liegt, daß Gottes Hand auch in Katastrophen wirkt, um einen neuen, tieferen Anfang vorzubereiten.
Wer, wenn nicht ein künftiger Papst Leo XIV., könnte heute berufen sein, den dauerhaften Sinn dieser augustinischen Lehre wiederzubeleben? In einer Welt, in der die Geschichte sich scheinbar nur noch als Aufeinanderfolge von Krisen, Brüchen und Katastrophen entfaltet, wird es notwendig, den Blick zu heben – über das Getöse der Gegenwart hinaus – hin zu einer Geschichtsbetrachtung, die nicht von Angst, sondern von Glauben, nicht von Resignation, sondern von Hoffnung getragen ist.
Denn das letzte Wort gehört nicht dem Chaos, nicht dem Krieg, nicht dem Tod – sondern der Wahrheit, der Ordnung und dem göttlichen Plan. In dieser Gewißheit liegt die eigentliche Kraft, die der christlichen Zivilisation in den dunkelsten Stunden ihrer Geschichte immer wieder neues Leben eingehaucht hat. Und so kann auch in der heutigen Stunde der Prüfung, durch Leiden geläutert, ein neuer Aufbruch geschehen – aus dem Innersten des Menschen, dem einzigen Ort, an dem die Geschichte wahrhaft entschieden wird.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana