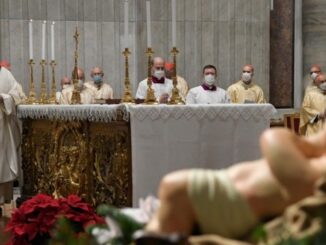Papst Leo XIV. hat sich nach Castel Gandolfo zurückgezogen, wo er den Sommer verbringt – ohne freilich Urlaub zu machen. Das Klima am Rande des Albanersees, eines alten Vulkankraters, ist deutlich milder als in der Stadt am Tiber, wo die Temperaturen im Sommer nicht selten die 40-Grad-Marke erreichen – und das war schon immer so, nicht erst seit dem angeblich menschengemachten Klimawandel. Aus diesem Grund wählten sich die Päpste vor vielen Jahrhunderten Castel Gandolfo zur Sommerresidenz. Auf dem Schreibtisch des neuen Papstes stapeln sich die Dossiers zahlreicher Baustellen.
Vor allem aber arbeitet Leo XIV. an entscheidenden Personalfragen, die seinem Pontifikat Richtung und Prägung geben werden. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri ist bekannt für seine Gründlichkeit – besonders bei wichtigen Ernennungen. Kuriere mit Unterlagen und Personalvorschlägen pendeln pausenlos zwischen der Villa Barberini und den römischen Dienststellen.
In dieser Villa – eigentlich die Sommerresidenz des Kardinalstaatssekretärs – hat sich der Papst einquartiert, weil sein Vorgänger Franziskus das Schloß in ein Museum umgewandelt hatte. Um es wieder bewohnbar zu machen, wären zunächst aufwendige Rückbauten notwendig. Leo XIV. wartet unterdessen darauf, daß die ebenfalls durch Franziskus notwendig gewordenen Umbauarbeiten in seiner Wohnung im Apostolischen Palast in Rom abgeschlossen werden, um nach seiner Rückkehr dorthin übersiedeln zu können. Castel Gandolfo bleibt vorerst auf der Warteliste – möglicherweise für den nächsten Sommer.
Doch der Aufenthalt in der Sommerresidenz des Kardinalstaatssekretärs hat nicht nur praktische Gründe, sondern auch Symbolkraft. Die Abberufung von Kardinal Pietro Parolin gilt weiterhin nicht als sicher, aber nicht unwahrscheinlich, auch wenn die Diskussion darüber zuletzt leiser geworden ist. Zugleich stehen eine Reihe anderer Schlüsselentscheidungen an – darunter die Ernennung des päpstlichen Vikars für die Diözese Rom, ein Amt, das traditionell mit der Kardinalswürde verbunden ist.
Leo XIV. als Bischof von Rom – mehr als eine Formel?
Leo XIV., so heißt es, will sein Amt als Bischof von Rom sichtbar ernster nehmen als sein Vorgänger. Zwar betonte Franziskus stets diesen Titel, kümmerte sich aber kaum um die konkrete Seelsorge in der Diözese. Aus dem römischen Klerus wird nun der dringende Wunsch laut, den von Franziskus eingesetzten Vizeregenten, Msgr. Renato Tarantelli Baccari, aus dem Amt zu entfernen. Tarantelli war bereits nach nur sechs Jahren im Priesteramt zum Bischof geweiht worden – selbst unter Franziskus eine Blitzkarriere, die Verwunderung auslöste. Innerhalb des Klerus der Ewigen Stadt ist der stellvertretende Generalvikar jedoch höchst unbeliebt. Leo XIV. wurde unmißverständlich klargemacht, daß seine Glaubwürdigkeit als Bischof von Rom – zumindest in den Augen der römischen Priester – „ausschließlich von dieser Entscheidung“ (Il Fatto Quotidiano) abhänge.
Zugleich wurde dem Kirchenoberhaupt sicherheitshalber auch gleich ein „Luxusexil“ für Tarantelli vorgeschlagen, um dessen Abgang weniger sanft zu gestalten: die Territorialprälatur Pompei mit ihrem berühmten Marienheiligtum. Der dortige Amtsinhaber, Msgr. Tommaso Caputo, ein ehemaliger Vatikandiplomat, wird im Oktober das kanonische Rücktrittsalter von 75 Jahren erreichen.
Ein stiller Rücktritt als Signal
Einer, der in dieser Sache unmittelbar bis zum Papst vordringen konnte, ist Msgr. Benoni Ambarus – ein aus Rumänien stammender Geistlicher, der seit den späten 1990er Jahren in Rom lebt. Nach einem Lizentiat in Dogmatik an der Gregoriana war er in der Priesterausbildung und später als Pfarrer in Rom tätig. Unter Franziskus wurde er Direktor der Diözesancaritas und 2021 zum Weihbischof von Rom ernannt. Innerhalb der Italienischen Bischofskonferenz diente er als Sekretär der Kommission für Migrationsfragen. 2024 erhielt er die italienische Staatsbürgerschaft. Am 18. Juni ernannte ihn Leo XIV. überraschend zum Erzbischof von Matera-Irsina und Bischof von Tricarico – Teil einer laufenden Neuordnung kleinerer Bistümer in Italien, die in einem ersten Schritt in Personalunion zusammengeführt und in einem zweiten Schritt zusammengelegt werden sollen. Die Amtseinführung erfolgt am kommenden Samstag in Matera und am Sonntag in Tricarico.
Hinter dieser offiziellen Biographie verbirgt sich jedoch ein stiller Protest. Ambarus hatte nach dem Tod von Franziskus auf sein Amt als Weihbischof verzichtet – aus offenem Widerspruch gegen den Führungsstil von Msgr. Tarantelli, wie er persönlich Leo XIV. erklärte. Der Papst versprach, sich der Sache anzunehmen – und sprach darauf mit zwei Kardinälen: dem ehemaligen Kardinalvikar von Rom, Angelo De Donatis, sowie Enrico Feroci, dem vormaligen Direktor von der Caritas von Rom. Letzterer wurde von Franziskus ebenfalls in den Kardinalsrang erhoben. Auch Kardinal Baldassare Reina, der aktuelle Generalvikar, wurde angehört – obwohl oder weil er als enger Vertrauter Tarantellis gilt. Die unerwartete Ernennung Ambarus’ zum Erzbischof von Matera wird als Signal in der Sache verstanden.
Und das Staatssekretariat?
Weit größere Bedeutung für die Weltkirche hat freilich die Frage nach der künftigen Leitung des Staatssekretariats – der mächtigsten Behörde der Römischen Kurie. Schon in den Generalkongregationen vor dem Konklave waren Stimmen laut geworden, die eine Neuausrichtung forderten. Kardinal Parolin war damals als einer der starken Männer im Raum selbst anwesend, zugleich Vorsitzender im bevorstehenden Konklave und selbst ein Papabile. Doch seine Position gilt inzwischen als angeschlagen.
Im Zentrum der Debatte steht im Moment der Posten des Substituten, der zuletzt von wechselndem Glück begleitet war. Zuerst war es der Sarde Angelo Becciu, der in offenen Konflikt mit Parolin geriet. Dieser forderte von Franziskus eine Entscheidung: Einer von beiden müsse gehen. Becciu wurde daraufhin zum Präfekten der Heiligsprechungskongregation wegbefördert – und zum Kardinal erhoben. Bald darauf stürzte er allerdings tief: In erster Instanz wurde er wegen Finanzskandalen um eine Luxusimmobilie in London zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Berufungsverfahren beginnt am 22. September. Obwohl formal dazu berechtigt, verzichtete Becciu auf entsprechenden Druck hin auf die Teilnahme am Konklave.
Beccius Nachfolger als Substitut wurde der Venezolaner Msgr. Edgar Peña Parra. Dem Vatikandiplomaten war schon vor seiner Ernenung die Zugehörigkeit zur sogenannten „Lavendel-Fraktion“ vorausgeeilt. Nun mehren sich Stimmen, die Papst Leo XIV. nahelegen, ihn abzuberufen – bei gleichzeitiger Bestätigung von Kardinal Parolin und Erzbischof Paul Gallagher, dem „Außenminister“ des Heiligen Stuhls. Ob der neue Papst diesem Rat folgt, der vor allem auf die Bestätigung Parolins abzielt, bleibt abzuwarten.
Petersdom: Traditionsbruch und Reformwille
Nicht zuletzt steht auch die „Fabbrica di San Pietro“ – die Dombauhütte des Petersdoms – im Zentrum verschiedener Erwartungen an den neuen Papst. Hier könnte das Wort von Pater Mario Bettero eine wichtige Rolle spielen, einem Mitbruder Leos XIV. im Augustinerorden. Bettero war über viele Jahre Pfarrer von St. Peter. Der Vatikan ist für seine Bewohner auch als eigene Pfarrei verfaßt, und diese war seit ihrer Errichtung im 15. Jahrhundert den Augustiner-Eremiten anvertraut.
Bettero wurde jedoch vom 2021 neu ernannten Erzpriester Mauro Gambetti, einem umtriebigen Minoriten, abgesetzt. Kardinal Gambetti entzog den Augustinern die Pfarrei und übergab sie Angehörigen seines eigenen Ordens. Dieses Vorgehen wurde als Affront gewertet und könnte zum Bumerang werden, weil nur wenig später erstmals ein Augustiner zum Papst gewählt wurde. Gambetti ist nicht nur Erzpriester, sondern auch Vorsitzender der Dombauhütte, die viele Aufträge vergeben kann.
Kurz vor Gambettis Amtsantritt in Rom fiel das umstrittene Rundschreiben des Staatssekretariats vom 12. März 2021, mit dem die Zelebration im überlieferten Ritus im Petersdom faktisch untersagt wurde. Seitdem darf in der außerordentlichen Form des Römischen Ritus nur noch zwischen 7 und 9 Uhr morgens in der Cappella Clementina in den Vatikanischen Grotten zelebriert werden.
Im kommenden Oktober findet die internationale Wallfahrt der Tradition Ad Petri Sedem statt. Erstmals wurde sie 2012 durchgeführt. Die damals große Hoffnung, Papst Benedikt XVI. könnte daran teilnehmen, erfüllte sich nicht. Die Hoffnung ist groß, daß Papst Leo XIV. den Pilgern die Feier eines feierlichen Pontifikalamtes am Kathedra-Altar des Petersdoms wieder gestatten wird – nachdem unter Franziskus die Zelebration in den letzten zwei Jahren untersagt worden war. Die Erlaubnis wäre ein erster wichtiges Signal für die Tradition in der Kirche.
Themenwechsel: In Rom rechnet man unterdessen fest damit, daß unter Leo XIV. die Spendeneingänge für den Unterhalt des Vatikans wieder steigen werden – insbesondere aus den Vereinigten Staaten, wo sie unter Franziskus merklich eingebrochen waren.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)