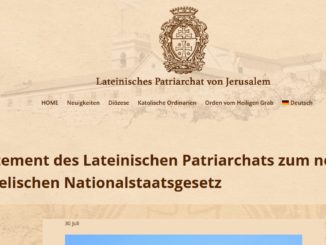Groß war die Erwartungshaltung der Medien, ob und was Papst Leo XIV. bei seiner Ansprache im Rahmen der gestrigen Generalaudienz zu den beiden weltpolitischen Brennpunkten sagen würde: dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Gaza-Konflikt. So war man es von Franziskus gewöhnt. Noch gestern kehrte Leo XIV. in seine Sommerresidenz in Castel Gandolfo zurück, „um sich zu erholen“ wie es hieß. Die römische August-Hitze macht dem neuen Kirchenoberhaupt offenbar zu schaffen. Und um Mißverständnissen vorzubeugen: Sie ist kein Ereignis eines angeblich „menschengemachten“ Klimawandels, sondern ein Phänomen, das durch zahlreiche Chroniken durch die Jahrhunderte belegt ist. Aus diesem Grund errichteten sich die Päpste am Beginn der Neuzeit die Sommerresidenz am klimatisch günstiger gelegenen Kratersee außerhalb von Rom. Die Anmerkung ist geradezu zwingend, da wir in deutschen Landen erst vor kurzem kalte und verregnete Schlechtwettertage hatten, sich der Mainstream aber dennoch nicht entblödete, täglich Hitzepanik zu erzeugen. So geschieht „Information“, wenn sie ideologischen Vorgaben folgt.
Nun aber zum Wesentlichen: Leo XIV. nahm gestern nicht zu den genannten Konflikten Stellung. Zu keinem. Er enthielt sich jeder direkten Erwähnung oder Anspielung, sondern hielt eine geistliche Katechese, wie es Sinn und Zweck der Generalaudienz ist. Aus seiner Ansprache läßt sich allerdings auch einiges für die beiden genannten Konflikte herauslesen. Hier die vollständige Katechese auf deutsch:
Liebe Brüder und Schwestern,
wir setzen unseren Weg in der Schule des Evangeliums fort und folgen den letzten Tagen Jesu auf seinem Lebensweg. Heute verweilen wir bei einer Szene, die zugleich intim, dramatisch und zutiefst wahrhaftig ist: der Moment, in dem Jesus während des Paschamahls offenbart, daß einer der Zwölf ihn verraten wird:
„Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch, der mit mir ißt, wird mich verraten“ (Mk 14,18).
Diese Worte sind eindringlich. Jesus spricht sie nicht, um zu verurteilen, sondern um zu zeigen, daß wahre Liebe ohne Wahrheit nicht auskommt. Der obere Raum, in dem zuvor alles sorgfältig vorbereitet war, erfüllt sich plötzlich mit einem stillen Schmerz – geprägt von Fragen, Argwohn und Verwundbarkeit. Diesen Schmerz kennen auch wir gut, wenn in die innigsten Beziehungen der Schatten des Verrats fällt.
Doch die Art und Weise, wie Jesus von dem Bevorstehenden spricht, ist bemerkenswert: Er erhebt nicht die Stimme, er weist nicht mit dem Finger, er nennt nicht Judas beim Namen. Vielmehr spricht er so, daß sich jeder selbst befragen kann. Und genau das geschieht. Markus berichtet:
„Da wurden sie betrübt und begannen, ein jeder von ihnen zu ihm zu sagen: Bin ich es etwa?“ (Mk 14,19).
Liebe Freunde, diese Frage – „Bin ich es etwa?“ – ist wohl eine der aufrichtigsten, die wir uns selbst stellen können. Sie ist nicht die Frage der Unschuldigen, sondern des Jüngers, der seine eigene Zerbrechlichkeit erkennt. Nicht der Ruf des Schuldigen, sondern das Flüstern desjenigen, der liebt und zugleich weiß, daß er verletzen kann. In diesem Bewußtsein beginnt der Weg zur Erlösung.
Jesus denunziert nicht, um zu demütigen. Er spricht die Wahrheit, weil er retten will. Und um gerettet zu werden, muß man spüren: spüren, daß man involviert ist, spüren, daß man trotz allem geliebt wird, spüren, daß das Böse real ist, aber nicht das letzte Wort hat. Nur wer die Wahrheit einer tiefen Liebe kennt, vermag auch die Wunde des Verrats anzunehmen.
Die Reaktion der Jünger ist keine Wut, sondern Traurigkeit. Sie empören sich nicht, sie werden betrübt. Ein Schmerz, der aus der realen Möglichkeit des eigenen Verstricktseins erwächst. Und gerade diese Traurigkeit, wenn sie ehrlich angenommen wird, wird zum Ort der Umkehr. Das Evangelium lehrt uns nicht, das Böse zu verleugnen, sondern es als schmerzliche Chance zur Wiedergeburt zu erkennen.
Jesus fügt dann Worte hinzu, die uns beunruhigen und zum Nachdenken anregen:
„Wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Besser wäre es für den, wenn er nie geboren wäre!“ (Mk 14,21).
Das sind harte Worte, gewiß, doch sie sind richtig verstanden kein Fluch, sondern ein Schrei des Schmerzes. Im Griechischen klingt dieses „Wehe“ wie ein klagendes „Ach!“ – ein Ausdruck aufrichtiger und tief empfundener Mitmenschlichkeit.
Wir sind es gewohnt zu richten. Gott jedoch nimmt das Leiden auf sich. Wenn er das Böse sieht, rächt er sich nicht, sondern betrübt sich. Und dieses „Besser wäre es, nie geboren zu sein“ ist keine vorgefertigte Verurteilung, sondern eine Wahrheit, die jeder von uns anerkennen kann: Wenn wir die Liebe verleugnen, die uns ins Leben gerufen hat, wenn wir durch Verrat uns selbst untreu werden, verlieren wir den Sinn unserer Existenz und schließen uns selbst von der Erlösung aus.
Doch gerade dort, im dunkelsten Punkt, erlischt das Licht nicht. Im Gegenteil, es beginnt zu leuchten. Denn wenn wir unsere Grenzen erkennen, wenn wir uns vom Schmerz Christi berühren lassen, können wir neu geboren werden. Der Glaube erspart uns nicht die Möglichkeit der Sünde, aber er schenkt immer einen Weg hinaus – den der Barmherzigkeit.
Jesus gerät nicht ins Entsetzen angesichts unserer Zerbrechlichkeit. Er weiß wohl, daß keine Freundschaft vor Verrat gefeit ist. Doch er vertraut weiter. Er setzt sich wieder an den Tisch mit den Seinen. Er verweigert nicht das Brechen des Brotes auch für den, der ihn verraten wird. Dies ist die stille Kraft Gottes: Er verläßt niemals den Tisch der Liebe, auch dann nicht, wenn er weiß, daß er allein gelassen wird.
Liebe Brüder und Schwestern, auch wir dürfen uns heute mit Ehrlichkeit fragen: „Bin ich es etwa?“ Nicht um uns zu beschuldigen, sondern um einen Raum der Wahrheit in unserem Herzen zu öffnen. Die Erlösung beginnt hier: mit dem Bewußtsein, daß wir die vertrauensvolle Beziehung zu Gott zerbrechen können, aber auch wir es sind, die sie wieder aufnehmen, bewahren und erneuern können.
Im Grunde ist das die Hoffnung: zu wissen, daß Gott uns nie verläßt, auch wenn wir versagen. Daß er uns liebt, selbst wenn wir verraten. Und wenn wir uns von dieser Liebe erreichen lassen – demütig, verwundet, aber stets treu – dann können wir wirklich neu geboren werden und beginnen, nicht mehr als Verräter zu leben, sondern als geliebte Kinder.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)