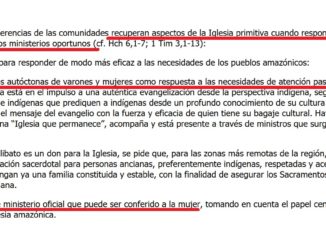Von Roberto de Mattei*
Die Erklärung Fiducia supplicans, die am 18. Dezember 2023 mit Zustimmung von Papst Franziskus vom Dikasterium für die Glaubenslehre herausgegeben wurde, stellt einen der umstrittensten Punkte dieses Pontifikats dar, aber sie markiert auch einen Wendepunkt dank der breiten Reaktion von Kardinälen, Bischöfen und ganzen Bischofskonferenzen, besonders jenen an den „Rändern“, die der Papst so oft als Träger authentischer religiöser und menschlicher Werte beschworen hat.
Der Grund für den Protest ist der Widerspruch, in dem das Dokument mit dem immerwährenden Lehramt der Kirche zu stehen scheint. Die Erklärung lehnt zwar die Rechtmäßigkeit der „Homo-Ehe“ ab, läßt aber die Möglichkeit zu, ein sogenanntes homosexuelles „Paar“ zu segnen, und billigt damit faktisch die Verbindung, die die beiden „Partner“ sündhaft vereint.
Daß das Dokument mehr als zweideutig ist, haben nicht nur die Reaktionen gezeigt, die es ausgelöst hat, sondern auch die Klarstellungen, zu denen sich Papst Franziskus genötigt sah, der bei der Vollversammlung des Dikasteriums am 26. Januar 2024 bekräftigte, „wenn sich ein Paar spontan nähert, um den Segen zu erbitten, segnet man nicht die Vereinigung, sondern einfach die Menschen, die gemeinsam darum gebeten haben“, und in einem Interview mit dem US-Sender CBS am 24. April bestätigte er: „Was ich erlaubt habe, war nicht, die Verbindung zu segnen. Das kann man nicht tun, weil das nicht das Sakrament ist. Ich kann nicht. Der Herr hat es so gemacht. Aber jeden einzelnen segnen, ja. Der Segen ist für alle da. Für alle. Eine gleichgeschlechtliche Verbindung zu segnen, verstößt jedoch gegen das gegebene Recht, gegen das Gesetz der Kirche. Aber jeden Menschen zu segnen, warum nicht? Der Segen ist für alle da. Einige haben sich darüber empört. Aber warum? Alle! Alle!“
Wenn dem so sein sollte, müßte die Erklärung widerrufen oder auf jeden Fall korrigiert werden, denn den beruhigenden Interventionen des Papstes und des Sekretärs des Glaubensdikasteriums steht der Text von Fiducia Supplicans entgegen, in dem es in Nr. 39 heißt: „Wenn ein solches Segensgebet von einem Paar in einer irregulären Situation erbeten wird, wird ein solcher Segen niemals im direkten Zusammenhang mit einer standesamtlichen Feier oder sonst in irgendeiner Verbindung damit erteilt werden können. Dies gilt auch für die Kleidung, die Gesten und die Worte, die Ausdruck für eine Ehe sind. Dasselbe gilt, wenn die Segnung von einem gleichgeschlechtlichen Paar erbeten wird.“
In diese Verwirrung stößt die Studie „Der Dammbruch. Die Kapitulation vor der Homo-Lobby durch Fiducia supplicans“ von José Antonio Ureta und Julio Loredo, zwei führenden Vertretern der internationalen Gesellschaft Tradition, Familie und Privateigentum (TFP), die bereits 2023 mit dem Buch „Der synodale Prozeß. Eine Büchse der Pandora“ für großes Aufsehen gesorgt hatten.
Die Grundthese der neuen Studie ist, daß in den vergangenen Jahrzehnten eine mächtige LGBT-Lobby innerhalb der katholischen Kirche Wurzeln geschlagen und den Damm der kirchlichen Morallehre gebrochen hat. Das Ziel dieser Lobby ist es, eine Änderung des kirchlichen Lehramtes zu erreichen, das Homosexualität unanfechtbar verurteilt. Das ist keine Verschwörungsphantasie. Ureta und Loredo rekonstruieren genau die Homo-Revolution innerhalb der kirchlichen Strukturen, indem sie Namen und Fakten von den 1970er Jahren bis heute anführen. 1986, unter Johannes Paul II., versuchte Kardinal Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation diese Offensive mit seinem Brief an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Seelsorge an Homosexuellen zu stoppen. Weitere Dokumente folgten, aber mit dem Pontifikat von Papst Bergoglio begann der Damm zu brechen. Die Erklärung Fiducia supplicans stellt die Krönung dieses subversiven Prozesses dar.
Der Weckruf von Ureta und Loredo ist wichtig und macht hoffentlich deutlich, wie weitreichend und tief die Korruption innerhalb der Kirche ist, aber angesichts dieses düsteren Bildes stellt sich eine Frage: Was ist zu tun? Die Antwort lautet unserer Meinung nach, daß nur ein göttliches Eingreifen in einer Situation von so schwerwiegendem lehrmäßigem und moralischem Verfall Abhilfe schaffen kann.
In diesem Zusammenhang steht das neue Dokument Normen für das Verfahren zur Beurteilung mutmaßlicher übernatürlicher Phänomene, das vom Dikasterium für die Glaubenslehre am 17. Mai 2024 mit Zustimmung von Papst Franziskus veröffentlicht wurde.
Einige Theologen und Kanonisten haben dieses Dokument kritisiert, weil es den Diözesanbischöfen die Befugnis entzieht, ein zuverlässiges Urteil über gegenwärtige außergewöhnliche Phänomene zu fällen, und diese dem Glaubensdikasterium und letztlich dem Heiligen Vater überträgt. Diese Zentralisierung der Macht ist jedoch nicht das problematischste Element des Textes.
Der entscheidende Punkt scheint hingegen ein anderer zu sein. Wenn es stimmt, daß nur ein außerordentliches Eingreifen der Gnade die Kirche und die gesamte Gesellschaft in eine Situation der Normalität zurückführen kann, ist es notwendig, daß die Seelen der Gläubigen und die Hirten, die sie leiten, für dieses Handeln der göttlichen Vorsehung offen sind.
Die neuen Normen des Glaubensdikasteriums erwecken dagegen den Eindruck, daß die Kirche sich der Möglichkeit entziehen will, ein authentisches übernatürliches Phänomen anzuerkennen. Die drei traditionellen Kriterien, die in der Vergangenheit galten (constat de supernaturalitate, es steht fest, daß es übernatürlich ist; non constat de supernaturalitate, es steht nicht fest, ob es übernatürlich ist; constat de non supernaturalitate, es steht fest, daß es nicht übernatürlich ist) wurden mit dem neuen Dokument des Glaubensdikasteriums durch sechs neue ersetzt, die von der ausdrücklichen Erklärung der Nicht-Natürlichkeit bis zu einem „nihil obstat“ reichen, das aber nichts über den übernatürlichen Charakter des Phänomens aussagt, sondern sich auf die Feststellung seiner geistlichen Früchte beschränkt. Im Mittelpunkt der neuen Normen steht laut La Nuova Bussola Quotidiana Artikel 22 §2: „Der Diözesanbischof wird auch darauf achten, dass die Gläubigen keine der Entscheidungen als Approbation des übernatürlichen Charakters des Phänomens auffassen.“ Seine Arbeit, in Abstimmung mit dem Dikasterium, wird von nun an dem rein pastoralen Aspekt der angeblichen Erscheinungen oder Wunder gewidmet sein, mit der Möglichkeit, zu einem negativen Urteil zu gelangen, aber niemals zu einem positiven, einem bestätigenden Urteil in der Sache.
Zwar hat die Kirche das Eingreifen des Himmels immer erst nach strengen Untersuchungen anerkannt, aber ihre Umsicht ist nicht mit der Skepsis der Ungläubigen zu verwechseln. Der Rationalist lächelt herablassend, wenn man ihn auf Erscheinungen oder Wunder anspricht, denn er lehnt die Gegenwart Gottes in der Geschichte ab. Die Kirche hingegen glaubt an Wunder, weiß aber, daß dies ein Bereich ist, in dem die Menschen sich selbst täuschen können und der Teufel sie täuschen kann. Aus diesen Gründen handelt sie umsichtig, bis das Handeln Gottes feststeht (vgl. Louis Louchet: Theologie der Marienerscheinungen, Borla, Turin 1960, S. 43f). Man kann jedoch nicht ihre Autorität in Frage stellen, mit Gewissheit festzustellen: constat de supernaturalitate.
Die neuen Normen des Glaubensdikasteriums sprechen den Hirten der Kirche die Möglichkeit ab, die Spuren des Eingreifens Gottes in die menschliche Geschichte, wohl wissend, daß die Offenbarung mit dem Tod des letzten Apostels geendet hat, festzustellen. Es wäre jedoch leichtsinnig, diesen unbestrittenen Grundsatz zum Vorwand zu nehmen, um das historische Gewicht der authentischen himmlischen Offenbarungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu ignorieren oder zu unterschätzen. Wie könnte man die himmlischen Botschaften von Paray-le-Monial, Lourdes und Fatima mit einem allgemeinen nihil obstat abtun, um beispielhaft nur Offenbarungen zu erwähnen, deren göttlichen Ursprung die Kirche feierlich anerkannt hat?
Die Gläubigen dürfen angesichts des Übernatürlichen nicht in Gleichgültigkeit verfallen, sondern müssen bereit sein, es zu erkennen und aufzunehmen, denn durch dieses wunderbare Wirken wird Gott einer Welt, die im Sterben liegt, Wahrheit und Leben zurückgeben.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana