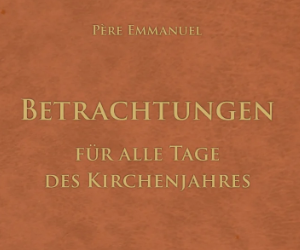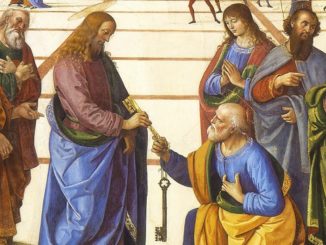Von Roberto de Mattei*
Am 4. Oktober, dem Fest des heiligen Franz von Assisi, wurde die XVI. Ordentliche Bischofssynode zum Thema „Synodalität“ eröffnet. Viele gegensätzliche Äußerungen und Kontroversen gingen der Veranstaltung voraus und begleiten sie. Am 2. Oktober haben fünf Kardinäle, „in Anbetracht verschiedener Erklärungen einiger hoher Prälaten bezüglich der Durchführung der nächsten Bischofssynode, die eindeutig im Widerspruch zur ständigen Lehre und Disziplin der Kirche stehen und die bei den Gläubigen und anderen Menschen guten Willens große Verwirrung hervorgerufen haben – in einem Fall sogar einen Irrtum – und weiterhin hervorrufen“, gegenüber dem Papst ihre „tiefste Besorgnis“ zum Ausdruck gebracht und Papst Franziskus fünf Dubia zu einigen Fragen vorgelegt, die die Auslegung der göttlichen Offenbarung, die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und die Synodalität als konstitutive Dimension der Kirche, die Priesterweihe von Frauen und die Reue als notwendige Bedingung für die sakramentale Absolution betreffen (hier).
Bei den fünf Kardinälen handelt es sich um den Deutschen Walter Brandmüller, den Amerikaner Raymond Burke, den Mexikaner Juan Sandoval Íñiguez, den Guineer Robert Sarah und den Chinesen Joseph Zen Ze-kiun, die wiederum sagen, sie seien sicher, daß auch der verstorbene Kardinal George Pell „diese Dubia teilte und der erste gewesen wäre, der sie unterschrieben hätte“.
Am selben 2. Oktober veröffentlichte das Dikasterium für die Glaubenslehre eine Antwort von Papst Franziskus auf die Dubia, die jedoch auf eine Fassung der Dubia erfolgte, die den genannten vorausging (hier).
Am 10. Juli 2023 übergaben die fünf Kardinäle ihre Dubia an den Papst und den Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Am nächsten Tag, dem 11. Juli, antwortete Franziskus mit einem siebenseitigen Brief auf spanisch. Die Antwort wurde von den fünf Kardinälen als unbefriedigend beurteilt, die am 21. August ihre Dubia so umformulierten, daß der Papst ihnen mit „Ja“ oder „Nein“ antworten mußte, „um eine klare Antwort zu erreichen, die auf der immerwährenden Lehre und Ordnung der Kirche beruht“. Da die fünf Kardinäle keine Antwort erhielten, beschlossen sie am 2. Oktober, ihre Dubia zu veröffentlichen.
Die Chronologie der Ereignisse ist jedoch von untergeordneter Bedeutung. Tatsache ist, daß laut Franziskus sein Brief vom 11. Juli auch die Antwort auf die neuen Dubia vom 21. August sein wollte. Die Antwort des Papstes wirft jedoch noch größere Fragen auf als jene, die die Dubia der Kardinäle hervorriefen. Tatsächlich nutzt der Papst das in Amoris laetitia verwendete Mittel der Dialektik, um der allgemeinen Glaubensregel durch den konkreten Fall zu widersprechen oder sie zumindest zu schwächen. Ein Beispiel dafür ist einer der umstrittensten Punkte, der Segen für homosexuelle Paare. Der Papst scheint zunächst die traditionelle Lehre zu bestätigen, fügt dann aber hinzu, daß unter „bestimmten Umständen“ die Möglichkeit einer Abweichung von der Norm dem Urteilsvermögen der Priester überlassen bleibe. Zumindest wurde seine ambivalente Wortwahl von der internationalen Presse, ohne dementiert worden zu sein, so interpretiert.
Am Vorabend der Synodeneröffnung antwortete das Dikasterium für die Glaubenslehre in ähnlicher Weise auf den emeritierten Prager Erzbischof Dominik Kardinal Duka, der im Namen der Tschechischen Bischofskonferenz zehn Fragen zur Zulassung von wiederverheirateten Geschiedene zu den Sakramenten gestellt hatte. Das Dikasterium antwortete, daß der Papst „in bestimmten Fällen nach angemessener Urteilsfindung“ die Möglichkeit für geschiedene und wiederverheiratete Menschen „einräumt“, zu den Sakramenten zugelassen zu sein, auch ohne die Keuschheit zu wahren, und mit dem Hinweis, daß dies als „ordentliches Lehramt der Kirche“ betrachtet werden müsse (hier).
Angesichts dieser Situation hat jemand angemerkt, daß die Vorlage von Dubia nützlich ist, wenn sie dem Papst ermöglicht, die katholische Lehre klar zu bekräftigen, nicht jedoch, wenn sie zu noch größerer Verwirrung unter den Gläubigen führt. Jemand anderes wandte ein, daß fünf von 242 Kardinälen – so viele zählt das Kardinalskollegium heute – eine unbedeutende Minderheit darstellten. Darüber hinaus bekleidet keiner der fünf Kardinäle verantwortungsvolle Positionen an der Kurie oder in Diözesen und darüber hinaus sind drei von ihnen über neunzig Jahre alt. Andererseits muß jeder zugeben, daß die Dubia vernünftig, gut gegliedert und vor allem im Einklang mit dem immerwährenden Lehramt der Kirche sind. Ihre Bedeutung liegt in dem, was sie bekunden: das Vorhandensein eines starken Unbehagens angesichts des revolutionären Prozesses, der die Kirche angreift.
Es gibt jene, die darauf hingewiesen haben, daß das Dubia-Modell nicht die höchste Form der Meinungsverschiedenheit ist, die man rechtmäßig gegenüber kirchlichen Autoritäten haben kann. Die Correctio filialis vom 16. Juli 2017 stellte den stärksten Ausdruck des Widerstands gegen Papst Franziskus dar, soweit das kanonische Recht dies zuläßt. Doch trotz der großen Wirkung der Correctio filialis ist die Stärke der Dubia viel relevanter, da die Autoren keine Theologen oder Gelehrten, sondern Kardinäle der Heiligen Römischen Kirche sind, direkte Mitarbeiter des Papstes, zu deren Aufgaben die sehr hohe gehört, den Stellvertreter Christi zu wählen. Keine Stimme könnte sich daher verbindlicher äußern. Es sollte auch hinzugefügt werden, daß Kardinal Gerhard Müller, ehemaliger Präfekt der Glaubenskongregation, der von Papst Franziskus zur Teilnahme an der Synode eingeladen wurde, sich öffentlich dazu bekannte (hier), obwohl er nicht zu den Unterzeichnern der Dubia gehört. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß in den kommenden Tagen oder Wochen weitere Kardinäle oder Bischöfe ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen, da, wie Kardinal Burke in seiner Rede am 3. Oktober auf einer Veranstaltung der Nuova Bussola Quotidiana feststellte: „Viele Brüder des Episkopats und auch des Kardinalskollegiums unterstützen diese Initiative, auch wenn sie nicht auf der Unterzeichnerliste stehen“ (hier).
Hervorzuheben ist auch, daß Franziskus die fünf Kardinäle nicht als Rebellen oder Häretiker behandelte, sondern zeigte, daß er ihre Fragen ernst nimmt. In seiner Antwort auf die dritte Frage der Kardinäle wendet sich Franziskus mit einem Anflug von Ironie an diese und stellt fest: „Mit diesen Fragen selbst zeigt ihr euer Bedürfnis, euch zu beteiligen, eure Meinung frei zu äußern und mitzuarbeiten, indem ihr auf diese Weise eine Form von ‚Synodalität‘ in der Ausübung meines Amtes fordert“. Es ist klar, daß es in der „politischen“ Perspektive von Papst Franziskus um die Idee geht, die Synode in ein „Parlament“ der Kirche umzuwandeln, mit Parteien und Strömungen, die sich dialektisch gegenüberstehen, aber es ist auch wahr, daß keine Zensur an dieser Stelle gegen jene zur Anwendung kommen kann, die öffentlich ihre Treue zur Glaubenslehre aller Zeiten zum Ausdruck bringen.
Es gibt auch jene im traditionalistischen Lager, die die Kardinäle dafür kritisieren, daß sie nicht ausdrücklich erklärt haben, daß die Abirrungen der Synode eine Folge der Irrtümer des Zweiten Vatikanischen Konzils sind. Natürlich ist es wahr, daß die Arbeitsgruppe, die die Kardinäle insbesondere bei der Verbreitung ihres Dokuments unterstützt, aus Geistlichen und Laien besteht, die der sogenannten „Hermeneutik der Kontinuität“ folgen. Allerdings bringen die Dubia diese Linie nicht zum Ausdruck, die historisch gescheitert und nicht in der Lage ist, authentischen Widerstand gegen den Prozeß der Selbstzerstörung der Kirche um sich zu sammeln. Sie können vielmehr von einer breiten Gruppe geteilt werden, zu der nicht nur Traditionalisten und Konservative gehören, sondern jeder Katholik, der die Ereignisse der Kirche im Lichte des wahren Glaubens und des gesunden Hausverstandes beurteilt.
Andererseits stellt in diesem Moment der Verwirrung jede Armee ihre Truppen auf und jedes Regiment hißt seine Fahnen. Es ist kein Zufall, daß Erzbischof Carlo Maria Viganò am selben Tag, an dem die Kardinäle ihre „Mitteilung“ veröffentlichten, eine Rede veröffentlichte, in der er seine Überzeugung zur Ungültigkeit der Wahl von Papst Franziskus aufgrund eines „Konsensmangels“ zum Ausdruck bringt. Franziskus, so Msgr. Viganò, soll die Wahl durch Betrug erschlichen haben, mit der Absicht, „das genaue Gegenteil von dem zu tun, was Jesus Christus dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern aufgetragen hat: die Gläubigen im Glauben zu stärken“ (hier).
Zwischen denen, die glauben, daß Franziskus der legitime, wenn auch unwürdige Papst ist, und denen, die ihn für einen Usurpator halten, der mit der Absicht gewählt wurde, die Kirche zu zerstören, gibt es einen Unterschied, der nicht sprachlicher, sondern auch inhaltlicher Natur ist. In dieser Stunde tiefer Trauer für die Kirche besteht eine Kluft zwischen denen, die Franziskus als „Gegenpapst“ betrachten, und denen, die wie der Unterfertigte beten, daß der Herr „non tradat eum in animam inimicorum eius“ [„ihn (Franziskus) nicht dem Haß seiner Feinde übergebe“]. Mittlerweile betreffe in Rom, wie Guido Horst in der Tagespost (hier) schreibt, die Hauptfrage, die sich die versammelten Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinäle stellen, nicht die Themen, die in der Synode diskutiert werden, sondern eine andere: „Wer wird der nächste Papst sein“?
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana