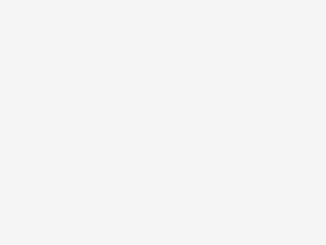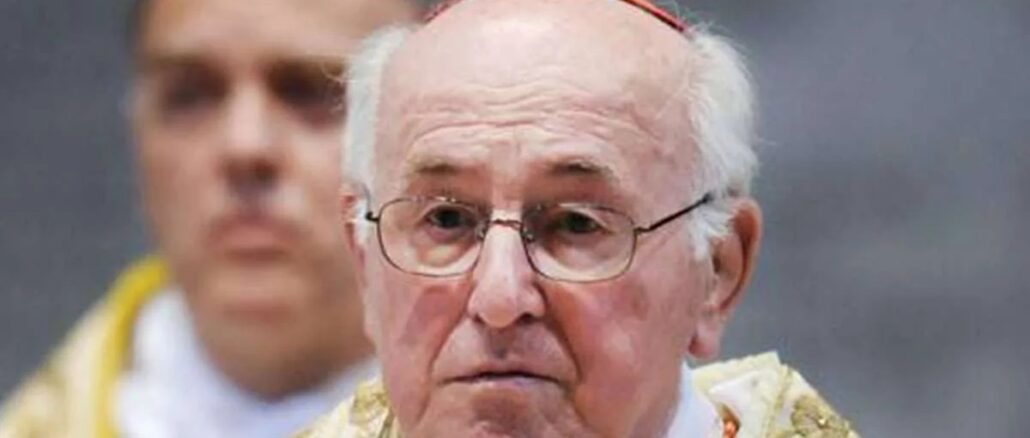
Von Roberto de Mattei*
Zwischen Gnade und Natur besteht eine Beziehung, die der zwischen Glauben und Vernunft entspricht. Es besteht ein Ungleichgewicht, wenn es Glauben ohne Vernunft oder Gnade ohne Natur gibt und umgekehrt, aber das vollkommene Gleichgewicht besteht nicht darin, diese Wirklichkeiten auf die gleiche Stufe zu stellen. Es besteht im Gegenteil darin, sie in ihre legitime Ordnung zu bringen, indem die Natur der Gnade untergeordnet wird, von der erstere die Voraussetzung ist, so wie die Voraussetzung des Glaubens die Vernunft ist, die dem Glauben jedoch untergeordnet ist.
Dies hilft uns zu verstehen, was „Geist des Glaubens“ oder „übernatürlicher Geist“ bedeutet, je nachdem, ob wir uns auf den Vorrang des Glaubens vor der Vernunft oder der Gnade vor der Natur beziehen. Es bedeutet, nicht auf die unverzichtbare Rolle von Vernunft und Natur zu verzichten, sondern alles mit den Augen des Glaubens zu sehen und selbst das Unmögliche vom Wirken der Gnade zu erwarten.
Heute ist dieser Glaubensgeist im christlichen Volk verlorengegangen, angefangen bei seinen kirchlichen Führern. An die Stelle des Geistes des Glaubens und des Übernatürlichen ist der politische Geist getreten, mit dem die Christen behaupten, die Wirklichkeit allein mit der Vernunft zu verstehen und in sie einzugreifen, ohne auf das entscheidende Handeln der Gnade zurückzugreifen.
Papst Franziskus hat wiederholt daran erinnert, daß die wahren Reformer der Kirche die Heiligen sind, doch seine Herangehensweise an die großen Fragen der Welt erscheint immer politisch und daher „weltlich“ und nicht „übernatürlich“ und von einem Geist des Glaubens bewegt. Dieser „politische“ Ansatz beherrschte das jüngste Konsistorium, das am 29. und 30. August in Anwesenheit von etwa 180 Kardinälen im Vatikan stattfand und bei dem eine große Chance vertan wurde, die schwerwiegenden Probleme anzugehen, unter denen die Kirche heute leidet. Im Mittelpunkt des Treffens der Kardinäle stand offiziell die Reform der Kurie, die in der neuen Apostolischen Konstitution Praedicate Evangelium vorgeschlagen wird, aber der Papst hat die Kardinäle daran gehindert, sich in gemeinsamer Sitzung zu diesem und anderen Themen zu äußern, indem er ihnen, wie man sagen muß, einen Maulkorb verpaßt hat.
Das Konsistorium ist eine Zusammenkunft des Papstes mit den Kardinälen, die nach dem Codex des kanonischen Rechts (Kanones 349–359) seine ersten Berater sind. Seit mindestens sieben Jahren hat Papst Franziskus den Kardinälen nicht erlaubt, bei dieser feierlichen Versammlung das Wort zu ergreifen und ihre Meinung zu äußern. Alle hatten erwartet, daß dies bei dem Treffen Ende August geschehen würde, aber das Konsistorium wurde auf Geheiß des Papstes in Sprachgruppen zersplittert, was die Kardinäle lähmt und den offenen und direkten Dialog verhindert, der zuletzt im Februar 2014 stattgefunden hat.
An diese Wahrheit erinnert uns ein bedeutender Kardinal und großer Historiker, Kardinal Walter Brandmüller, dessen Stimme, die man im Konsistoriumssaal nicht hören durfte, außerhalb des Saales widerhallt. Der Vatikanist Sandro Magister hat es uns ermöglicht, sie kennenzulernen, indem er die Rede veröffentlichte, die der Kardinal vorbereitet hatte, aber nicht halten durfte.
Kardinal Brandmüller erinnert in seinem Dokument an die im Kirchenrecht verankerte Funktion der Kardinäle, die in der Antike ihren symbolischen Ausdruck im Ritus der „aperitio oris“, der Öffnung des Mundes, fand. Ein Ritus, erklärte der Kardinal, der „die Pflicht bedeutete, seine Überzeugung, seinen Rat offen auszusprechen, besonders im Konsistorium. Diese Offenheit – Papst Franziskus spricht von ‚parrhesía‘ – war dem Apostel Paulus besonders wichtig. Im Moment ist diese Offenheit leider durch ein seltsames Schweigen ersetzt worden. Die andere Zeremonie des Mundschlusses, die auf die ‚aperitio oris‘ folgte, bezog sich nicht auf Glaubens- und Sittenwahrheiten, sondern auf Amtsgeheimnisse“.
„Heute jedoch“, fügte Kardinal Brandmüller hinzu, „sollten wir das Recht, ja die Pflicht der Kardinäle betonen, sich klar und offen zu äußern, gerade wenn es um die Wahrheiten des Glaubens und der Moral, das ‚bonum commune‘ der Kirche, geht. Die Erfahrungen der letzten Jahre waren ganz anders. In den Konsistorien – die fast nur für die Heiligsprechungsprozesse einberufen wurden – wurden Karten verteilt, um um das Wort zu bitten, und natürlich folgten spontane Interventionen zu jedem beliebigen Thema, und das war’s. Es gab nie eine Debatte, einen Austausch von Argumenten zu einem bestimmten Thema. Offensichtlich ein völlig unnützes Verfahren“, obwohl der Primat des Nachfolgers Petri keineswegs „einen brüderlichen Dialog mit den Kardinälen ausschließt, die verpflichtet sind, mit dem Papst gewissenhaft zusammenzuarbeiten“ (can. 356). Je schwerwiegender und dringlicher die Probleme der pastoralen Leitung sind, desto notwendiger ist die Beteiligung des Kardinalskollegiums“.
Der Kardinal, der Kirchenhistoriker ist, fährt fort:
„Als Coelestin V. im Jahr 1294, als er die besonderen Umstände seiner Wahl erkannte, auf das Papsttum verzichten wollte, tat er dies nach intensiven Gesprächen und mit Zustimmung seiner Wähler. Eine völlig andere Auffassung von der Beziehung zwischen Papst und Kardinälen vertrat Benedikt XVI., der – ein einmaliger Fall in der Geschichte – ohne Wissen des Kardinalskollegiums, das ihn gewählt hatte, aus persönlichen Gründen auf das Papstamt verzichtete. Bis Paul VI., der die Zahl der Wahlmänner auf 120 erhöhte, gab es nur 70 Wahlmänner. Diese Vergrößerung des Wahlkollegiums auf fast das Doppelte war durch die Absicht motiviert, der Hierarchie der von Rom weit entfernten Länder zu entsprechen und diese Kirchen mit dem römischen Purpur zu ehren. Die unvermeidliche Folge war, daß Kardinäle eingesetzt wurden, die keine Erfahrung mit der römischen Kurie und damit mit den Problemen der pastoralen Leitung der Weltkirche hatten. Das alles hat schwerwiegende Folgen, wenn diese Kardinäle aus der Peripherie zur Wahl eines neuen Papstes aufgerufen sind.“
Derzeit ist es so, daß:
„(…) viele, wenn nicht sogar die Mehrheit der Wähler sich nicht kennen. Dennoch sind sie da, um den Papst zu wählen, einen von ihnen. Es liegt auf der Hand, daß diese Situation es Operationen der Kardinalsgruppen oder ‑klassen erleichtert, einen ihrer Kandidaten zu bevorzugen. In dieser Situation kann man die Gefahr der Simonie in ihren verschiedenen Formen nicht ausschließen.“
Das Dokument des Kardinals schließt mit einem Vorschlag:
„Schließlich scheint mir, daß die Idee, das Stimmrecht im Konklave zum Beispiel auf die in Rom residierenden Kardinäle zu beschränken, ernsthafte Überlegungen verdient, während die anderen Kardinäle den ‚Status‘ der über achtzigjährigen Kardinäle teilen könnten.“
Klare, unmißverständliche Worte, die das gesamte Kardinalskollegium zum Nachdenken bringen sollten.
Die Weigerung von Papst Franziskus, den Kardinälen das Wort zu erteilen, ist auf die politische und weltliche Perspektive seines Pontifikats zurückzuführen. Er fürchtet, daß eine freie und offene Diskussion die Ausübung seiner Macht schwächen könnte, da er sich nicht bewußt ist, daß die Wahrheit der Kirche und den ihr unterstellten Seelen niemals schaden kann. Der Geist des Glaubens, der dem Geist der Politik entgegengesetzt ist, besteht gerade darin, in allen Dingen das zu suchen, was am höchsten und erhabensten ist, was der Ehre Gottes und dem Wohl der Seelen am meisten entspricht, indem man sich stets nach den Geboten des Evangeliums richtet.
Die Alternative ist die zwischen der Wahrheit des Evangeliums und der Macht der Welt. Die Wahrheit des Evangeliums zu verkünden bedeutet nicht, über Einwanderung oder den Klimanotstand zu sprechen, sondern über die Novissima – Tod, Gericht, Himmel und Hölle – und die göttliche Vorsehung, die alle Ereignisse des geschaffenen Universums regelt. Das Evangelium zu verkünden bedeutet, mit der Stimme der Kirche die Sünde zu verurteilen, insbesondere die öffentliche Sünde, an erster Stelle die Abtreibung und die LGBT-Doktrinen, die von der Welt als „bürgerrechtliche Errungenschaften“ betrachtet werden. Es bedeutet, von der Heiligkeit und nicht von der Synodalität zu sprechen, denn von der Heiligkeit und nicht von den politischen Mechanismen geht die notwendige Reform (Erneuerung) im Inneren der Kirche aus: eine Erneuerung der Menschen, die sie bilden, und nicht ihrer göttlichen und unveränderlichen Verfassung.
Nun hat sich ein Mantel des Schweigens über das Konsistorium gelegt. Und das Schweigen derer, die sprechen sollten, ist die größte Strafe, die unser Herr seiner Kirche auferlegen kann.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017 und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana