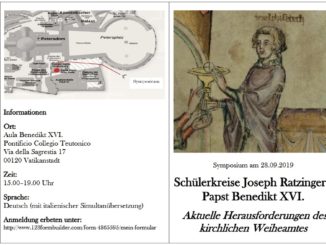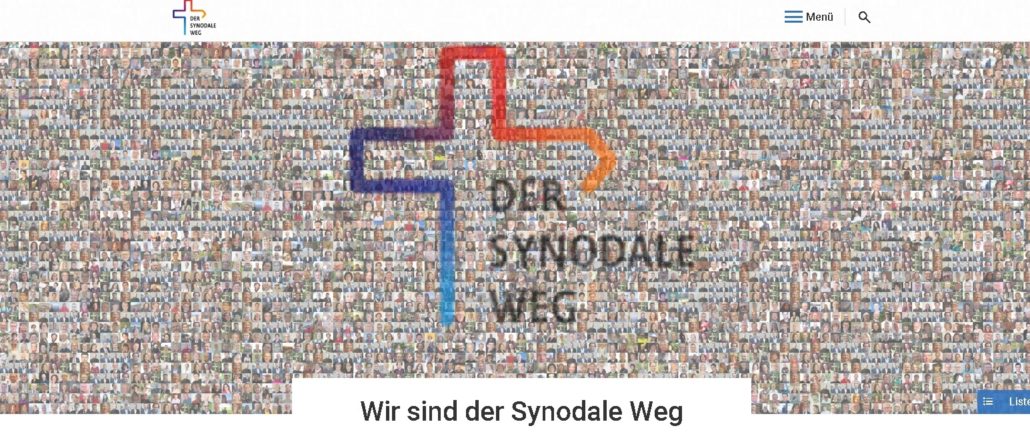
Das Coronavirus hat den „Synodalen Weg“ von Deutscher Bischofskonferenz (DBK) und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) schlagartig vergessen lassen. Die Bischofskonferenz ist damit beschäftigt, sich der Regierung anzudienen und diese zu kopieren mit Pinzettenkommunion und Altarraummaskerade. Der „Synodale Weg“, vor allem das Dokument Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, wird vom Religions- und Kultursoziologen Pietro De Marco einer Analyse unterzogen. Die drei Hauptherausforderungen, die der „Synodale Weg“, also die Deutsche Bischofskonferenz und der Verbandskatholizismus, an die Kirche richtet, lauten „Sex, Frauen, Macht“, so Prof. De Marco. Hier seine Analyse, die er dem Vatikanisten Sandro Magister übermittelte.
Der „Synodale Weg“ – der beispiellos abschüssige Weg der deutschen Kirche
Von Pietro De Marco*
Die deutschen Bischöfe scheinen sich dessen nicht bewußt zu sein, aber der von ihnen eingeschlagene „Synodale Weg“, der darauf abzielt, „die Kirche von unten zu entscheiden“, ist auch der Weg des Eintauchens und der Auflösung der Kirche – als Institution und als Souverän – in der demokratischen Zivilgesellschaft und ihrem Wertemagma.
Lassen sie mich gleich sagen, daß die mehr als mediokre Qualität der Texte, die eine so ernsthafte Entscheidung begleiten, nur zu bedauern ist. Und ich spreche nicht von Theologie, auf die man sich zwar vielfach beruft, die aber keineswegs zufällig die große Abwesende ist. Die Arbeitspapiere der Vorbereitungsforen sind „politisch“ im üblichen Wortsinn: Es sind Aktionsinstrumente. Ihre rhetorischen Ressourcen sind jene, die bei jedem Vorstoß zur „Demokratisierung“ einer in sich nicht demokratischen Institution eingesetzt werden, wie die Kirche „de iure divino“ eine ist. Das wahre Gesicht dieser erklärtermaßen subversiven Aktion sind die Organisation der Synode, ihre Zusammensetzung, die Repräsentativität und die Verfahrensregeln. Der „Synodale Weg“ ist eine Kriegsmaschine und zugleich eine Vorwegnahme ihrer Ergebnisse: die Neuverteilung der Macht und ihre neuen Akteure – aktive und passive.
Im Vorwort des vorbereitenden Forums zu „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“, das im September 2019 genehmigt und dann am 20. Januar 2020 aktualisiert wurde, lesen wir:
„Die Leitfrage lautet: Wie kann die Kirche in der Welt von heute das Evangelium glaubwürdig in Wort und Tat verkünden?“
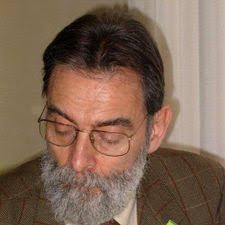
Demnach sollte man also auf der Grundlage eines externen Kanons über ein „Wie“ des Glaubens entscheiden. Wann aber wurde jemals der christliche Glaube unter den Bedingungen weltlicher „Glaubwürdigkeit“ gepredigt? Was ist mit dem „Skandal des Kreuzes“, zu dem der theologische Nihilismus heute den Mund so voll nimmt? War er an sich „glaubwürdig“? Oder in welchem Sinne und wie haben ihn die großen Apostel und die Glaubensboten aller Zeiten „glaubwürdig“ gemacht? Haben sie sich an die Plausibilitätsregeln der Meinungen und Sitten ihrer Zeit angepaßt?
Daß der „Synodale Weg“ nichts mit der Ordnung des Glaubens und der christlichen Tradition zu tun hat, enthüllt bereits die Arbeitsmethode, die nicht nur erwünscht ist, sondern auferlegt wird:
„Der Gesprächs- und Entscheidungsprozess bedarf einer Atmosphäre geistiger Offenheit. Es darf keine Tabus geben, keine Angst vor Alternativen, keine Sanktionen.“
Und weiter:
„Es müssen Reformszenarien entworfen werden, die prozessual realisiert werden können.“
Also ein gutes „Brainstorming“ auf die Kirche und konkrete Vorschläge zum Wohl des Unternehmens. Wir sind ja in Zeiten der „Start-ups“. Zur Kundenbindung werde es notwendig sein, wie im Dokument allerdings zugegeben wird, daß die Texte „deutlich spürbar einen theologischen Geist atmen, der die jeweiligen Überlegungen in das Ganze eines reflektierten Glaubens einbettet“. Der theologische Atem hat jedoch diesen Tenor:
„Die Kritik zielt auf ein in Deutschland weitverbreitetes Kirchenverständnis, das sich durch eine Aufladung des Weiheamtes als ‚heilige Gewalt‘ (sacra potestas) auszeichnet, eingebunden in eine Hierarchie, in der einseitig die Gläubigen von Priestern als abhängig gesehen werden. Diese institutionelle Ordnung verdankt sich aber weniger einer katholischen Notwendigkeit als vielmehr einem antimodernen Affekt.“
Abgesehen von der merkwürdigen Vorstellung, daß die „sacra potestas“ ein deutscher Exzeß sei, fällt es hier schwer, die historische und theologische Unwissenheit von der Fälschung von Tatsachen und Lehren zu unterscheiden. Der priesterliche Dienst wurde von der „sacra potestas“ weder überladen noch überlastet, da sie ihm wesenseigen ist, außer, das Priestertum wäre ein Nichts wie für die Protestanten.
Der gläubige Laie ist kein „Angestellter“ des Priesters, sondern „ecclesia discens“ [lernende Kirche], die sich als solche von der „ecclesia docens“ [lehrende Kirche] unterscheidet, wie es vom Gesetz und von der Spiritualität der Kirche geregelt ist. Diese Ordnung, die sich in ihrer höchsten Form von der „caelestis hierarchia“ herleitet, ist konstitutiv für die große Kirche sowohl des Ostens als auch des Westens. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit antimodernen Kulturen zu tun. Auch Max Weber erkannte diese Einzigartigkeit, die geniale Dialektik einer charismatischen Institution.
1
Symptomatisch für die Verwirrung des „Synodalen Weges“ ist folgende These, die als Leitsatz behauptet wird:
„Die Krise ist nicht von außen in die Kirche hineingetragen worden, sondern in der Kirche selbst entstanden. Sie resultiert aus starken Spannungen zwischen der Lehre und der Praxis der Kirche, aber auch zwischen der Art und Weise, wie Macht in der Kirche ausgeübt wird, und den Standards einer pluralen Gesellschaft in einem demokratischen Rechtsstaat, deren Berücksichtigung viele Katholikinnen und Katholiken auch in ihrer Kirche erwarten.“
Es ist offensichtlich, daß bestimmte Erwartungen der katholischen Gläubigen durch eine Projektion von Formen und Zielen der heutigen westlichen Gesellschaft auf die Strukturen und das Wesen der Kirche hervorgerufen werden. Aber um Gerechtigkeit und Rechte in der Kirche zu gewährleisten, gibt es das Kirchenrecht. Daß in Fällen von Pädophilie die ausschließliche Geltung des Kirchenrechts zu perversen Effekten geführt hat, teils zum Gegenteil des Erwarteten, stellt für Kanonisten ein echtes Problem dar. Die zivilrechtliche Entschädigungsklage nicht vorgesehen zu haben, ist eine sogenannte Rechtslücke. Sie rechtfertigt jedoch weder ein innerkirchliches Lynchen von Priestern und Bischöfen noch anti-institutionelle Proklamationen. Sie verlangt vielmehr neben dem Mut, den theologischen und moralischen Verfall der christlichen Bildung in den letzten Jahrzehnten zu analysieren, viel juristische Arbeit in der Institution und für die Institution.
In dem Dokument heißt es zudem, daß der Synodenprozeß „von Partizipation, Transparenz und Gleichberechtigung geprägt sein muß“. Die „Gleichberechtigung“ meint hier nicht ein präzises Recht, wie im kanonischen Verfassungsrecht, sondern erhebt den Anspruch, an den endgültigen Entscheidungen – von theologisch bis organisatorisch – mit dem Gewicht der Stimme teilzunehmen. Was hier offen auf die Tagesordnung gesetzt wird, ist sowohl der Wahlcharakter der kirchlichen Vollmachten als auch das aktive und passive Wahlrecht sogenannter „Randschichten“, marginalisierter Gruppen.
Diese kirchlichen Pseudo-Schichten, die „Frauen“ und die „Laien“, sind in Wirklichkeit bereits mächtig, im „Synodalen Weg“ sogar entscheidend. Es genügt, sich die Zusammensetzung der Versammlung anzuschauen. Sie schlagen sich also aus einer Position der Stärke heraus selbst zum Zweck der Machtübernahme als zu emanzipierende Subjekte vor, indem sie auf unlautere Weise mit der Waffe der Pädophilie die priesterliche und hierarchische Institution als Ganzes angreifen.
Nicht jeder weiß, daß die Grundlage des gegenwärtigen Anstiegs an Macht- und Druckkapazität des kritischen Laientums der „MHG-Effekt“ ist, also die Auswirkungen der Erforschung des sexuellen Mißbrauchs, den die Deutsche Bischofskonferenz den Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen anvertraute.
Es handelt sich um eine umfassende interdisziplinäre Untersuchung, die vom forensischen Psychiater Harald Dressing geleitet und vom 1. Juli 2014 bis 24. September 2018 auf der Grundlage von Daten aus den 27 deutschen Diözesen durchgeführt wurde. Das Ergebnis lastet in seinem diagnostischen und prognostischen Teil die sexuellen Skandale der klerikalen Institution der Kirche als solcher an. Es muß aber gesagt werden, daß die deutschen Bischöfe sich die enormen Kosten sparen hätten können, übrigens über eine Million Euro, wenn das Ergebnis nur – vorhersehbar – die prätentiöse Bestätigung von Dingen, die der Kirche bereits bekannt waren, sowie von Vorurteilen und Gemeinplätzen sein sollte.
Organisierte Laiengruppen und die dominierende theologische Klasse haben im MHG jedoch ein perfektes trojanisches Pferd zur Hand bekommen, das es ihnen ermöglicht, in der Kirche die Institution göttlichen Rechts anzugreifen, indem sie jede theologische Tatsache und jede Sichtweise des übernatürlichen Glaubens, wie ernsthaft sie auch begründet sein mag, einfach beiseiteschieben.
Nur wenige haben heute den Mut zu sehen, daß die Verbindung zwischen Macht, priesterlichem Zölibat und Sexualmoral, die in der deutschen Synode unter Beschuß steht, „systemisch“ korrumpiert wurde, seit die bischöfliche Autorität aufgehört hat zu lehren und zu sanktionieren. Der Zölibat wurde in der Priesterausbildung an den Fakultäten und in den Priesterseminaren diskreditiert, und die Sexualmoral wurde gerade von jenen verlacht – Geistlichen und Laien –, die keusch sein sollten. Genau das geschah unmittelbar nach dem Konzilsende und in den 1970er Jahren, als die Geistlichen und Ordensgemeinschaften ausbluteten. Die Hunderten von Personen, ich nehme an gläubige Menschen, die den „Synodalen Weg“ auf seinen verschiedenen Ebenen bilden, sollten nicht einmal daran denken, auf unlautere Weise einer Institution, deren Majestät und Tiefe sie nicht einmal kennen, die verwerflichen Verhaltensweisen anzulasten, für die sie selbst nicht weniger verantwortlich sind als die Generationen, die seit den 60er Jahren vor ihnen Verantwortung getragen haben.
2
„Die Reformagenda braucht eine klare Analyse der ambivalenten Machtphänomene in der katholischen Kirche (…).
– Die Ästhetik der Macht zeigt sich in der Liturgie, aber weit darüber hinaus im Erscheinungsbild der katholischen Kirche.
– Die Rhetorik der Macht zeigt sich in der Verkündigung und der Katechese, in den öffentlichen Erklärungen, aber weit darüber hinaus in der Sprache der Kirche und des Glaubens.
– Die Pragmatik der Macht zeigt sich in den Organisations- und Kommunikationsformen, den Personalstrukturen und Entscheidungsprozessen, aber weit darüber hinaus in der sozialen, kulturellen und politischen Gestalt der Kirche.“
Hinter diesem extremen, aber geschickt kalkulierten und organisierten Angriff gegen die katholische Institution durch Kleriker und Laiengruppen, die zur „Intelligencija“ mutiert sind, steht eine Geschichte der intellektuellen und soziologischen Metamorphose in der Zusammensetzung des Lehrkörpers an den theologischen Fakultäten. Eine „Intelligencija“, genährt von religiösem Pragmatismus und demokratischer öffentlicher Ethik, kurz gesagt von der Ideologie von Meinungsgruppen, die sich selbst als Regierungspartei der Weltkirche sehen. Daher rühren auch der Identitätsverlust und das Verschwinden einer solchen Kirche in der Gesamtheit der Gruppierungen der pluralistischen Demokratie, wie ich anfangs andeutete.
Eine sorgfältige Lektüre der Stellungnahmen und der Dokumente des Zentralkomitees der deutschen Katholiken – eines mächtigen Laienvertreterapparats, der bereits in den siebziger Jahren Einfluß auf die Würzburger Synode hatte und jetzt beim „Synodalen Weg“ mit den Bischöfen sogar gleichberechtigt ist – würde die Rolle dieser Meinungsgruppe beim Einknicken der bischöflichen Hierarchie verdeutlichen. Es ist ein politikwissenschaftliches Theorem, daß die Machtentwertung durch kritische Gruppen immer deren bewußte Suche nach Macht verbirgt. Es ist hinzuzufügen, daß im deutschen Sprachraum dieser Druck seit Jahrzehnten auch auf die Organisation „Wir sind Kirche“ zurückgeht. Unter den früheren Pontifikaten angemessen in Schach gehalten, ist es ihr mit dem „Synodalen Weg“ gelungen, sich in einen Wahlkörper und eine Versammlungsfraktion zu verwandeln.
3
Was seine Rechtmäßigkeit angeht, steht der „Synodale Weg“, so wie er konstituiert ist, auf unsicherem Boden. Sicher illegal sind aus dogmatischer Sicht seine Absichten, da sie eindeutig „schismati faventes et in errorem inducentes“ sind, also das Schisma fördern und in den Irrtum führen. Der ideologische und organisatorische Rahmen, der sich abzeichnet, ist bei weitem schwerwiegender für die Kirche als andere, die in der Vergangenheit verurteilt wurden.
Dies ist der Fall, wenn das Dokument gebieterisch erklärt:
„Geschlechtergerechtigkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung und eine Querschnittsaufgabe, die auf allen Ebenen verwirklicht werden muss. Die Frage der Zugangsvoraussetzungen zu den pastoralen Diensten, auch zum Amt des Diakons, Priesters und Bischof, kann nicht ausgeschlossen, sondern muss thematisiert werden.“
Die scheinbare Zurückhaltung im letzten Satz („muss thematisiert werden“) kann niemand hinters Licht führen. Man will irreversible Entscheidungen treffen. Eine naive Utopie einer zukünftigen Kirche tilgt das Wesen der Kirche, in Christo und in jedem Getauften. Es ist mit Nachdruck zu sagen: In dem Maß, in dem die deutsche Kirche mit einer selbstmörderischen Rhetorik gegen die Macht und das Priestertum trunken geht und eine Beute von nicht mehr katholischen Eliten ist, ist sie als Kirche – mystischer Leib Christi und Sakrament in Ihm und für Ihn – nur mehr eine leere Larve.
Erinnert sich Papst Franziskus seiner Pflicht, „confirmare fratres suos“? Und daran, daß confirmare stärken heißt und wenn notwendig auch bedeutet, die Kirche im wahren Glauben wiederherzustellen? Wird er dafür Sorge tragen, „oder müssen wir auf einen anderen warten“?
*Pietro De Marco, emeritierter Professor der Soziologie an der Universität Florenz und an der Hochschule für Religionswissenschaften in Florenz mit dem Schwerpunkt Religions- und Kultursoziologie. Als promovierter Philosoph befaßt er sich zudem mit der europäischen Ideengeschichte der Renaissance und der frühen Neuzeit sowie dem jüdischen, frühchristlichen und islamisch-mittelalterlichen Denken. 2015 gehörte er anläßlich der zweiten Familiensynode zu den Erstunterzeichnern des Internationalen Appells an den Papst zur Zukunft der Familie.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: synodalerweg.de/MiL (Screenshot)
Siehe zu Pietro De Marco auch:
- Die Seuche der Banalität – Gedanken zu den kirchlichen Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie
- Die Umbettung der sterblichen Überreste von General Franco – und das Geschichtsbewußtsein
- Das Interview als neue Form päpstlicher Enzykliken? – Größere Reichweite bei geringerer Verbindlichkeit?