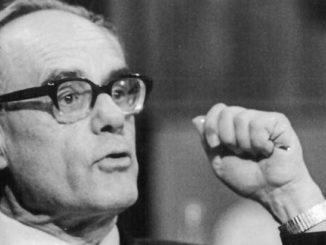Von Pietro De Marco*
In der globalen Situation der gerade stattfindenden Pandemie fehlt jede Spur einer Intervention der Kirche als „Mater et Magistra“, die ihrer universellen Mutterschaft und ihrem Lehrauftrag gerecht wird.
In Italien, dem derzeit von der Coronavirus-Pandemie am meisten betroffenen Land, konnte das auch dank der Stellungnahmen – mit unterschiedlichen Akzenten – von Marcello Veneziani, Massimo Introvigne, Gianfranco Brunelli von der Zeitschrift Il Regno und Enzo Bianchi vom Kloster Bose beobachtet werden. Das jahrelange fromme Kirchengeschwätz über Sauerteig, Evangelisierung und Prophetie stolpert auf ganzer Länge über das unerwartete Hindernis einer Epidemie, die mit einem Schlag alles zwischen Leben und Tod dramatisiert und vertikalisiert.
Diese Sprachlosigkeit und Sprechunfähigkeit wird gegen alle Hoffnung noch verschärft durch die Ideologie von einer Kirche als „prophetischer Minderheit“, die zwangsläufig utopisch sein muß und ein schwacher Ersatz für die Ecclesia militans, die streitende Kirche, ist.
Auch das rührende Gebet von Erzbischof Mario Delpini auf dem Dach zwischen den Türmen des Mailänder Doms vermittelte keinen Willen zu Autorität und Bestimmtheit auf dem Stuhl des heiligen Ambrosius! Das zeigte schon die kleine, fast private Art und Weise, wie sich der Prälat den Kameras und der Welt präsentierte, anstatt die angemessene liturgische Kleidung zu tragen. Ich verstehe natürlich, daß Soutane und Pileolus ausreichen für ein Debüt mit „O mia bela Madunina“ („Oh, meine schöne, kleine Madonna“, ein 1934 komponiertes, volkstümliches Lied – kein Kirchenlied –, das in lombardischer Mundart die Marienstatue auf dem Dom, vor allem aber Mailand besingt, einschließlich der Aussage „Die ganze Welt ist ein Dorf“) anstelle eines „Recordare Domine testamenti tui et dic angelo percutienti cesset iam manus tua ut non desoletur terra. Et ne perdas omnem animam viventem“, wie es im Introitus zur Missa pro vitanda mortalitate vel tempore pestilentiae heißt, „Gedenke, Herr, deines Bundes, und sage zu dem Engel, der das Verderben bringt: Deine Hand höre auf, damit die Erde nicht verödet wird. Und damit du nicht jede lebende Seele vernichtest“ (2 Sam 24, 16).
Am meisten zählt aber, daß die Anrufung des Erzbischofs von Mailand, wie inzwischen fast überall in der Kirche, von zwischenmenschlichen Empfehlungen mit christlicher Etikette dominiert wurde. Man solle freundlich, großzügig und gastfreundlich sein. Was aber fehlte, war eine grundsätzliche historisch-heilsrelevante Sichtweise. Gott wird nur schwach als Angesprochener sichtbar. Selbst die Anrufung Mariens, die von den Bischöfen noch eher praktiziert wird, hat manchmal mehr den Geschmack, ein Zugeständnis wegen ihrer Volkstümlichkeit zu sein, mehr etwas, das wir im Herzen tragen, als eine Überzeugung des Intellekts. Der öffentliche Kult für Gott, auch der durch Maria, ist aber λογικός (logikós)[1].
Man komme nun nicht und sage, daß das der neue, irreversible Stil der Kirche ist. Dieser Stil offenbart vielmehr eine dramatische Angst, vor allem in der kirchlichen Welt, vor dem Zeugnis der „Mater et Magistra“, wie es in der Tradition der Kirche immer praktiziert wurde. Zudem läßt es den Mangel an Glauben an das Votivgebet, an die feierlich vorgebrachten Fürbitten sichtbar werden.
Wer war bisher zur Vertikalität fähig? Wo bleibt die Offenheit, Worte der Umkehr und der Buße zu erheben, wo doch selbst die Fastenzeit ihre tägliche Übung auferlegt?
Das geschieht sicherlich durch viele einfache Menschen, die in der Lage sind, die Fürsprache Mariens und der Heiligen um göttlichen Schutz zusammen mit der Vergebungsbitte anzurufen. Es geschieht sicher in Orden, die ihrem Charisma treu geblieben sind, und in den Klausurklöstern, die standhalten.
Gewiß, sogar Papst Franziskus hat, verspätet, etwas getan, das aber nicht ausreicht, um den Menschen zu zeigen, wie sie sich unter dem unbekannten, aber immer vorsehenden Willen Gottes zurechtfinden können. In seinem Interview mit La Repubblica vom 18. März findet sich nur ein kleiner Hinweis, so wichtig er auch sein mag:
„Ich habe den Herrn gebeten, die Epidemie zu stoppen.“
Doch der andere Ansatz:
„Alle sind Kinder Gottes und von Ihm beachtet“,
verdünnt alles in einem zu menschlichen Ersatz der „guten Dinge, an die er [der Mensch] glaubt (auch jene, die nicht an Gott glauben)“ und der „Liebe der Menschen, die er um sich hat“.
Die zeitgleich veröffentlichte Stellungnahme von Kardinal Camillo Ruini im TG2 der RAI ist reicher und expliziter:
„Wir sollen glauben, daß wir nicht allein sind, weil der Christ weiß, daß der Tod nicht das letzte Wort hat. Es muß gesagt werden, wenn wir von Hunderten von Toten sprechen. Deshalb ist der auferstandene Christus unsere große Hoffnung.“
Und so fügt er der allgemeinen Ermahnung zur Wiederentdeckung alltäglicher Zuneigungen hinzu:
„Die Wiederentdeckung unserer Beziehung zum Herrn geht in die gleiche Richtung.“
Dazu noch ein besonderer Gedanken an die Einsamkeit der Sterbenden auf der Intensivstation:
„Wir hoffen, daß die Menschen, die dort sind, ein gutes Wort zu ihnen sagen, daß sie durch sie das Gefühl haben, nicht verlassen zu werden. Und vor allem möchte ich zum Herrn beten, damit sie das Gefühl haben, daß Er nahe ist und auf sie wartet, wie der Vater im Gleichnis auf den verlorenen Sohn gewartet hat.“
Aber weithin geht das Denken der kirchlichen Hierarchie und der Menschen in Richtung einer verbreiteten und wahrnehmbaren Zurückhaltung beim Beten. Der Christ, der in das „Leben“ oder in das Nichts der Mystik oder in die Unsichtbarkeit eingetaucht ist, findet weder Worte des Gebets noch weiß er, an wen er sie richten kann.
Andererseits, was ist aus dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geworden, der der kalten theologischen Analyse unterzogen wurde? Dieser Gott ist zu einer Art Ideal geworden, und der moderne Christ ist damit beschäftigt, ihn von den „Flecken“ des Gerichts, des Zorns und der Bestrafung zu säubern, um aus ihm etwas Süßliches zu machen.
Kurzum: „Gott hat nichts damit zu tun“. Darüber hinaus gibt man sich auch noch der Illusion hin, daß Gott aus unseren historischen Tragödien herauszuhalten nicht nur respektvoll, sondern sogar eine ausgezeichnete Apologetik sei.
So war es aber noch nie. Die Beziehung zwischen Gott und dem Leiden der Menschen ist ein wesentlicher Bestandteil der religiösen Reflexion, von den antiken Tragödien bis zu den wichtigsten christlichen Denkern. Das zu wissen, hält uns auf der Ebene des Mysteriums des Menschen, denn sonst rutscht alles in Richtung Sinnlosigkeit ab.
Abgesehen davon: Wer würde je in der Not einen Gott anrufen, der „nichts damit zu tun hat“? Und in der Tat wird er auch nicht angerufen.
Man schlage aber die Klagepsalmen auf, die Psalmen der Not und der Prüfungen, und verkünde mit lauter Stimme den Psalm 88:
Herr, mein Gott und Retter,
Tag und Nacht schreie ich zu dir!
Laß mein Gebet zu dir dringen,
höre meinen Hilferuf!
Ich habe mehr als genug gelitten,
mit einem Fuß stehe ich schon im Grab.
Alle meinen, mit mir sei es aus;
die Kräfte schwinden mir,
ich kann nicht mehr.
Man hat mich aufgegeben wie einen Toten;
mir geht es wie den Erschlagenen,
die man ins Massengrab geworfen hat –
du sorgst nicht mehr für sie,
deine Hilfe erreicht sie nicht mehr.
In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt,
wo ewige Dunkelheit mich einschließt.
Dein Zorn drückt mich zu Boden,
in schweren Wogen rollt er über mich hin.
Meine Freunde hast du mir entfremdet,
sie wenden sich voll Abscheu von mir ab.
Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg;
vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen.
Tag für Tag schreie ich zu dir, Herr,
und strecke meine Hände zu dir aus!
Tust du auch für Tote noch Wunder?
Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen?
Erzählt man im Grab von deiner Güte,
in der Totenwelt von deiner Treue?
Weiß man dort in der Finsternis noch,
welche Wunder du tust für dein Volk?
Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran,
wie treu du deine Zusagen einlöst?
Ich aber schreie zu dir, Herr;
jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten.
Warum hast du mich verstoßen, Herr?
Warum verbirgst du dich vor mir?
Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah.
Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen,
sodaß ich fast an dir irrewerde.
Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm,
deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich.
Sie bedrohen mich von allen Seiten,
täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten.
Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet;
mein einziger Begleiter ist die Finsternis.
In Wahrheit hat der Herr die Christen, die Katholiken, durch die neue Seuche der Banalität noch nicht wirklich geschlagen. „Ich bin versunken im Schlamm des Abgrunds und habe keinen Halt mehr“, ruft Psalm 69. Einigen gefällt diese Schwäche, und dem Gebet um Erlösung setzen sie ein „cupio dissolvi“ entgegen, einen Wunsch, sich „aufzulösen“, der mit der Demütigung Christi verwechselt wird. Aber die Brücke, die vom Leiden zum „Domine exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat“ („Herr, erhöre mein Gebet, und laß mein Rufen zu dir kommen!“, Psalm 101, 2) führt, verlangt einen Seinswillen gegen die nihilistische Selbstaufgabe und danach, das Böse zu identifizieren und zu verurteilen.
Wir haben bereits über Jahrzehnte erlebt, daß eine Kirche, die sich als bloße „Ergänzung der Seele“ versteht (sie ist viel mehr und ist, um genau zu sein, genau das nicht), sich unvermeidlich verirrt. Jeder Bezug auf die Person, der nicht in der Göttlichen Offenbarung gründet und seinen Bedeutungshorizont nicht findet, ist nichts als eine fragile und rhetorische humanistische Annahme.
Und noch etwas: Es ist nicht wahr, was viel zu oft gesagt wird, daß „wir Gott in unseren Brüdern lieben“, denn ohne die Erfüllung des ersten Teils („Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben“, Matthäus 22, Markus 12) des Ersten und höchsten Gebots, wird auch der zweite Teil („und deinen Nächsten wie dich selbst“) zwangsläufig allzu menschliche, illusorische oder unangemessene Formen hervorbringen. Für alles gilt der Beginn von Psalm 127, den man gar nicht vergessen kann:
„Wenn nicht der Herr das Haus baut,
mühen sich umsonst, die daran bauen.
Wenn nicht der Herr die Stadt behütet,
wacht umsonst, der sie behütet.“
Es kann nicht entgehen, daß heute das Ziel der „Erneuerung der Gesellschaft“ moralistisch und mit unbestimmten Begriffen das Laienideal der Consecratio mundi ersetzt, die – wenn auch eingeschränkt – im Zeitalter des Zweiten Vatikanischen Konzils eine gewisse Kontinuität und Kohärenz mit dem heilssakramentalen Moment und mit der Universalität der Kirche als Stadt Gottes auf Erden wahrte.
Eine wirkliche biblisch-prophetische Minderheit ist eine Realität in Dialektik mit dem auf die Ökumene ausgeweiteten Volk Gottes. Niemals fällt das Volk Gottes, nicht einmal als Rest Israels, mit dem Kreis des Propheten zusammen. Die katholische Kirche, die katholische Kirchensphäre kann nicht mit der Sekte zusammenfallen, d. h., mit der kleinen Gruppe der Auserwählten, die jetzt eher „Retter“ als Gerettete sind. Tausend prophetische Minderheiten, auch die wünschenswerten, sind nicht die Catholica, die potentiell aus der Mehrheit der Menschen besteht (in Übereinstimmung mit der Missio), die in der Gemeinschaft des mystischen Leibes zusammengehalten wird.
Nur das Wissen, mitverantwortlich zu sein in der Kirche, der Unendlichkeit der gewöhnlichen Menschen, vor allem der Getauften, kann dem Klerus und der Hierarchie Worte geben. Die Worte sind die der tausendjährigen heiligen Geschichte. Heute müßten es Bitten um Hilfe und Bußhandlungen sein, begründet in dem Gott, der erschafft und erhebt. Die Worte der Utopie hingegen, die stolz im Mythos von der Zukunft begründet sind, in dem noch nicht Existierenden, das allein Sinn gibt, erschöpfen sich schnell und kläglich.
Die große zeitgenössische Seuche lehrt, daß wir uns von den Fallen kirchlicher Rhetorik befreien müssen, die uns in capite et in membris, an Haupt und Gliedern, ersticken. Diese Rhetorik verfügt weder über Flügel noch über einen tiefergehenden Blick. Sie ist sichtlich unfähig zu etwas anderem als zu tröstlichem und wohlwollendem Gerede. Um solche Worte von sich zu geben, war es mit Sicherheit nicht notwendig, daß die Liebe Gottes sich im Schmerz und in der kosmischen Kraft offenbarte, die wir zu Ostern feiern werden.
*Pietro De Marco, Professor der Soziologie an der Universität Florenz und an der Hochschule für Religionswissenschaften in Florenz mit dem Schwerpunkt Religions- und Kultursoziologie. Als promovierter Philosoph befaßt er sich zudem mit der europäischen Ideengeschichte der Renaissance und der frühen Neuzeit sowie dem jüdischen, frühchristlichen und islamisch-mittelalterlichen Denken. 2015 gehörte er anläßlich der zweiten Familiensynode zu den Erstunterzeichnern des Internationalen Appells an den Papst zur Zukunft der Familie.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: MiL
Siehe zu Pietro De Marco auch:
- Die Umbettung der sterblichen Überreste von General Franco – und das Geschichtsbewußtsein
- Das Interview als neue Form päpstlicher Enzykliken? – Größere Reichweite bei geringerer Verbindlichkeit?
[1] Hier zitiert Prof. Pietro De Marco den heilige Paulus im Römerbrief (12. Kapitel): „Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst.“ Das griechische Original lautet „τὴν λογικήν λατρείαν“ (tèn logikén latreían), auf Latein – so auch im Römischen Kanon der Messe – mit „rationabile obsequium“ wiedergegeben. Eine „großartige, unumgängliche biblische und liturgische Exegese dieser Formel“, so der Vatikanist Sandro Magister, findet sich in der Katechese von Benedikt XVI. bei der Generalaudienz vom 7. Januar 2009.