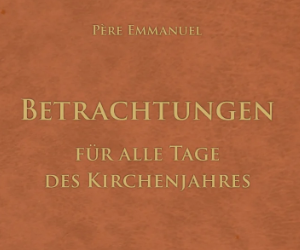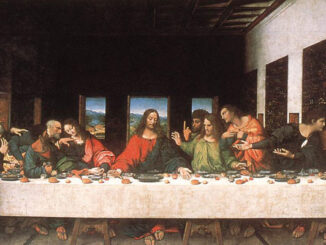(Washington) Die Roratemesse ist fester Bestandteil des Advents. Die Ankunft des Herrn, seine Geburt zu Bethlehem, wird in der überlieferten Form des Römischen Ritus mit der kleinen Fastenzeit vorbereitet.
Ein besonderes Charakteristikum der Roratemesse ist der Eröffnungsvers aus dem Buch Jesaja 45,8:
Rorate caeli, desuper,
et nubes pluant justumTauet ihr Himmel, von oben herab,
Wolken regnet den Gerechten.
Ein weiteres Merkmal ist, daß sie am frühen Morgen – und früher nur am frühen Morgen – vor dem Sonnenaufgang bei Kerzenschein zelebriert wird. Die Menschheit harrt in der Finsternis auf ihren Erlöser wie die klugen Jungfrauen beim Licht der Laternen. Sie erwartet den Aufgang der Sonne, Christus, die „Sonne der Gerechtigkeit“.
Die Entstehung des Rorateamtes verliert sich in ältester Zeit. Als entscheidender Impuls gilt das Mariendogma der Gottesgebärerin, das 451 verkündet wurde.
Die Roratemesse ist liturgisch eine Votivmesse zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria, für die im überlieferten Ritus das Meßformular vom Fest Mariä Verkündigung verwendet wird. Das Evangelium berichtet daher die Verkündigung des Herrn an Maria durch den Erzengel Gabriel. Die daher auch Engelamt genannte Roratemesse wurde ursprünglich an den Samstagen gefeiert.
In der Literatur werden als ältester Beleg wiederholt das 15. Jahrhundert und die deutschen Alpenländer genannt. In der Tat waren und sind die Rorateämter vor allem im bayerisch-österreichischen Raum sehr beliebt und waren früher vor allem für Meßintentionen besonders begehrt. Daher wurde für mehrere Diözesen die Erlaubnis erteilt, sie an allen Tagen feiern zu können.
 In Wirklichkeit ist die Tradition im deutschen Sprachraum aber wesentlich älter. Bereits im Advent 1362 wurden in Halberstadt, damals Sitz eines Bischofs, im Dom allmorgendlich Rorateämter zelebriert. Da die täglichen Zelebrationen „jüngeren“ Datums sind, und es sich in Halberstadt damals bereits um eine konsolidierte Praxis gehandelt zu haben scheint, läßt sich eine deutlich ältere Entfaltung erahnen.
In Wirklichkeit ist die Tradition im deutschen Sprachraum aber wesentlich älter. Bereits im Advent 1362 wurden in Halberstadt, damals Sitz eines Bischofs, im Dom allmorgendlich Rorateämter zelebriert. Da die täglichen Zelebrationen „jüngeren“ Datums sind, und es sich in Halberstadt damals bereits um eine konsolidierte Praxis gehandelt zu haben scheint, läßt sich eine deutlich ältere Entfaltung erahnen.
Zur besonderen Tradition der deutschen Alpengegenden gehörte es bis zur Liturgiereform, das Rorateamt vor dem ausgesetzten Allerheiligsten zu zelebrieren. Entsprechende Belege lassen sich in Tirol und Salzburg bis vor wenigen Jahrzehnten zahlreich finden.
Zu den Widersprüchen der Liturgiereform von 1970 gehört es, daß die Roratemesse zwar nicht abgeschafft, aber in vielen Gegenden faktisch verschwunden ist.
Das Priesterseminar Our Lady of Guadalupe der Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP) in Denton in den USA veröffentlichte Photos vom Rorateamt, das die Seminaristen am Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe, der Seminarpatronin, feierten.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: fsspolgs.org