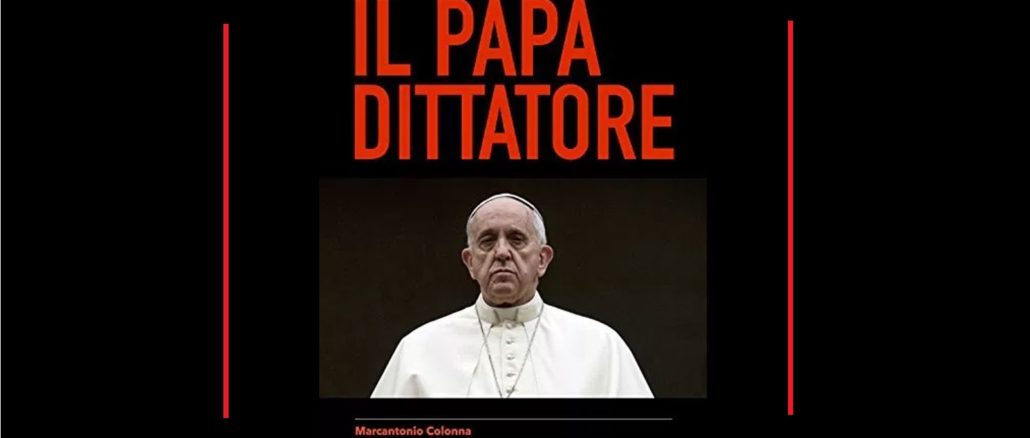
Von Roberto de Mattei*
In den vergangenen Wochen sind drei Interviews von ebenso vielen, herausragenden Kardinälen erschienen. Das erste gab Kardinal Walter Brandmüller am 28. Oktober 2017 Christian Geyer und Hannes Hintermeier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das zweite erfolgte am 14. November durch Edward Pentin vom National Catholic Register mit Kardinal Raymond Burke. Und das dritte von Kardinal Gerhard Müller mit Massimo Franco wurde am 26. November vom Corriere della Sera veröffentlicht.
Kardinal Brandmüller zeigte sich beunruhigt über die Möglichkeit einer Spaltung in der Kirche.
„Ich habe große Sorge, dass etwas explodiert. Die Leute sind ja nicht dumm. Allein der Umstand, dass eine Bittschrift mit 870.000 Unterschriften an den Papst mit der Bitte um Klärung, dass fünfzig Gelehrte von internationalem Rang ohne Antwort bleiben, wirft in der Tat Fragen auf. Das ist doch wahrlich schwer zu begreifen.“
Und weiter:
„‚Dubia‘, also Zweifel, Fragen an den Papst zu richten, war immer schon ein Verfahren, um Unklarheiten zu beseitigen. Völlig normal. Sodann: Es geht hier, vereinfacht gesagt, um die Frage: Kann heute etwas gut sein, was gestern Sünde war? Außerdem wird gefragt, ob es wirklich – so eben die beständige Lehre – Handlungen gibt, die immer und unter allen Umständen sittlich verwerflich sind? Wie zum Beispiel die Tötung eines Unschuldigen – oder auch der Ehebruch? Darauf läuft es hinaus. Sollte nun in der Tat die erste Frage mit Ja und die zweite mit Nein beantwortet werden – dann, ja dann wäre dies Irrlehre und in der Folge Schisma. Spaltung der Kirche.“
Kardinal Burke, der sagte, in ständigem Kontakt mit Kardinal Brandmüller zu stehen, formulierte eine neue Warnung wegen „der schwerwiegenden Situation, die nicht aufhört, sich zu verschlimmern“. Er bekräftigte erneut die Notwendigkeit, Licht in alle heterodoxen Stellen von Amoris laetitia zu bringen. Wir erleben nämlich einen Prozeß, der „einen Umsturz der wesentlichen Teile der Tradition“ darstellt.
„Abgesehen von der Moraldebatte zerbröselt in der Kirche das Verständnis für die sakramentale Praxis immer mehr, besonders was das Bußsakrament und das Altarsakrament betrifft.“

Der Kardinal wandte sich erneut an Papst Franziskus und die ganze Kirche, indem er betonte, „wie dringend es ist, daß der Papst in der Ausübung seines vom Herrn empfangenen Amtes seine Brüder im Glauben stärkt, durch eine klare Bekundung der Lehre über die christliche Moral und der Bedeutung der sakramentalen Praxis der Kirche.“
Kardinal Müller seinerseits bestätigte, daß es die Gefahr eines Schismas in der Kirche gibt und daß die Verantwortung für die Spaltung weder bei den Kardinälen liegt, die Dubia zu Amoris laetitia haben, noch bei den Unterzeichnern der Correctio filialis an Papst Franziskus, sondern beim „magischen Zirkel“ des Papstes, der eine offene und ausgewogene Diskussion über die von dieser Kritik aufgeworfenen, doktrinellen Probleme unterbindet.
„Achtung: Wenn der Eindruck einer Ungerechtigkeit der Römischen Kurie aufkommen sollte, könnte sich allein schon aus Trägheit eine schismatische Dynamik in Bewegung setzen, die dann nur mehr schwer aufzuhalten ist. Ich bin überzeugt, daß die Kardinäle, die Zweifel zu Amoris laetitia geäußert haben, oder die 62 Unterzeichner eines Schreibens mit auch überzogener Kritik am Papst, anzuhören und nicht wie ‚Pharisäer‘ oder Nörgler abzutun sind. Der einzige Weg, aus dieser Situation herauszukommen, ist ein klarer und aufrichtiger Dialog. Stattdessen habe ich den Eindruck, daß im ‚magischen Zirkel‘ des Papstes solche sind, die sich vor allem darum sorgen, den Spitzel gegen angebliche Gegner zu machen und eine offene und ausgewogene Diskussion zu verhindern. Alle Katholiken nach den Kategorien ‚Freund‘ oder ‚Feind‘ des Papstes einzuteilen, ist der größte Schaden, den sie der Kirche zufügen. Man ist perplex, wenn ein bekannter Journalist sich als Atheist rühmt, der Freund des Papstes zu sein, und gleichzeitig ein katholischer Bischof und Kardinal wie ich als Gegner des Heiligen Vaters diffamiert wird. Ich meine, daß diese Personen mit keine theologischen Lektionen über den Primat des römischen Papstes erteilen können.“
Kardinal Müller hat, laut seinem Interviewer, „die Wunde“ noch nicht verdaut, daß drei seiner Mitarbeiter entlassen wurden, kurz bevor er selbst im vergangenen Juni nicht in seinem Amt bestätigt wurde.
„Das sind gute und kompetente Priester, die mit vorbildlicher Hingabe für die Kirche gearbeitet haben. Personen können nicht einfach ad libitum weggeschickt werden, ohne Beweise und ohne Prozeß, nur weil jemand anonym vage Kritik am Papst denunziert hat, die einer von ihnen geäußert habe…“
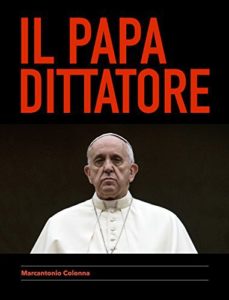
Wie nennt sich ein Regime, unter dem Menschen auf diese Weise behandelt werden? Damian Thompson schrieb es am vergangenen 17. Juli in The Spectator: Die Entlassung der Mitarbeiter von Kardinal Müller „läßt einige seiner autoritäreren Vorgänger in den Sinn kommen, oder vielmehr manchen lateinamerikanischen Diktator, der die Massen umarmte und einen einfachen Lebensstil zur Schau stellte, während seine Statthalter in Angst vor seinen Zornesausbrüchen lebten“.
Dieser Aspekt des Pontifikats von Papst Franziskus ist nun Gegenstand eines Buches, das soeben erschienen ist und den Titel „Der Papst-Diktator“ (Il Papa dittatore) trägt. Der Autor ist ein Historiker mit einer Ausbildung in Oxford, der sich hinter dem Namen „Marcantonio Colonna“ verbirgt. Der Stil ist nüchtern und gut dokumentiert, aber seine gegen Papst Bergoglio erhobenen Vorwürfe sind hart und zahlreich.
Viele der Elemente, auf die er sich stützt, um seine Anschuldigungen zu formulieren, waren bereits bekannt. Neu ist aber die akkurate Rekonstruktion einer Reihe von „historischen Rahmen“: die Hintergründe der von der „Mafia von Sankt Gallen“ gesteuerten Wahl von Papst Bergoglio; die argentinischen Angelegenheiten Bergoglios vor seiner Wahl; die Hindernisse, die Kardinal Pell in den Weg gelegt wurden, als er den Versuch einer Finanzreform der Kurie unternahm; der Umbau der Päpstlichen Akademie für das Leben; die Verfolgung der Franziskaner der Immakulata und die Köpfung des Souveränen Malteserordens.
Die Massenmedien, die sonst bereit sind, mit Empörung jede Episode einer schlechten Verwaltung und der Korruption zu prügeln, schweigen zu diesen Skandalen. Das Hauptverdienst dieser historischen Studie liegt darin, sie ans Licht gebracht zu haben.
„Die Angst, zusammen mit dem gegenseitigen Verdacht, beherrscht die Kurie unter dem Diktat von Franziskus. Es geht nicht nur um Informanten, die den Vorteil suchen, indem sie private Gespräche hinterbringen – wie die drei Mitarbeiter von Kardinal Müller feststellen mußten. In einer Organisation, in der moralisch korrupte Personen auf ihren Posten bleiben oder von Papst Franziskus sogar befördert werden, ist die hinterhältige Erpressung an der Tagesordnung. Ein Priester der Kurie meinte dazu ironisch: ‚Man behauptet, daß es nicht zählt, was man kann, sondern wen man kennt. Im Vatikan ist es so: Es zählt, was man über den weiß, den man kennt‘.“

Das Buch von Marcantonio Colonna bestätigt, was im Interview von Kardinal Müller angedeutet wird: Die Existenz eines Klimas des Spitzelwesens und des Denunziantentums, für die der ehemalige Glaubenspräfekt den „magischen Zirkel“ verantwortlich macht, der die Entscheidungen des Papstes bedingt, während der Oxford-Absolvent sie dem modus gubernandi von Papst Franziskus zuschreibt, den er mit den autokratischen Methoden des argentinischen Diktators Juan Peron vergleicht, dessen Anhänger der junge Bergoglio war.
Man könnte antworten: Nihil sub sole novum (Koh 1, 10). Die Kirche hat schon ganz andere Gebrechen in der Regierung erlebt. Wenn dieses Pontifikat aber wirklich zu einer Spaltung unter den Gläubigen führt, wie die drei Kardinäle betonen, können die Gründe nicht nur auf die Art der Regierung eines Papstes reduziert werden, sondern müssen in etwas gesucht werden, was die Kirchengeschichte noch nicht gekannt hat: Die Trennung des römischen Papstes von der Lehre des Evangeliums, die er kraft Göttlichen Auftrags zu bewahren und weiterzugeben hat. Das ist das Herzstück des religiösen Problems unserer Zeit.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana/Wikicommons/MiL





Die Trennung des römischen Papstes von der Lehre des Evangeliums!
Ist es nicht, was die Muttergottes in La Salette prophezeit hat: Rom wird den Glauben verlieren. Das Schisma ist doch schon Tatsache!
Nicht nur die Prophezeiungen von La Salette, auch die von Clemens Brentano aufgezeichneten visionären Schauen der sel. Anna Katharina Emmerick oder die dem hl. Philipp Neri zugeschriebenen (ominösen?) Maleachi-Weissagungen sowie eine Reihe anderer ähnlicher Phänomene führen auch bei nüchternen Beobachtern zu nachdenklichen Blicken auf das gegenwärtige Pontifikat. Im Zusammenhang mit den Gerichtsreden Jesu sind sie sogar von geradezu beklemmender Aktualität. Doch kein Grund zu unbegründeten Ängsten oder gar zur Verzweiflung – jedenfalls nicht für jene (angeblich Einfältigen), die das Evangelium des vergangenen Sonntags von der Scheidung der Böcke von den Schafen vielleicht sogar ernst nehmen.
Zweimal habe ich das „habemus papam“ live am Bildschirm mitverfolgt. Schon eine Weile vor dem ersten Auftritt Benedikts XVI. auf der Loggia von San Pietro war ich damals von tiefer Ergriffenheit erfasst worden. 2013 war das ganz anders. Ich hatte schon im Voraus ein Gefühl der Skepsis, ja sogar ein Kälteempfinden, welches sich beim ersten Auftritt des neuen Papstes dann sogar noch verstärkte.
War diese Wahl ein Geschehnis wider den Heiligen Geist? Gut vorstellbar, dass sich beim einen oder anderen der damaligen Papstwähler inzwischen das Gewissen recht heftig meldet.
Ihren Ausführungen möchte ich mich anschließen, auch und gerade was die spirituelle Ergriffenheit betrifft.
Sicherlich ist die jüngste Papstwahl nicht „gegen den Heiligen Geist“, sondern – wie Sie selbst schreiben – , Ausdruck der sich erfüllenden Zeit.
Können wir nicht in Anlehnung an Lk 24,26 sinngemäß sagen: „Musste nicht die Kirche all das erleiden, um so in ihre Herrlichkeit zu gelangen?“
Ich frage mich, wie Card. Müller in Bezug auf diese „Zirkel“ das „magisch“ gemeint hat. Überhaupt schon das Wort Zirkel. Gut, ich weiß jetzt nicht in welcher Sprache das Gespräch geführt wurde und ob er selbst in deutsch „Zirkel“ sagte. Oder ob ein Übersetzer hier etwas suggerieren wollte – mehr als der Card. sagte. Aber schon „Zirkel“ wäre auffällig für jemanden, der aktiv bewußt Begriffe verwendet oder die Verwendung unterläßt. Aber dann noch dieses „magisch“. Praktizieren diese Zirkel Magie? Also irgendwelche okkulten Praktiken oder satanische Riten? So wie es auch Maleachi Martin in „Der letzte Papst“ beschrieb? Oder ist das magisch eher im übertragenen Sinne gemeint? Soll es eher nur undurchsichtig, diffus, nicht konkret benennbar usw. heißen?
Wurde er entlassen, weil er etwas wußte oder mitbekommen hat, was er nicht sollte. War das auch der eigentliche „Fehler“ der anderen Entlassenen?
Sind die abrupten Stimmungswandel von Papst Franz vielleicht Hinweise z.B. auf Umsessenheit?
Fragen über Fragen. Beten wir um Abkürzung der Drangsal, denn wenn die Tage dieser Drangsal nicht abgekürzt würden…Mt24,22
Dieses Pontifikat gleicht einem erreichten Tiefpunkt in der Geschichte der Kirche.
Man wundert sich nicht nur über einen gewählten Papst, der selbst gar kein Papst sein will, dafür aber umso kräftiger jene Autorität einsetzt, und diese geflisstentlich so weit überzieht, dass es einem die Sprache verschlägt.
Man fragt sich, wie sehr die römische Kirche in ihrem Inneren in Schieflage geraten sein muss, wenn ein Mann wie Bergoglio Bischof und Kardinal werden konnte, obwohl er ganz offensichtlich sich selbst jahrzehntelang im falschen Film fühlte? Jemand, der das Papstamt als solches ablehnt, wie kann ausgerechnet er zum Papst erkoren werden? Jemanmd, der mit weiten Teilen der Lehre dieser Kirche, in der er hohe Ämter bekleidete, ein ernsthaftes Problem zu haben scheint, was soll ausgerechnet jener an der Spitze dieser Institution? Kann sich irgendein Konzern derartiges schadlos leisten?
Wo wird denn etwas zählbar Tragfähiges an Stelle des Abgebrochenen aufgebaut? Es ist ein gigantisches Abbruchunternehmen, und die Zahlen beweisen das auch noch. Man räumt ab, was die Kirche erhält.
Die doppelte Moral des Papstes zeugt von dem unredlichen Willen, der das Konklave 2013 durch und durch begleitet hat. Die Personen, die es zu verantworten haben, daß die Kirche in der derzeitigen Situation ist, sind größtenteils schon tot und die es ablehnen, die Verantwortung für die „Correctio et fraterna et paternalis et filialis zu sorgen, also für die Heilung an Haupt und Gliedern, sind genau die, die am Konklave 2013 teilgenommen haben, ausnahmslos alle! Sobald als bekannt wurde (zwischen dem 2. und 3. Wahlgang), daß das Konklave den Mindestanforderungen nicht mehr entspricht, hätte es auf Antrag dimittiert werden sollen und die entsprechenden kanonischen Aufgaben erfüllt werden sollen, daß das neue Konklave tatsächlich impeccabilis et infallabilis ist. Dazu gehört der Ausschluß und die Exkommunikation derjenigen Kardinäle, die sich gegen das göttliche Recht gesetzt haben, das Heilige Konklave, Sub Sigilio zu halten. Und dieses wortwörtlich. Es ist dem Kardinaldekan und dem Camerlengo erlaubt „nach draußen zu fragen, ob die Siegel unerbrochen sind“ und das ist sogar deren Pflicht.
Aber wenn man sich vorher in clandestinen Zirkeln getroffen hat, um Wahlkapitel zu erstellen und schon weit vor dem Beginn des Konklave, ja sogar weit vor Beginn der Sedisvakanz Summo Pontifice Romano Regente Absprachen und taktische Übereinkünfte für eine zukünftige Papstwahl und den Sturz des rechtmäßig amtierenden Papstes zu treffen, wie das in Mainz am 18. 10. 2011 geschehen ist anläßlich der Verabschiedung von Prof. Michael Sievernich als Lehrstuhlinhaber des Pastoraltheologielehrstuhls der JOGU in Mainz, wo S Emm. Lehmann und Bergoglio anwesend waren, sowie alles, was im Jesuitenorden Rang und Namen hatte. Sätze wie „Der Alte muß weg“ (Der „Alte“ war niemand anderes als Papst Benedikt XVI), der Aufruf zum Ungehorsam („Das Memorandum muß von der DBK unterstützt werden“ (S. Em. Karl Lehmann) und der offene Widerstand („Die Wandlungsworte bleiben so, wie sie sind!“) etc. sprechen für sich; man könnte noch mehr bringen!
Wenn Bergoglio der italienischen Mafia den Krieg erklärt hat und diese exkommunizieren will, so ist das ein Krieg von Mafiosi unter sich, dem die Gläubigen genauere Aufmerksamkeit widmen sollten. Der Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia reicht bis in den Vatikan hinein. S. Ex. Erzbischof Scicluna weiß es, sie war ja selbst aus einer sehr katholischen Familie, ein Verwandter von ihr war Erzbischof von Malta – Mauro Caruana (Damals noch Bischof von Malta)! Und hier solle eigentlich jedem klar werden, wo sich der Vatikan im Moment befindet. Das Vorgehen von Papst Franziskus gegen seine Mitarbeiter am Heiligen Stuhl und am Apostolischen Stuhl ist exakt das Vorgehen der argentinischen Peronisten und zeigt offen diktatorische Züge wie jüngst in der „Vatikanbank“ geschehen. Wäre ich Ex. Gänswein, würde ich in die USA fliehen und dort um politisches Asyl bitten, weil mein Leben nach dem Ausscheiden aus dem Amt nicht mehr sicher sein wird. Der Tod von S. Em Caffarra sei allen eine Warnung!
Was die Stimmungswandel des Papstes angeht, sind diese rein psychologisch zu erklären und können historisch am besten bei Richard Nixon nachgespürt werden. Hierzu empfehle ich die Lektüre von den Henry Kissinger „Memoiren“ Bd. 2 1973–1974 (München 1979 dt.) und von Carl Bernstein/Bob Woodword „The last Days“ Washington 1976.
Also es ist hochpolitisch und weniger spirituell gesehen brisant, was sich in der Kirche ereignet. Ein Mafiosi ist Papst, nicht mehr und nicht weniger. Das mu0 aufgedeckt werden und dann können die Gründe und Fallindizien aufgearbeitet werden, zuerst kriminalistisch, dann Kanonisch und schließlich dogmatisch. Wir brauchen endlich ein Instrumentarium, um einem solchen häretischen Papsttum ein sicheres Ende setzen zu können, ohne den Geruch von „Liberalismus“, „Verschwörung“ etc…
Schließlich bedarf es der Buße und der Sühneleistung aller Gläubingen!
Roma, Roma, Convertere ad Dominum deum Tuum!