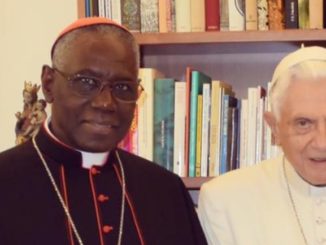(Warschau) Polens Bischöfe haben nun formalisiert, was sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hatte: Sie sagen „Nein“ zur Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene. Damit stellen sie sich offen gegen die Linie von Papst Franziskus, ohne dies aber zu sagen. Darin liegt die Schwäche ihrer ansonsten starken Position, mit der sie die direkt und indirekt die Argumente der Dubia und der Correctio filialis stützen.
Der polnische Episkopat weist die Möglichkeit zurück, daß Personen, die sakramental gültig verheiratet sind, aber mit einer anderen Person in einer standesamtlichen, neuen Verbindung leben, zur Kommunion zugelassen sind. Das sei ein Widerspruch, der nicht überwunden werden könne. Dasselbe, so die Bischöfe, gilt für jede irreguläre Verbindung.
Bruchlinie an der Oder
Die Polnische Bischofskonferenz faßte bei ihrer Herbstvollversammlung in Lublin klare Beschlüsse. Sie betreffen die Umsetzung des umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia. Während Papst Franziskus in seinem Bistum Rom, die bundesdeutschen Bischöfe, die Bischöfe von Malta und in der Kirchenprovinz von Buenos Aires sowie einige US-Bischöfe sogenannte „wiederverheiratete Geschiedene“ zu den Sakramenten zulassen, weisen die Bischöfe Polens eine solche Möglichkeit zurück.
Polens Bischöfe bekräftigen damit die überlieferte kirchliche Lehre.
Amoris laetitia, so die Bischofskonferenz, könne nur in der Kontinuität der kirchlichen Ehe- und Sakramentenlehre verstanden und umgesetzt werden. Ein anderer Weg sei unmöglich. Damit stellen sie sich eindeutig gegen Papst Franziskus und dessen „possibilistische“ Haltung. Das ist deshalb möglich, weil Franziskus es konsequent meidet, Farbe zu bekennen. Daß er durch seinen Kurs, den er seit der Einberufung der Familien-Doppelsynode im Herbst 2013 verfolgt, das Ehesakrament schwächt, die Unauflöslichkeit der Ehe durch „Ausnahmen“ in Frage stellt und faktisch Scheidung und Zweit- oder Drittehe in die Kirche einführt, wurde vom Kirchenoberhaupt weder bestätigt noch dementiert.
Durch einen Primat der Praxis wird unausgesprochen diese Änderung jedoch vollzogen. Es sollen, so die offenkundige päpstliche Strategie, vollendete Tatsachen geschaffen werden. Neben einer umstrittenen inhaltlichen Frage, wirft das auch die Frage einer zweifelhaften Methodik auf.
Entscheidung der polnischen Bischöfe von besonderer Bedeutung
Die Entscheidung der Polnischen Bischofskonferenz ist für die Weltkirche von besonderer Bedeutung. Sie widerlegt die Papst-Vertrauten, die den Kardinälen der Dubia (Zweifel) vorgeworfen haben, Zweideutigkeiten herbeizureden, da Amoris laetitia „völlig“ auf dem Boden der kirchlichen Lehre stehe. Kardinal Schönborn bezeichnete Amoris laetitia als „vollkommen orthodox“, Papst Franziskus als „thomistisch“.
Die polnischen Bischöfe bestätigen die Sorgen der Dubia-Kardinäle, die davor gewarnt haben, daß Amoris laetitia die Kirche spalte, indem ein Verhalten in einem Land weiterhin Sünde ist, im Nachbarland aber nicht mehr. Genau das ist nun vor aller Augen zur Tatsache geworden. In Polen gilt weiterhin als Sünde, was die Kirche immer als Sünde gelehrt hatte, während das für die Deutsche Bischofskonferenz nicht mehr gilt und die Sünde des Ehebruches, zumindest in bestimmten Situationen, keine mehr ist. An der Oder verläuft eine bedenkliche Bruchlinie durch die Kirche, für die Deutschlands Bischöfe verantwortlich sind.
Durch Amoris laetitia ist die Sünde in manchen Ländern verboten in anderen hingegen zum „optional“ geworden.
Klärungsbedarf
Auch die Erklärung der Polnischen Bischofskonferenz ist allerdings nicht unproblematisch, da sie das Auseinanderklaffen bei Franziskus zwischen Wort und Tat grundsätzlich akzeptiert, um im eigenen Sinn den Schein einer ungebrochenen Kontinuität behaupten zu können.
Sie bestätigt einerseits die Argumente der Dubia und der Correctio filialis. Andererseits muß sie sich eines Drahtseilaktes bedienen, der selbst nicht von Zweideutigkeiten frei ist. Denn wenn ihre Position, die überlieferte Lehre der Kirche ist, und daran besteht kein Zweifel, dann irren Papst Franziskus und die bergoglianischen Bischöfe. Und sie irren nicht nur in der praktischen Umsetzung von Amoris laetitia. Auch einige Stellen in Amoris laetitia, auf die sich die bergoglianische Umsetzung stützt, müssen dann irrig sein. Dann aber wäre das auch deutlich zu sagen. Beide Seiten, Franziskus und die bundesdeutschen Bischöfe auf der einen und die polnischen, kanadischen und andere Bischöfe auf der anderen Seite können sich nicht gleichzeitig mit konträren Positionen auf Amoris laetitia stützen. Entweder oder. Die Logik verbietet es, daß zwei gegensätzliche Positionen sich auf dasselbe Papier berufen können. Erst recht nicht, wenn der Autor unzweideutig einer Position zuneigt und diese fördert. Hier herrscht Klärungsbedarf.
Darin lag auch die Schwachstelle in der Argumentation von Kardinal Gerhard Müller, solange er Präfekt der Glaubenskongregation war. Er wollte es vermeiden, Franziskus, weil Papst, auch nur irgendwie zu kritisieren. Sollte Franziskus aber irren, dann muß er dafür kritisiert werden. Das ist ein Liebesdienst und ein unverzichtbarer Dienst an der Wahrheit.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: InfoVaticana