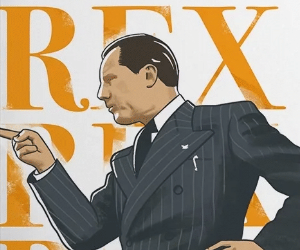Kommentar von Ryan Bach
(New York) Mark Zuckerberg, der Gründer und Haupteigner von Facebook, kündigte an, einen Weg gefunden zu haben, um die Verbreitung von „Falschmeldungen“ auf seinem sozialen Netzwerk zu verhindern. Die linken („liberals“) Medien in den USA jubeln. Beobachter haben Zweifel, ob es funktioniert, und Kritik befürchten eine neue Form von Zensur.
Zuckerberg verkündete es triumphierend auf seiner eigenen Facebook-Seite: „Wir haben die Lösung für das Problem der ‚fake news‘ gefunden.“ Gemeint ist die Verbreitung von Falschmeldungen, ob im Scherz oder böswillig. Im Medienbereich spricht man von „Zeitungsenten“ oder „Tatarenmeldungen“.
Facebook für Wahlniederlage von Hillary Clinton verantwortlich gemacht
Linke Medien und Aktivisten geben Facebook die Schuld für die Wahlniederlage von Hillary Clinton. Die „unkontrollierte Verbreitung“ von Falschmeldungen gefährde die amerikanische Demokratie, so der Vorwurf. Der Wahlsieg von Donald Trump sei der ultimative „Beweis“ für diese von der politischen Linken schon seit einiger Zeit beklagten Gefahr. 2008 klang das noch ganz anders. Das „liberale“ Amerika feierte den Wahlsieg von Barack Obama als Triumph der neuen Kommunikationsmittel. Die sozialen Netzwerke hätten eine basisdemokratische Bewegung ausgelöst, die den Kandidaten der Demokratischen Partei ins Weiße Haus trug.
In Europa sei die aktuelle Lage auch anders. Sobald Facebook in den USA als potentieller „Schuldiger“ ausgemacht war, ertönte dieselbe Anklage auch in Europa. Zuckerbergs Netzwerk fördere den Aufstieg der europäischen Rechten. Erst vor wenigen Tagen erhob der slowakische Digitalkünstler und Blogger Jakub Goda scharfe Anklage. Goda forderte, daß Facebook etwas gegen „populistische“ Inhalte und gegen die „extreme Rechte“ tun müsse, die Facebook „erobert“ habe. Das Unternehmen dürfe nicht länger erklären, daß es sich um „eine Plattform handelt, die es ihren Nutzern erlaubt, ihren Meinungen eine Stimme zu verleihen“. Facebook müsse den „Extremisten“ das „Megaphon“ aus der Hand nehmen, schließlich stehe „die Demokratie auf dem Spiel“, und mit der „scherzt man nicht“. Was Goda unter „populistischen Inhalten“ und unter „extremer Rechten“ versteht und mit Objektivität und Ausgewogenheit wenig gemeinsam hat, ist auf seinem Blog unschwer nachlesbar.
Der Druck auf das Unternehmen in Manlo Park, das sich als Teil des „gutmenschlichen“ Amerika versteht, ist jedoch enorm. Schon vor dem 8. November, dem Wahltag in den USA, bereitete er den PR-Verantwortlichen von Facebook einiges Kopfzerbrechen. Seit Trumps Wahl zum 45. Präsidenten der USA wurde daraus ein marternder Schmerz. Zuckerberg durchlebte alle Phasen einer intensiven „Trauerarbeit“. Zuerst leugnete er einen Zusammenhang, dann machte er sich lustig über die Vorstellung, „Falschmeldungen“ auf Facebook hätten den Wahlausgang beeinflußt, schließlich gab er unter dem wachsenden Zorn der „liberals“ klein bei und gestand ein: Es gibt ein Problem. Am Donnerstagabend, 37 Tage nach der Präsidentschaftswahl, gab er bekannt, eine Lösung für „das Problem“ gefunden zu haben.
„Zuck“ macht ernst – Jubel bei linken Medien
Die linken großen Medien, von denen es auch in den USA zahlreiche gibt, nahmen die Ankündigung mit Erleichterung auf. Endlich mache „Zuck“ ernst, lautete der allgemeine Tenor. Facebook beginne, sich der Verantwortung zu stellen, die dem sozialen Netzwerk zukommt, das seit Jahren, schon lange vor der linken Wahlniederlage vom November, für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt die Tür zu Informationen ist.
In Wirklichkeit sagen Beobachter, daß der von Facebook angekündigte Plan, ineffizient sei und die sogar „kontraproduktiv“ wirken könnte.
Es gibt eine Reihe von Studien, die belegen, daß es für Medienkonsumenten nicht nur schwieriger geworden ist, Information von Kommentar zu unterscheiden, sondern auch eine wahre von einer falschen Meldung. Das aber habe, so Kritiker, eine längere Tradition, die weit vor die Gründung von Facebook zurückreiche. Es seien die Regierungen gewesen, die gezielt Information und Desinformation als politisches Instrument eingesetzt haben. Die Regierungen nützen Propaganda, jede Werbung eines Unternehmens sei Propaganda, und alle arbeiten dabei mit verzerrter Wahrnehmung. Das Neue bestehe darin, daß durch Facebook das Mittel der Information und der Propaganda, und damit auch der Desinformation, „demokratisiert“ wurde. Sie ist durch die sozialen Netzwerke und die Internetanbindung der Massen kein exklusives „Vorrecht“ der Regierungen und der klassischen Medien mehr.
Der Wahlerfolg Donald Trumps löste aufgeregte Diskussionen aus, die zum Teil ins Irrationale abgerutscht sind. Sind die sozialen Netzwerke, unter denen Facebook die „Königsrolle“ zukommt, als Medienunternehmen zu sehen, wie Tageszeitungen und Fernsehsender, mit allen damit zusammenhängenden Pflichten und Rechten? Oder sollen sie sich sogar als große Zensoren verstehen? Widerspricht beides nicht der eigentlichen Gründungsidee?
Unglaubwürdige Zensoren
Viel vom aktuellen Wirbel ist situationsbedingt durch die linke Wahlniederlage in den USA. Anlaß zu grundsätzliche Überlegungen besteht dennoch durchaus. Es ist eine Tatsache, daß im Verständnis der Bürger heute kaum etwas einen größeren Mißklang hat als das Binom „Medien und Wahrheit“. Das hat seine Gründe und ist nur ein Aspekt von mehreren. Darüber nachzudenken wäre demokratiepolitisch zwingender, als von Facebook die Einsetzung von Zensurfiltern zu verlangen. Der Ruf nach dieser Zensur ertönt unter verschiedenen Facetten, aber selten so direkt wie bei Jakub Goda. Einmal geht es um die Bekämpfung des islamischen Terrorismus, dann gegen „Haßpostings“. Die Grenze zwischen Bekämpfung einer Straftat und Einschränkung von Grundrechten ist fließend und verlangt nach erhöhter Wachsamkeit. Sie ist dort besonders gefährlich, wo neue Straftatbestände erst und eigens geschaffen werden. Man kann einen Stasi-Spitzel nicht zum Internetzensor der Bundesrepublik Deutschland machen, wie dies mit Anetta Kahane und der linksextremen Amadeu Antonio Stiftung der Fall ist. Oder in Österreich mit dem ebenfalls von einem Kommunisten gegründeten Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstandes (DÖW). Solche Einrichtungen kann es als private Initiativen in einem demokratischen Staat natürlich geben. Eine direkte Finanzierung durch den Staat, oder gar die Übertragung öffentlicher oder quasi-öffentlicher Aufgaben, die ein Handeln „im Namen des Staates“ ermöglicht oder suggeriert, bedeutet, dem Elefanten Zugang zum Porzellanladen zu verschaffen.
Die Zuckerberg-Lösung: „Kein Machtmißbrauch“
Damit zurück zu Facebook und der Zuckerberg-„Lösung“. Adam Mosseri, Facebook-Vize mit Zuständigkeit für den Bereich News Feed, erklärte das neue System, das derzeit experimentiert wird. Alles gehe von den Nutzern aus. Diese müßten „fake news“ melden. Sobald eine bestimmte Anzahl an solchen Meldungen eingegangen sei, werde Facebook aktiv und lasse die beanstandete Meldung von einer Gruppe von „fact checker“ prüfen. Die Überprüfung erfolgt anhand von durch Facebook ausgewählte amerikanische Medien und Internetseiten. Zur ersten Gruppe gehören die Nachrichtenagentur AP und ABC News, zur zweiten Gruppe Snopes und FactCheck. Anhand von deren Berichterstattung soll geklärt werden, ob die Nachricht falsch ist. Sollten man zu diesem Schluß gelangen, wird Facebook neben der Meldung die Zensur einblenden:
„Disputed by 3rd Party Fact-Checkers“.
Auf dem Terrain der Algorithmen und der Informationsflut kann der „Kampf gegen Fake News“ realistischerweise nicht „händisch“ Meldung für Meldung stattfinden. Deshalb klingt die behauptete „Lösung“ lachhaft. Vielmehr haben Facebook-Manager bereits in den vergangenen Wochen eingestanden, „Instrumente“ zu haben, mit denen die Nutzer „automatisch“ und „ein für allemal“ von „Falschmeldungen befreit“ werden.
Facebook versichert dabei, seine Macht nicht mißbrauchen zu wollen. Mit anderen Worten: Während Mark Zuckerberg im (linken) zivilgesellschaftlichen Diskurs, der Facebook auf die Anklagebank stellt, eine möglichst korrekte, einzelfallbezogene, geprüfte und gegengeprüfte, demokratiekonforme und grundrechtsgemäße „Lösung“ verkündet, haben die Techniker des Internetunternehmens an den Facebook-Algorithmen gebastelt. „Falschmeldungen“ sollen im News Feed weiter unten gereiht werden. Zudem soll der Algorithmus so programmiert werden, solche Artikel bei der Reihung der meistgelesenen Nachrichten zu benachteiligen. Von diesem Ansatz verspricht sich das Unternehmen einen subtilen, aber wirksamen Eingriff. Facebook entfaltet seine Wirkung durch das Teilen von Informationen. Nicht die Veröffentlichung einer Information ist entscheidend, sondern wie viele Nutzer und Nutzergruppen eine Information miteinander „teilen“ und weiterverbreiten. Dazu bedarf die Information der Sichtbarkeit in der Flut der täglichen Meldungen.
Beobachter gehen davon aus, daß die von Adam Mosseri vorgelegte Lösung als Mittel gegen echte Falschmeldungen zu schwerfällig ist. Die Information werde heute schnell weitergereicht. Die dreifache Stufung durch menschliches Handeln – Meldung von „fake news“, Aktivierung von Facebook, Überprüfung durch „fact checker“ – sei zu langsam. Die Kontrolleure sollen zudem Freiwillige sein, die ehrenamtlich prüfen, was das Gesamtbild gleich noch um einige Stufen weniger überzeugend erscheinen läßt.
Laut Ankündigung von Zuckerberg und Mosseri sollen die beanstandeten Nachrichten weiterhin sichtbar bleiben und auch von den Nutzern positiv bewertet werden können.
Was ist eine „Falschmeldung“, und wer entscheidet das?
Die Hauptfrage ist jedoch: Was genau ist unter einer „Falschmeldung“ zu verstehen, und wer entscheidet das? Gerade im Bereich der Politik geht es um Wertungen. Die Verschiebung der Kriterien, auch eine kleine, kann im konkreten Bereich schnell zu einer echten Zensur werden. Welche tatsächlich objektive und neutrale Stelle kann die Glaubwürdigkeit in Anspruch nehmen, einen wirklichen Faktencheck durchzuführen? Ehrenamtliche Freiwillige, die sich auf ausgewählte Medien stützen? Was Erstere betrifft, liefert Wikipedia ein abschreckendes Beispiel einseitiger Usurpation, und Letztere sind weder unabhängig noch neutral, sondern Meinungsmacher. Die Ereignisse rund um Aleppo in diesen Tagen sind ein aktuelles Beispiel, um zu sehen, wie Information und Desinformation aufgrund von politischen Interessenlagen nebeneinanderstehen und Verwirrung stiften, und das unter anderen auch konkret in den USA und durch die USA. Aleppo kann morgen überall sein.
Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts gaben im vergangenen Mai 82 Prozent der Bundesdeutschen an, sie würden Hillary Clinton wählen, nur fünf Prozent für Donald Trump. Nicht nur angesichts des tatsächlichen Wahlergebnisses der US-Wähler ist hier eine einseitige, sogar eine massiv einseitige Beeinflussung der Deutschen zum Greifen. Wie neutral sind also die Medien, die Maßstab für die „fact checker“ sein sollen? Die erste und folgenreichste Stufe der Beeinflussung durch eine Nachrichtenagentur ist die Auswahl der Nachrichten. Wird eine Nachricht von Facebook als „Falschmeldung“ eingestuft, weil sie AP oder ABC News nicht berichtet haben? Ein konkretes Beispiel aus eigener Erfahrung: Die Redaktion der ARD-Tagesschau ließ Leser im abfälligen Ton wissen, daß eine Meldung von Katholisches.info über verfolgte Christen in Syrien deshalb nicht berichtet werde, weil diese Meldung von den großen Agenturen nicht berichtet wurde, weshalb die Meldung einer kleinen Agentur a priori zweifelhaft bis unseriös sein müsse. Obwohl die Meldung bestätigt und völlig korrekt war, wurde sie von der Tagesschau nie berichtet, und damit dem Publikum vorenthalten. Ein Beispiel unter vielen. Der Gedanke über die praktische Handhabe läßt sich fortspinnen.
„Opposition zum Schweigen bringen“ – Das linke Netzwerk
Die Kritik an den Facebook-Plänen kommt daher vor allem aus dem nicht-linken Lager in den USA. Die alternative Nachrichtenplattform Breitbart News spricht von einem Versuch, „die Opposition zum Schweigen zu bringen“. Breitbart-Chef Stephen Bannon war Wahlkampfleiter von Donald Trump und wird von diesem als Chefberater in Weiße Haus geholt. Die FAZ titelte dazu: „Wird ‚Breitbart‘ jetzt Trumps Staatsfunk? Nicht nur Bürgerrechtler sind besorgt“. Hätte die Frankfurter Tageszeitung vergleichbar polemisch bei einem Wahlsieg von Hillary Clinton getitelt?
Die von Facebook ausgewählten Faktenprüfer, so Breitbart, vertreten eine akzentuiert linke Position. Eine objektive Beurteilung sei von ihnen nicht zu erwarten. Hinter dem Kampf gegen echte Falschmeldungen stehe vielmehr der Versuch, den Kampf gegen mißliebige Meldungen aufzunehmen. Das sei in der Tat eine Gefährdung der Demokratie. Es sei aber ein Wesensmerkmal der politischen Linken, die von ihr ausgehende Bedrohung der Demokratie als Kampf gegen die Gefährdung der Demokratie zu tarnen. Das sei in den USA nicht anders als in Europa.
Facebook beruft sich auf eine Faktenprüfung von dritter Seite. Das soll Neutralität und Objektivität suggerieren. Trifft das aber auch zu? Die Organisation The International Fact-Checking Network (IFCN), mit der Facebook zur Prüfung zusammenarbeiten will, wird vom Poynter Institute for Media Studies betrieben, das wiederum eine Gründung von Omidyar Network des Ebay-Gründers und „liberalen“ Pierre Omidyar ist. Partner von Omidyar Network bei zahlreichen Projekten sind die Open Society von George Soros und die Bill & Melinda Gates Foundation. Soros betreibt unter anderem das Syndicate Project. Omidyar Network gehört mit Soros zu den Zustiftern der Tides Foundation, einem der größten Geldgeber für linke politische Projekte in den USA. Das IFCN erhebt den Anspruch, eine neutrale Prüfstelle zu sein, ist es aber nicht. Die Liste des linken Netzwerkes ließe sich lange fortsetzen. Es steht für eine linke Politik in Sachen Einwanderung, „Homo-Ehe“, Abtreibung, Klimapolitik. Eine Zensurdrohung ist daher ernstzunehmen. Sie hätte weitreichende Auswirkungen.
Problem echter Falschmeldungen und der Ku Klux Klan
Dabei ist das Problem von Falschmeldungen durchaus real. Allerdings betreffen sie nicht nur das, was linke Kommentatoren auf die Palme treibt. Ein Beispiel für eine echte Falschmeldung, an der sich die „Liberals“ aber nicht störten, sondern sie eifrig in den klassischen Medien verbreiteten: Der Ku Klux Klan habe den Wahlsieg Donald Trumps gefeiert und einen großen Aufmarsch angekündigt. Die Wochenzeitung Die Zeit titelte „Donald Trump: Ku-Klux-Klan feiert Präsidentschaftswahl“. N‑TV meldete: „Siegesparade: Ku Klux Klan marschiert für Trump“. Der ORF tönte: „Ku-Klux-Klan feiert den Wahlsieg Trumps. Und selbst die seriöse Neu Zürcher Zeitung schrieb in großen Lettern: „Siegesmarsch geplant: Ku-Klux-Klan feiert Trump“. Der Haken an der Meldung: nichts davon stimmte. Eine Richtigstellung erfolgte allerdings von keinem der genanten Medien. Offensichtlich passierte die Schlagzeile zu gut ins Bild der zuständigen Redakteure.
Damit bleibt das Problem echter Falschmeldungen wohl auch weiterhin ein Problem, während der Wahlsieg von Donald Trump als Gegenreaktion einen Konflikt gegen die Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken ausgelöst hat.
Die von Zuckerberg offiziell präsentierte „Lösung“ ist technisch nicht handhabbar und inhaltlich zweifelhaft. Die algorithmische Lösung, die von Facebook inoffiziell angedeutet wurde, ist technisch naheliegender, inhaltlich aber noch bedenklicher, weil undurchsichtiger.
Die politische Linke, die den Verlust des Weißen Hauses erst verdauen muß, und sich auch in vier Jahren noch nicht damit abgefunden haben wird, setzt Zuckerberg und Facebook unter Druck. Die einzige korrekte Lösung, wenn man meint, eine solche suchen zu müssen (um 2020 die Wiederwahl Trumps zu verhindern), wäre die Umwandlung von Facebook in ein Medienunternehmen. Dann wäre Zuckerberg der Herausgeber, es müßte eine Redaktion und eine redaktionelle Linie geben, und damit auch eine Verantwortung für alle Inhalte. Davor wird sich Zuckerberg aber hüten. Die Medienunternehmen sind eine angeschlagene Branche, während das von ihm geschaffene soziale Netzwerk eine Geldmaschine ist. Vielleicht haben die angekündigten Maßnahmen daher nur palliativen Charakter, um die Zeit zu überdauern, bis der große Sturm sich gelegt hat. Für die Demokratie und das Grundrecht der Meinungsfreiheit wäre das besser.
Text: Ryan Bach
Bild: MiL