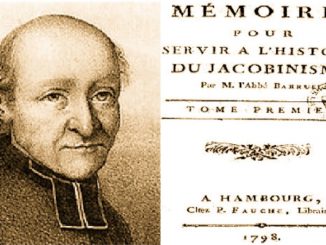Von Roberto de Mattei*
Unter den vielen Anklagen, die gegen den Staat Israel erhoben werden, findet sich auch jene, er habe in den 1980er Jahren die Entstehung der Hamas „mitverursacht“. Daraus wird gefolgert, man müsse sich von dem Krieg Israels gegen die Hamas distanzieren – denn zwischen dem Terrorismus und jenem, der ihn hervorgebracht habe, bestehe letztlich kein wesentlicher Unterschied.
Hier stehen wir vor einer historischen Simplifizierung, die – wie alle Irrtümer – einen wahren Kern enthält. Und von eben diesem wahren, lehrhaften Kern gilt es auszugehen.
Das zugrundeliegende Prinzip lautet: Man darf niemals das Böse tun, um Gutes zu erreichen. Das, was Thomas von Aquin die perfidia in bello – die Falschheit im Krieg – nennt (Summa Theologiae, II-IIae, q. 40, a. 3), ist von all jenen zu meiden, die, wenn schon nicht das christliche, so doch zumindest das natürliche Sittengesetz achten wollen.
Das Böse führt nämlich niemals zum Guten – im Gegenteil: Nach dem Prinzip der Heterogenese der Zwecke bewirkt es meist genau das Gegenteil dessen, was es ursprünglich zu erreichen vorgibt.
Das 20. Jahrhundert – ein Zeitalter großer Kriege und großer Täuschungen – bietet zahlreiche Beispiele für eben diese Heterogenese der Zwecke, oder, wenn man so will: für politische „Bumerangs“ – Entscheidungen, die als geniale taktische Züge gedacht waren, am Ende aber jene trafen, die sie ausgelöst hatten.
Das bekannteste Beispiel ist der sogenannte „plombierte Zug“, mit dem Lenin im April 1917 von der Schweiz nach Petrograd zurückgebracht wurde. Um das Zarenreich zu destabilisieren und zum Ausscheiden aus dem Ersten Weltkrieg zu bewegen, organisierte der reichsdeutsche Generalstab die Rückkehr des bolschewistischen Exilanten und seiner Mitstreiter. Zunächst schien das Kalkül aufzugehen: Durch Lenins Oktoberrevolution kam es 1918 zum Vertrag von Brest-Litowsk, der den Krieg im Osten beendete und der deutschen Armee die Verlegung von 35 Divisionen an die Westfront ermöglichte.
Doch wie General Erich Ludendorff selbst später einräumte, hatte man mit Lenin einen „ansteckenden Bazillus“ eingeschleust: Die bolschewistische Revolution blieb nicht an der russischen Grenze stehen. Die deutschen Generäle, so der Historiker Sean McMeekin, „dachten, Lenin als biologische Waffe gegen Russland einsetzen zu können, begriffen jedoch nicht, daß die von ihnen verbreitete Krankheit schließlich auch sie selbst befallen würde“ (The Russian Revolution: A New History, Basic Books, 2017, S. 130). Das deutsche Kaiserreich zerbrach, die von Berlin erhoffte Ordnung in Mittelosteuropa löste sich auf – und der von Moskau ausgehende Kommunismus entflammte die Welt. Die Waffe, die Deutschland exportiert hatte, um den Krieg zu gewinnen, wurde zum ideologischen Feind globalen Ausmaßes.
Unmittelbar nach Kriegsende versuchten die Siegermächte, Europas Sicherheit durch den Vertrag von Versailles (1919) abzusichern – und belegten Deutschland mit äußerst harten Bedingungen. Diese Strafmaßnahmen sollten einen deutschen Wiederaufstieg verhindern, führten jedoch zum Gegenteil: Erniedrigung und wirtschaftliche Not trieben die deutschen Staaten in den Revanchismus, zur Wiederaufrüstung und letztlich zur Machtergreifung des Nationalsozialismus. Ein diplomatischer Bumerang, der die Grundlagen für den Zweiten Weltkrieg legte.
Ein weiteres spektakuläres Beispiel war die Entscheidung der Vereinigten Staaten, in den 1980er Jahren die afghanischen Mudschaheddin im Kampf gegen die sowjetische Invasion (1979–1989) zu bewaffnen und finanziell zu unterstützen. Es war die größte Geheimoperation der CIA – und sie war erfolgreich: Steve Coll hat dokumentiert, wie der Zufluß von Geld und Waffen in den 1980er Jahren wesentlich zur Niederlage der Sowjets in Afghanistan beitrug (Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, Penguin, 2004). Doch in demselben Umfeld entstanden Al-Qaida und die Taliban – die späteren Hauptakteure des globalen Dschihadismus, der in den Anschlägen des 11. September 2001 gipfelte.
Ein weiteres paradigmatisches Beispiel ist die Operation Ajax von 1953: Die CIA und der britische MI6 stürzten den iranischen Premierminister Mossadegh, um die Kontrolle über das iranische Erdöl zu sichern und das Land im westlichen Einflußbereich zu halten. Stephen Kinzer bezeichnete diesen Eingriff als die „Mutter aller Bumerangs“: Die Installation eines autoritären Regimes führte nach 25 Jahren zum Sturz des Schahs, zur Islamischen Revolution von 1979 und zu mehr als vier Jahrzehnten feindseliger Beziehungen zwischen Teheran und Washington (All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror, John Wiley & Sons, 2003).
In den 1980er Jahren unterstützten die Vereinigten Staaten – gemeinsam mit mehreren europäischen Staaten – Saddam Hussein im Krieg gegen das Iran Khomeinis. Dilip Hiro erinnert daran, daß Bagdad westliche Technologie und Geheimdienstinformationen erhielt (The Longest War: The Iran–Iraq Conflict, Routledge, 1991). Zehn Jahre später aber marschierte eben jener Saddam, der vom Westen gefördert worden war, in Kuwait ein, was die Vereinigten Staaten in den Ersten Golfkrieg (1991) verwickelte und eine Kette von Ereignissen auslöste, die in der amerikanischen Invasion des Irak von 2003 kulminierten. Das Ergebnis: die Destabilisierung der gesamten Region, die islamistische Radikalisierung und die Entstehung des IS [Islamischer Staat]. Zwar wurde der Diktator gestürzt, doch verloren die USA an Glaubwürdigkeit und Einfluß – der Iran und der Dschihadismus füllten das entstandene Vakuum. Wiederum: taktischer Erfolg, strategischer Fehlschlag.
Und damit zur Entstehung der Hamas: In den 1970er- und 1980er-Jahren war im Gazastreifen die Mujama al-Islamiya aktiv – ein islamisches Netzwerk mit Verbindungen zur Muslimbruderschaft. Diese Bewegung wurde von Israel gefördert, in der Hoffnung, sie könne als Gegengewicht zur Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unter Jassir Arafat dienen. Zur Zeit der ersten Intifada (1987–1988) entstand aus diesem Umfeld die Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) – die „Islamische Widerstandsbewegung“, die sich schon in ihrer Gründungsakte (1988) die Zerstörung Israels zum Ziel setzte.
Im strategischen Denken Israels der 1980er-Jahre versprach die Präsenz eines organisierten Islamismus kurzfristig den Vorteil, die palästinensische Front zu spalten. Doch die Illusion währte nicht lange: Als die Hamas gewaltsam gegen Israel vorging, reagierte Tel Aviv mit Massenverhaftungen und erklärte die Bewegung 1989 offiziell zur Terrororganisation. Ein Funktionär der israelischen Militärverwaltung, Avner Cohen, räumte später ein: Die Unterstützung für die Hamas „war ein riesiger Fehler, eine historische Torheit: Wir haben zugelassen, daß eine Bewegung erstarkte, die sich später gegen uns wandte“ (Andrew Higgins, How Israel Helped to Spawn Hamas, The Wall Street Journal, 24. Januar 2009).
Israel hat die Hamas nicht „erschaffen“, wohl aber in ihrer Frühphase eindeutig begünstigt. Eine Logik, die – wie der Historiker Jean-Pierre Filiu bemerkt – sich später als ein „vollkommener Bumerang“ erwies. In dem Versuch, Arafat zu schwächen, unterstützte Israel das Aufkommen eines radikaleren Akteurs, der in der Lage war, sowohl den palästinensischen Staat als auch den jüdischen mit einer weit tiefer verankerten religiösen und gesellschaftlichen Machtbasis infrage zu stellen (The Origins of Hamas: Militant Legacy or Israeli Tool?, Journal of Palestine Studies, 41 (3), 2012, S. 54–70).
Wenn das 20. Jahrhundert eine Lehre bietet, dann diese: Realpolitik hat stets einen hohen Preis. Ob es sich um Lenins Zug, den Versailler Vertrag, die afghanischen Mudschaheddin, den Irak oder den Gazastreifen handelt – ganz zu schweigen vom sogenannten „Arabischen Frühling“ – das Muster ist immer dasselbe: Ein taktisches Ziel führt zu einem scheinbaren Erfolg, der jedoch mittelfristig zur Entstehung eines neuen Feindes oder zu noch größerer Instabilität führt. Die Großmächte glaubten oft, Geschichte wie ein Schachspiel lenken zu können. Doch die Dynamiken von Gut und Böse, von Treue und Betrug, entfalten in der Geschichte eine ganz eigene Logik. Das Gute neigt dazu, sich selbst zu verwirklichen; das Böse dagegen zerstört am Ende selbst seine eigenen Ziele. Die innere Geschlossenheit der Ergebnisse gehört dem Guten, das aufbaut – nicht dem Bösen, das zerstört.
Doch die Verurteilung des politischen Zynismus oder der unlauteren Mittel, mit denen Kriege geführt werden, bedeutet nicht, daß die dahinterstehende Sache selbst ungerecht sei. Wer mit Recht den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki verurteilt, kann daraus nicht schließen, der Krieg der Alliierten gegen die Achsenmächte sei falsch gewesen. Ebenso wenig ändert der schwerwiegende Fehler Israels, die Hamas in ihrer Frühzeit begünstigt zu haben, etwas an der Gerechtigkeit seines Kampfes gegen jene Feinde – die zugleich auch die Feinde des Westens sind.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana