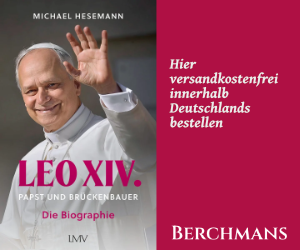Ein Gastkommentar von Hubert Hecker
Papst Franziskus geißelte zu Anfang seines Pontifikats die westliche Wirtschaftsweise als „unmenschliches Wirtschaftsmodell“. In seiner ersten Enzyklika ‚Evangelii Gaudium‘ vom November 2013 verurteilte er die marktwirtschaftliche Ökonomie als eine Wirtschaft, die „Disparität der Einkommen“ erzeuge. Die päpstliche Schlussfolgerung: „Diese Wirtschaft tötet“. Nahrungsmittel würden in den reichen Industriestaaten weggeworfen, während Menschen hier und in südlichen Ländern Hunger leiden. Die marktwirtschaftlichen Regeln der Konkurrenzfähigkeit würden nach dem „Gesetz des Stärkeren“ funktionieren, „wo der Mächtigere den Schwächeren zunichtemacht“. Das Wirtschaftswachstum des freien Marktes führe nicht zu größerem Wohlstand der Massen. Der Papst unterstellt im Gegenteil das Größerwerden der Schere zwischen Armen und Vermögenden. Mit einem Zitat von Chrysostomos insinuiert er, dass Eigentum Diebstahl an den Armen wäre.
Erst kürzlich erneuerte Franziskus seine aggressive Kritik gegen marktwirtschaftliche Reformen – und zwar die der Regierung Milei in seinem Heimatland Argentinien, indem er die Gewalttätigkeiten von linksradikalen Demonstranten und Blockierer rechtfertigte, aber die maßvolle Gegenwehr der Polizei brandmarkte.
Es ist kein Geheimnis, dass der Papst statt der freien und sozialen Marktwirtschaft eine staatlich gelenkte Verteilungswirtschaft in links-peronistischer Perspektive favorisiert.
Aber welche Erfahrungen hat man etwa mit einer Umverteilung von überschüssigen Lebensmitteln im globalen Maßstab gemacht, also von den reichen Industrieländern auf die ärmeren Länder in Afrika? Studien zeichnen ein negatives Bild von solchen Umverteilungsströmen, wenn z. B. Getreide oder Kleidung verbilligt oder umsonst abgegeben werden. Sie zerstören die einheimischen Produzenten-Märkte der Entwicklungsländer. Außerdem degradiert das Umverteilen die Empfänger zu Almosennehmern, was ihre Initiative lähmt und eine unproduktive Verteilungsbürokratie fördert. Nur Hilfe zur Selbsthilfe ist eine menschenwürdige Hilfe und nicht (Um-)Verteilung von Geld und Gütern.
Auch ein generelles Umverteilen von Vermögen und Einkommen mit dem Ziel der Gleichheit („Gleichgewicht“) von Reichen und Armen, wie es Franziskus vorschwebt, würde zu Einschnürung oder gar Abwürgen einer prosperierenden Wirtschaft führen – und damit die materiellen Grundlagen des Wohlstands untergraben.
Ein noch weitergehender Schritt auf dem Weg zur Gleichstellung von Reichen und Armen wäre die sozialistische Umverteilung von allem Privatbesitz auf das besitzlose Volk – mit dem bekannten Ergebnis einer wirtschaftlichen Degression sowie der gleichmäßigen Armut aller Volksgruppen – außer den Parteiprivilegierten. Vor den abschreckenden Folgen kommunistischer Regimes in Kuba und Venezuela verschließt der peronistisch orientierte Papst seine Augen. Der venezuelanische Diktator Maduro hat mit seiner sozialistischen Günstlings- und Verschwendungswirtschaft sein ehemals reiches Land in den Ruin – und acht Millionen Elendsflüchtlinge ins nahe Ausland getrieben.
Die These des Papstes, dass das Konkurrenzprinzip des freien Marktes die „Stärkeren und Mächtigeren“ darin begünstige, die „Schwächeren zunichte“ zu machen, geht offenbar von einer Fehlinterpretation des Marktes aus. In einer funktionierenden Marktwirtschaft setzt sich über den lauteren Wettbewerb der jeweils wirtschaftlich Bessere durch – zum Nutzen der Konsumenten. Ein ineffektiver Anbieter dagegen braucht nicht „zunichte“ gemacht werden, sondern wird durch die nachfragenden Marktteilnehmer beiseitegeschoben. Nach Franz Böhm ist der Markt-Wettbewerb das genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte.
Eine regulierte Marktwirtschaft entspricht dem Subsidiaritätsprinzip der traditionellen katholischen Soziallehre: Was Einzelpersonen, Unternehmer und kleine Wirtschaftseinheiten leisten können, dürfen die übergeordneten gesellschaftlichen Institutionen nicht an sich ziehen. Andererseits ist es die Pflichtaufgabe des Staates, die Handlungssicherheit der wirtschaftlichen Einheiten durch strafbewehrte Rechtsregeln zu garantieren.
Somit hat der Staat die Ordnungsregeln des Marktes zu setzen und zu kontrollieren: Monopole und Kartelle abwehren, Korruption unterbinden, Rechtsregeln durchsetzen (Ordo-Liberalismus) sowie die aus dem Markt fallenden Teilnehmer fördern und fordern (Soziale Marktwirtschaft).
Dass diese politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft zu mehr Wohlstand führen, haben drei Wirtschaftswissenschaftler in ihren Studien aufgezeigt. Sie wurden kürzlich vom schwedischen Nobel-Komitee dafür ausgezeichnet.
Die Wissenschaftler forschten u. a. danach, wieso es den Menschen im nordamerikanischen Teil der Grenzstadt Nogales viel besser geht als den Bewohnern der Südstadt in Mexiko, „obwohl die Stadtbevölkerung eine Geschichte teilt und kulturell sehr ähnlich ist“ (FAZ 15.10.2024). Entscheidend für den Wohlstandsunterschied scheinen tatsächlich die gesellschaftlich-politischen Regeln zu sein. Die Studien zeigen auf, dass die demokratische Teilhabe und sicheres Eigentumsrecht der USA wesentliche Voraussetzungen für Wohlstand und Wachstum sind. „In Mexiko dagegen gibt es viel Korruption und politische Gewalt, sodass Leben und Wohlstand ständig gefährdet sind.“ Wie zum Beleg dieser These wurde kürzlich Garcia Luna, der mexikanische Polizei- und Sicherheitsminister von 2006 bis 2012, von einem US-amerikanischen Gericht zu lebenslanger Haft wegen Begünstigung von Drogenhandel und Korruption verurteilt.
Die Forscher untersuchten ebenfalls historische Beispiele, wie kolonialistische Siedlereliten die beherrschten Länder ausplünderten und verarmen ließen. Aber auch autokratische Vertreter eines ehemals kolonialistisch unterdrückten Landes wie Zimbabwe können ein Land in den Ruin führen.
Andererseits befinden sich viele Länder in Asien, Afrika und Südamerika im Lernprozess zu mehr Markwirtschaft und Eigeninitiative, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Unter diesen Aspekten sollten Staat, Zivilgesellschaft und Kirche der Verbesserung der politisch-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von ehemaligen Entwicklungsländern mehr Aufmerksamkeit widmen und entsprechend ihre bisherigen Hilfskonzepte auf den Prüfstand stellen. Viele Milliarden Entwicklungshilfegelder aus den reichen Industriestaaten in die Länder der Dritten Welt verschwanden in den Taschen von nachkolonialistischen Autokraten und korrupten Eliten wie etwa im Kongo. Es muss ernsthaft erörtert werden, inwieweit die 11 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe an Tansania mitverantwortlich sind für das kontraproduktive Resultat, dass das ostafrikanische Land heute zu einem der ärmsten Länder der Welt gehört.
Auch die Kirche sollte unter dieser Hinsicht ihre Unterstützungskonzepte überdenken, soweit sie sich an den ineffektiven Rezepten von Umverteilung und paternalistischen Hilfsprogrammen orientieren. Bei diesem Hilfe-Sektor müsste der Rückgriff auf die bewährten Prinzipien Hilfe zur Selbsthilfe insbesondere für die kleinen Einheiten sowie Vertrauen in die subsidiäre Eigeninitiative etwa durch Mikro-Kredite und andere Anschubfinanzierungen handlungsleitend sein.
Bild: Wikicommons