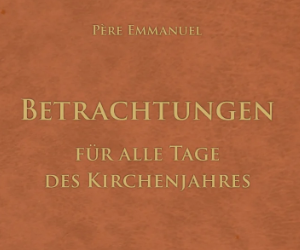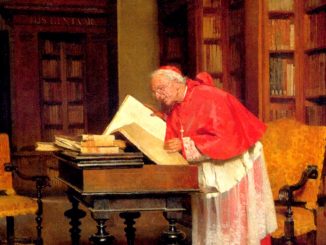(Rom) Der neuen Stufe des Ökumenismus, die Papst Franziskus stillschweigend praktiziert, liegt ein liturgischer Tabubruch zugrunde: die Zelebration nicht-katholischer Gottesdienste in den römischen Papstbasiliken.
Im vergangenen Mai wurden zwei nicht-katholische Liturgien in der Lateranbasilika, der römischen Bischofskirche, gefeiert. Am 18. April feierten ein anglikanischer Bischof mit 50 anglikanischen Geistlichen einen anglikanischen Gottesdienst am Hauptaltar vor dem Papstthron. Angeblich sei dies ohne Zustimmung geschehen, was wenig glaubwürdig ist. Der Stellvertreter des Erzpriesters beteuerte sein „tiefes Bedauern“ und sprach von einem „unglücklichen“ Vorfall und einem „ökumenischen Mißverständnis“.
Tatsache ist jedoch, daß jemand den Anglikanern die Erlaubis erteilt hatte. Wer es war, wurde nicht bekannt. Man geht aber nicht fehl in der Annahme, in Richtung Santa Marta zu schauen, denn bereits am 14. Mai folgte die nächste nicht-katholische Zelebration und dieses Mal ganz offiziell.
An jenem Sonntag durfte Tawadros II., Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhls des heiligen Markus, das Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche von Ägypten, am Papstaltar über der Confessio der Patriarchalbasilika die „Göttliche Liturgie im koptischen Ritus“ zelebrieren. Dazu war die koptisch-orthodoxe Gemeinschaft in Italien eingeladen worden.
Während wenige Wochen zuvor noch von einem „ökumenischen Mißverständnis“ die Rede war, war nun Angelo De Donatis, der Kardinalvikar des Papstes für die Diözese Rom, persönlich anwesend und Kurienbischof Brian Farrell, der Sekretär des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, hielt eine Begrüßungsrede.
Die Verletzung des Kirchenrechts wurde in beiden Fällen nicht thematisiert, ebensowenig die Frage nach einem eventuellen Reinigungs- und Wiedergutmachungsritus. Im ersten Fall war es eben ein „bedauerlicher“, im zweiten ein erlaubter Vorfall. Die anderen christlichen Gemeinschaften drängt es, in den Papstbasiliken zu zelebrieren. Drängt es sie auch, in die volle Einheit mit Rom zurückzukehren? Oder wird durch diese Art von Ökumenismus nur die katholische Kirche auf die Stufe der anderen Gemeinschaften herabgestuft? Sind alle Gegensätze in Glaubenslehre und Liturgie ausgeräumt? Nichts dergleichen wurde bisher bekanntgegeben.
Und da aller guten Dinge offenbar drei sind, zelebrierte am vergangenen Freitag der Katholikos Baselios Marthoma Mathews III., das Oberhaupt der nicht mit Rom unierten syro-malankarischen orthodoxen Kirche, auch indisch-orthodoxe Kirche genannt, in der römischen Lateranbasilika im Antiochenischen Ritus. Gleiches tat er auch gestern in der päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern. Eingeladen waren die Gläubigen der syro-malankarischen orthodoxen Gemeinschaft in Rom und Italien.
Die syro-malankarische orthodoxe Kirche ist eine 1912 (rund 1,1 Millionen Gläubige) erfolgte Abspaltung von der malankarischen syrisch-orthodoxen Kirche (rund 1,2 Millionen Gläubige). Seit 1930 gibt es zudem eine mit Rom unierte syro-malankarische katholische Kirche (etwa 0,5 Millionen Gläubige). Sie alle führen ihren Ursprung auf den Apostel Thomas zurück und werden daher als Thomaschristen bezeichnet. Die größte Gemeinschaft der Thomaschristen ist die 1599 in die Einheit mit Rom zurückgekehrte syro-malabarische Kirche mit rund 4,5 Millionen Gläubigen.
Die älteste Union erfolgte 1188, als die Maronitische Kirche in Westsyrien (heute Libanon) in die Einheit mit Rom zurückkehrte. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird die Union mit Rom jedoch abschätzig als „Rückkehrökumene“ schlechtgeredet. Wird sie durch eine „Zelebrationsökumene“ ersetzt, die der Logik folgt: Jeder soll bleiben, was er ist, und beibehalten, was er hat? Werden dadurch Lehrfragen de facto einfach weggewischt?
Schließlich hatte Papst Franziskus am 24. April 2016 bei einer Veranstaltung der Fokolarbewegung in Rom gesagt: „Die Religionszugehörigkeit ist nicht wichtig!“ Dabei meinte er nicht andere christliche Kirchen und Denominationen, sondern andere Religionen.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: CatholicateNews/Wikicommons (Screenshot)