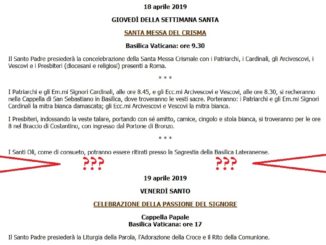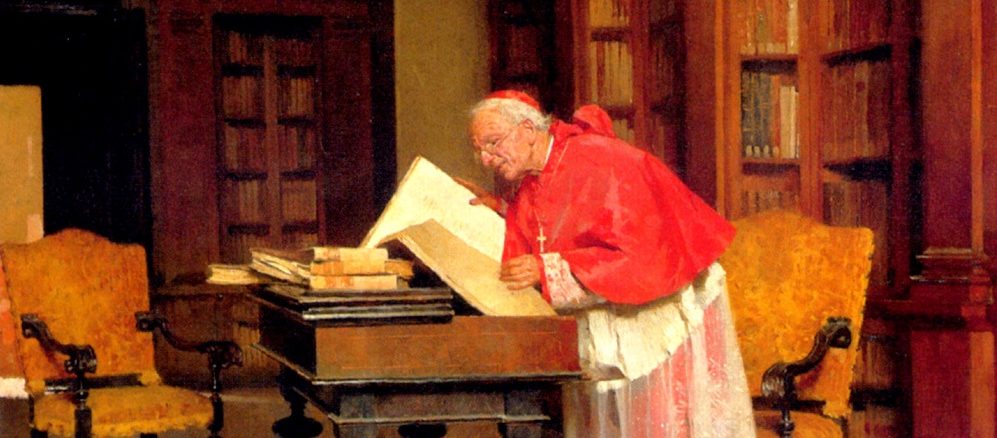
(Berlin/Rom) Kardinal Walter Brandmüller, einer der vier Unterzeichner der Dubia (Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia, deutet die Notwendigkeit an, daß Papst Franziskus ein Glaubensbekenntnis ablegen sollte. Eine solche Notwendigkeit läßt der ehemalige Chefhistoriker des Vatikans in einem Aufsatz der Neuen Ordnung erkennen. In der August-Ausgabe veröffentlichte er den Aufsatz „Der Papst: Glaubender – Lehrer der Gläubigen“. Aufmerksam auf den brandaktuellen Gedanken machte die verdiente deutsch-amerikanische Publizistin Maike Hickson.

Der Historiker Brandmüller war von 1998 – 2009 Vorsitzender des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft. 2010 erhob ihn Papst Benedikt XVI. in den Kardinalsstand. In seinem nun in der Neuen Ordnung[1]Geleitet wird sie vom Dominikaner und bekannten Sozialethiker, Wolfgang Ockenfels. Ockenfels war von 1985 – 2015 ordentlicher Professor für Christliche Sozialwissenschaft an der Theologischen … Continue reading vorgelegten Aufsatz zeigt er auf, daß es durch viele Jahrhunderte üblich war, durch ein öffentliches Bekenntnis die Glaubensdogmen zu bekräftigen. Das Thema ist historischer Natur, doch läßt der Kardinal erkennen, daß er einen direkten Bezug zur aktuellen Kirchenkrise sieht.
„Schon seit dem Ende des 5. Jahrhunderts (ist) der Brauch bekannt, daß der neugewählte römische Bischof sein Glaubensbekenntnis mitteilt.“
Auftrag des Papstes ist es, der Fels in der Brandung zu sein, auf dem Christus Seine Kirche baut. Diesen Auftrag erteilte ihm Jesus Christus nach dem Petrus-Bekenntnis von Caesarea Philippi: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes“. „Auf das Bekenntnis des Glaubens des Apostels antwortet Jesus mit der einzigartigen Berufung des Petrus“, so Brandmüller.
Der Papst, „obgleich (sichtbares) Haupt der Kirche“, ist doch auch „in organischer Verbindung Glied an dem einen Leib“.
„Verhält es sich so, dann wird verständlich, daß es im vitalen Interesse der Kirche liegt, daß sie sich des genuinen, authentischen Glaubens eben jenes Mannes sicher sein kann, der Nachfolger des Apostelfürsten Petrus und Träger seiner Vollmacht ist.“
Brandmüller zeigt in seinem Aufsatz die bedeutendsten historischen Beispiele auf, mit denen Päpste dem Petrus-Bekenntnis gefolgt sind. Als „bekanntestes Beispiel hierfür“ nennt der Kardinal „jene Synodica (…], mit welcher Gregor der Große den Patriarchen des Ostens seine Wahl zum Nachfolger Petri bekanntgab, und mit der ein ausführliches Glaubensbekenntnis verbunden war.“
„Dieser Brauch war Ausdruck des Wissens darum, daß die Gemeinschaft des Glaubens, die Zustimmung zum gemeinsamen Glauben, die entscheidende Grundlage und Voraussetzung kirchlicher Gemeinschaft ist: das consortium fidei apostolicae, die Gemeinsamkeit des Apostolischen Glaubens.“
Das Petrus-Bekenntnis sei zumindest bis ins 5. Jahrhundert belegbar. In der Form der Synodica sei es bis ins 7. Jahrhundert in Brauch gewesen, dann gefolgt von anderen Formen, so der professio fidei, die der neuerwählte Papst vor und nach seiner Weihe zum Bischof abzulegen hatte. Als ältestes bekanntes Beispiel dafür nennt der Kardinal die Weihe von Papst Benedikt II. am 26. Juni 684 und stellt sie in einen Zusammenhang mit den Nachwehen der christologischen Auseinandersetzungen, die zur Verurteilung von Papst Honorius I. geführt hatten.
Die „erklärte Absicht“ der Bekenntnisse der Petrus-Nachfolger „war, dem consortium fidei apostolicae förmlichen Ausdruck zu verleihen – jener Gemeinschaft im apostolischen Glauben, die Papst und Gläubige der Kirche verbindet.“
Der neue Papst ging damit eine Verpflichtung ein:
„Es ist auffallend, wie nachdrücklich das strikte Bewahren des Vorgefundenen, Überlieferten betont wird: Er verspricht, die heiligen Canones und Bestimmungen unserer Päpste als göttliche und himmlische Gebote zu bewahren.“
Trotz einiger Unterbrechungen blieb der Brauch bis ins 15. Jahrhundert aufrecht. Die vom Papst abgelegte professio fidei hatte jedes Jahr am Jahrestag seiner Wahl verlesen zu werden, um ihn an die gemachten Versprechen zu erinnern.
Professiones fidei der Päpste, so Brandmüller unter Verweis auf das Liber Diurnus, die Konzilien von Konstanz, Basel und Trient und schließlich jene von Paul VI., „(waren) jeweils Reaktionen auf ernste, bedrohliche Krisen des Glaubens. Antworten der Päpste auf Gefährdungen des genuinen katholischen Glaubens in je gewandeltem historischem Kontext.“
Kardinal Brandmüller sagt es nicht direkt, doch macht sein Aufsatz den Gedanken naheliegend, daß die Kirche auch derzeit eine „ernste, bedrohliche Krise des Glaubens“ erlebt und daher eine professio fidei des amtierenden Papstes ein geeignetes Instrument wäre, die Einheit der Kirche im wahren Glauben zu stärken und zu bewahren. Denn im letzten Absatz schreibt der Kardinal:
„Wer immer diesen historischen Befund im Lichte unserer Gegenwart bedenkt, mag sich fragen, welche Folgerungen sich daraus für die Kirche unserer Tage ergeben könnten.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Mater Ecclesia/Die Neue Ordnung (Screenshot)
-
| ↑1 | Geleitet wird sie vom Dominikaner und bekannten Sozialethiker, Wolfgang Ockenfels. Ockenfels war von 1985 – 2015 ordentlicher Professor für Christliche Sozialwissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier. Die Schriftleitung der Neuen Ordnung übernahm er 1992 von P. Heinrich Basilius Streithofen. Die Zeitschrift ist seit ihrer Gründung 1947 mit dem Dominikanerorden verbunden und am Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg mit Sitz in Bonn angesiedelt. |
|---|