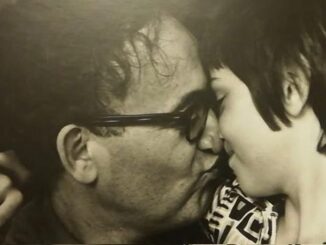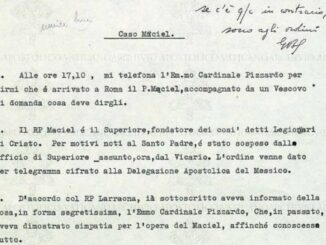(Rom) Papst Franziskus gewährte der argentinischen Presseagentur Télam ein ausführliches Exklusivinterview, das gestern mittag römischer Zeit veröffentlicht wurde. Ganz „exklusiv“ war es allerdings nicht. In der Vergangenheit gab es einige Unstimmigkeiten zwischen dem von Franziskus errichteten Kommunikationsdikasterium und seinen eigenmächtigen Interview-Aktivitäten. Bekanntlich geschahen diese wiederholt am eigenen Ministerium vorbei. Diesmal war es anders.
In den vergangenen Jahren konnte es sein, daß die Kommunikationsverantwortlichen des Heiligen Stuhls von Interviews des Papstes erst aus den Medien erfahren haben. Santa Marta machte sich nicht die Mühe, die zuständigen Stellen zu informieren.
So kam es, daß die vatikanischen Medien wie VaticanNews und der Osservatore Romano den weltlichen Medien hinterherhinkten und nur Auszüge der Interviews veröffentlichten. Das wiederum stellte Franziskus nicht zufrieden, der wünschte, daß die Menschen seine Aussagen direkt und vollständig lesen und hören können.
Diesbezüglich scheint es inzwischen Verfeinerungen gegeben zu haben: Das Télam-Interview wurde den vatikanischen Medien vorab zur Verfügung gestellt, um Übersetzungen anfertigen zu können. Als die spanische Originalfassung des Interviews veröffentlicht wurde, konnten die Vatikanmedien zeitgleich bereits vorbereitete Übersetzungen in anderen Sprachen publizieren. VaticanNews veröffentlichte die päpstlichen Antworten auf englisch und italienisch. Der Osservatore Romano konnte die Originalfassung bereits in seiner gestern erschienenen spanischen Wochenausgabe abdrucken, wofür er ganze vier Seiten brauchte. Der deutsche Dienst von VaticanNews begnügte sich hingegen, wie in der Vergangenheit, der Leserschaft nur eine Kurzfassung zur Verfügung zu stellen.
Katholisches.info wollte zunächst das vollständige Interview in einer kommentierten Fassung veröffentlichen. Darauf verzichten wir. Die Leser können sich so ein unbeeinflußtes Bild machen. Einige Anmerkungen seien dennoch erlaubt, werden aber erst am Ende angefügt.

Das Interview mit Franziskus führte Bernarda Llorente, die Chefredakteurin von Télam:
„Man kommt nicht allein aus der Krise heraus, man kommt aus ihr heraus, indem man Risiken eingeht und sich gegenseitig an die Hand nimmt“
Exklusivinterview der Agentur Télam mit Papst Franziskus
Bernarda Llorente (Télam): Franziskus, Sie waren eine der wichtigsten Stimmen in einer Zeit der großen Einsamkeit und Angst in der Welt während der Pandemie. Sie wußten, wie man die Grenzen einer Welt in einer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise beschreibt. Bei dieser Gelegenheit sagten Sie: „Man kommt aus einer Krise nie unverändert heraus, man kommt besser oder schlechter heraus“. Was glauben Sie, wie wir aus dieser Situation herauskommen? Wohin gehen wir?
Franziskus: Das [wohin wir gehen] gefällt mir nicht. In einigen Bereichen hat es ein Wachstum gegeben, aber allgemein gefällt es mir nicht, weil es selektiv geworden ist. Sehen Sie, allein die Tatsache, daß es in Afrika keine Impfstoffe oder nur die Mindestdosen gibt, bedeutet, daß die Heilung der Krankheit auch von anderen Interessen abhängt. Die Tatsache, daß Afrika so dringend Impfstoffe braucht, zeigt, daß etwas schief gelaufen ist.
Wenn ich sage, daß man nie mehr derselbe ist, dann deshalb, weil eine Krise einen unweigerlich verändert. Außerdem sind Krisen Momente im Leben, in denen man einen Schritt nach vorne macht. Es gibt die Krise der Pubertät, die des Erwachsenwerdens, die Midlifecrisis. Das Leben markiert Meilensteine mit Krisen. Denn Krisen bringen dich in Bewegung, sie bringen dich zum Tanzen. Und man muß wissen, wie man mit ihnen umgeht, denn wenn man das nicht tut, werden sie zu Konflikten. Und der Konflikt ist etwas Geschlossenes, er sucht die Lösung in sich selbst und zerstört sich selbst. Stattdessen ist die Krise notwendigerweise offen, sie läßt einen wachsen. Eines der wichtigsten Dinge im Leben ist es, zu wissen, wie man eine Krise meistert, ohne zu verbittern. Und wie haben wir die Krise überstanden? Jeder tat, was er konnte. Es gab Helden, ich kann hier nur von denen sprechen, die mir am nächsten waren: Ärzte, Krankenschwestern, Priester, Ordensfrauen, Laien, die wirklich ihr Leben gegeben haben. Einige sind gestorben. Ich glaube, mehr als sechzig sind in Italien gestorben. Die Hingabe des eigenen Lebens für andere ist eines der Dinge, die in dieser Krise zum Vorschein gekommen sind. Auch die Priester kamen im allgemeinen gut zurecht, weil die Kirchen geschlossen waren, aber sie riefen die Menschen an. Es gab junge Priester, die die älteren Menschen auf dem Markt fragten, was sie brauchten, und für sie einkauften. Ich meine, Krisen zwingen einen zur Solidarität, weil alle in einer Krise stecken. Und das ist der Punkt, an dem Sie wachsen.
Bernarda Llorente (Télam): Viele dachten, daß die Pandemie Grenzen gesetzt hätte: die extreme Ungleichheit, die Mißachtung der globalen Erwärmung, der übersteigerte Individualismus, das schlechte Funktionieren der politischen und repräsentativen Systeme. Es gibt jedoch Sektoren, die darauf bestehen, die Bedingungen vor der Pandemie wiederherzustellen.
Franziskus: Wir können nicht in die trügerische Sicherheit der politischen und wirtschaftlichen Strukturen zurückkehren, die wir früher hatten. So wie ich sage, daß man nicht gleich, sondern besser oder schlechter aus der Krise herauskommt, sage ich auch, daß man nicht allein aus der Krise herauskommt. Entweder kommen wir alle da raus oder keiner von uns. Die Annahme, daß eine einzelne Gruppe aus der Krise herauskommen wird, mag eine Rettung sein, aber es ist eine Teilrettung, sei es wirtschaftlich, sei es politisch oder von bestimmten Bereichen der Macht. Aber man kommt nicht ganz raus. Sie bleiben durch die von Ihnen getroffene Machtentscheidung gefangen. Sie haben zum Beispiel ein Geschäft daraus gemacht oder sich in der Krise kulturell gestärkt. Die Krise zum eigenen Vorteil zu nutzen bedeutet, schlecht und vor allem allein aus ihr herauszukommen. Man kommt nicht allein aus der Krise heraus, man kommt heraus, indem man Risiken eingeht und sich gegenseitig an die Hand nimmt. Wenn du das nicht tust, kommst du da nicht mehr heraus. Das ist also der soziale Aspekt der Krise.
Es ist eine Zivilisationskrise. Und zufällig steckt auch die Natur in einer Krise. Ich erinnere mich, daß ich vor ein paar Jahren mehrere Regierungschefs und Staatsoberhäupter aus polynesischen Ländern empfangen habe. Und einer von ihnen sagte: „Unser Land denkt darüber nach, Land in Samoa zu kaufen, denn in 25 Jahren könnte es uns nicht mehr geben, weil das Meer so stark ansteigt.“ Wir sind uns dessen nicht bewußt, aber es gibt ein spanisches Sprichwort, das uns zu denken geben sollte: Gott vergibt immer. Seien Sie versichert, daß Gott immer vergibt und wir Menschen von Zeit zu Zeit vergeben. Aber die Natur verzeiht nie. Das forderte seinen Tribut. Du nutzt die Natur, und sie kommt zu dir zurück.
Eine überhitzte Welt entfernt uns auch vom Aufbau einer gerechten und geschwisterlichen Gesellschaft. Es gibt die Krise, die Pandemie und das berühmte Covid. Als ich Student war, haben die Corona-Viren vor allem eine Erkältung verursacht. Doch dann mutierten sie und es geschah, was geschehen ist. Die Mutation von Viren ist sehr interessant, denn wir stehen nicht nur vor einer Viruskrise, sondern auch vor einer globalen Krise. Einer globalen Krise in unserer Beziehung zum Universum. Wir leben nicht in Harmonie mit der Schöpfung, mit dem Universum. Und wir ohrfeigen sie ständig. Wir mißbrauchen unsere Kräfte. Es gibt Menschen, die sich nicht vorstellen können, in welcher Gefahr sich die Menschheit heute durch diese Überhitzung und das Zertrampeln der Natur befindet.
Ich möchte Ihnen eine persönliche Erfahrung schildern: 2007 war ich in der Redaktionsgruppe des Aparecida-Dokuments, und damals gab es Vorschläge von Brasilianern, die sich für den Schutz der Natur einsetzten. „Aber diese Brasilianer, was geht in ihren Köpfen vor?“, fragte ich mich damals, ich verstand das alles nicht. Aber nach und nach wachte ich auf, und da spürte ich den Drang, etwas zu schreiben. Als ich Jahre später nach Straßburg reiste, schickte Staatspräsident François Hollande seine damalige Umweltministerin Ségolène Royale, um mich zu empfangen. Irgendwann fragte sie mich: „Stimmt es, daß Sie etwas über die Umwelt schreiben?“ Als ich ja sagte, bat sie mich: „Bitte, veröffentlichen Sie es vor der Pariser Konferenz“ [UNO-Klimakonferenz 2015]. Also traf ich mich wieder mit den Wissenschaftlern, die mir einen Entwurf gaben, dann traf ich mich mit den Theologen, die mir einen weiteren Entwurf gaben, und so entstand Laudato si’. Es war notwendig, um das Bewußtsein zu schaffen, daß wir der Natur ins Gesicht schlagen. Und die Natur wird ihren Tribut fordern. Das hat seinen Preis.
Bernarda Llorente (Télam): In der Enzyklika Laudato si’ warnen Sie davor, daß oft von Ökologie gesprochen wird, aber losgelöst von den sozialen und entwicklungspolitischen Bedingungen. Wie würden diese neuen Regeln in wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht aussehen, inmitten dessen, was Sie als Zivilisationskrise bezeichnet haben, und mit einer Erde, die außerdem sagt „Ich kann nicht mehr geben“?
Franziskus: Es ist alles vereint, es ist harmonisch. Man kann sich den Menschen nicht ohne die Natur vorstellen, und man kann sich die Natur nicht ohne den Menschen vorstellen. Es ist wie in der Genesis: „Seid fruchtbar, mehret euch und macht euch die Erde untertan“. Untertan machen bedeutet, mit der Erde in Einklang zu treten, um sie fruchtbar zu machen. Und wir haben diese Berufung. Es gibt einen Ausdruck der Ureinwohner des Amazonas, den ich liebe: „gut leben“. Sie haben diese Philosophie des guten Lebens, die nichts mit unserem porteño [Sprache der Einwohner von Buenos Aires] ‚Spaß haben‘ oder dem italienischen ‚dolce vita‘ zu tun hat. Für sie geht es darum, im Einklang mit der Natur zu leben. Was wir brauchen, ist eine innere Entscheidung der Menschen und Länder. Eine Bekehrung, würden wir sagen. Als mir gesagt wurde, daß Laudato si’ eine schöne Umweltenzyklika sei, habe ich geantwortet, daß sie das nicht sei, sondern „eine Sozialenzyklika“. Denn wir können das Soziale nicht vom Ökologischen trennen. Das Leben von Männern und Frauen entwickelt sich in einem bestimmten Umfeld.
Das erinnert mich an ein spanisches Sprichwort, ich hoffe, es ist nicht zu sehr guarango [flegelhaft], das besagt: „Wer in den Himmel spuckt, dem fällt es auf den Kopf“. Mit der Mißhandlung der Natur verhält es sich ähnlich. Die Natur fordert ihren Tribut. Ich wiederhole: Die Natur verzeiht nie, aber nicht, weil sie rachsüchtig ist, sondern weil wir Degenerationsprozesse in Gang setzen, die nicht mit unserem Wesen übereinstimmen. Vor ein paar Jahren war ich entsetzt, als ich das Foto eines Schiffes sah, das zum ersten Mal den Nordpol passiert hatte. Der schiffbare Nordpol! Was bedeutet das? Daß das Eis aufgrund der Erwärmung aufbricht, sich auflöst. Wenn wir so etwas sehen, müssen wir dem Einhalt gebieten. Und es sind die jungen Leute, die das am meisten merken. Wir Erwachsenen sind nicht daran gewöhnt, wir sagen ‚das ist nicht schlimm‘ oder wir verstehen es einfach nicht.
Junge Menschen, Politik und Haßreden
Bernarda Llorente (Télam): Junge Menschen scheinen, wie Sie sagen, ein größeres ökologisches Bewußtsein zu haben, aber es scheint oft segmentiert zu sein. Heute gibt es weniger politisches Engagement, und selbst bei den Wahlen ist die Beteiligung der unter 35jährigen sehr gering. Was würden Sie diesen jungen Menschen sagen? Wie können Sie dazu beitragen, ihnen wieder Hoffnung zu geben?
Franziskus: Sie haben hier einen schwierigen Punkt angesprochen, nämlich das politische Desinteresse junger Menschen: Warum engagieren sie sich nicht in der Politik, warum spielen sie nicht mit? Weil sie entmutigt sind. Sie haben – ich sage nicht alle, um Himmels willen – Situationen von mafiösen Geschäften und Korruption erlebt. Wenn die jungen Leute eines Landes sehen, daß man „sogar ihre Mutter verkaufen“ kann, um ein Geschäft zu machen, dann sinkt die politische Kultur. Und deshalb wollen sie sich auch nicht in die Politik einmischen. Doch wir brauchen sie, denn sie sind diejenigen, die die Rettung der weltweiten Politik vorschlagen müssen. Und warum Rettung? Denn wenn wir unsere Haltung gegenüber der Umwelt nicht ändern, werden wir alle untergehen. Aber wir brauchen sie, weil sie es sind, die die Rettung der universellen Politik vorschlagen müssen. Und warum die Rettung? Denn wenn wir unsere Haltung gegenüber der Umwelt nicht ändern, werden wir alle untergehen. Im Dezember hatten wir ein wissenschaftlich-theologisches Treffen zu dieser Umweltsituation. Und ich erinnere mich, daß der Direktor der Italienischen Akademie der Wissenschaften sagte: „Wenn sich das nicht ändert, wird meine Enkelin, die gestern geboren wurde, in 30 Jahren in einer unbewohnbaren Welt leben müssen“. Deshalb sage ich den jungen Menschen, daß es nicht nur darum geht, zu protestieren, sondern daß sie auch Wege finden müssen, die Prozesse in die Hand zu nehmen, die uns helfen werden zu überleben.
Bernarda Llorente (Télam): Glauben Sie, daß ein Teil der Frustration einiger junger Menschen dazu führt, daß sie sich von Haßreden und extremen politischen Optionen verführen lassen?
Franziskus: Der Prozeß eines Landes, der Prozeß der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, bedarf einer ständigen Neubewertung und einer ständigen Konfrontation mit anderen. Die politische Welt ist dieser Kampf der Ideen, der Positionen, der uns läutert und uns gemeinsam voranbringt. Die jungen Menschen müssen diese Wissenschaft der Politik, des Zusammenlebens, aber auch des politischen Kampfes lernen, der uns vom Egoismus reinigt und uns voranbringt. Es ist wichtig, jungen Menschen bei diesem gesellschaftspolitischen Engagement zu helfen und nicht „einen Briefkasten zu verkaufen“. Aber ich glaube, daß die jungen Leute heute klüger sind. Zu meiner Zeit hat man uns nicht ‚einen Briefkasten verkauft‘, sondern gleich das Hauptpostamt. Heute sind sie viel wacher und lebendiger. Ich habe großes Vertrauen in junge Menschen. „Ja, aber sie kommen nicht zur Messe“, sagt mir ein Priester. Ich antworte, daß wir ihnen helfen müssen, zu wachsen und sie begleiten müssen. Dann wird Gott zu jedem einzelnen von ihnen sprechen. Aber wir müssen sie wachsen lassen. Wenn junge Menschen nicht die Protagonisten der Geschichte sind, sind wir erledigt. Denn sie sind die Gegenwart und die Zukunft.
Bernarda Llorente (Télam): Vor ein paar Tagen haben Sie über die Bedeutung des Dialogs zwischen den Generationen gesprochen.
Franziskus: In diesem Zusammenhang möchte ich etwas sagen, was ich immer wieder gerne betone: Wir müssen den Dialog zwischen jung und alt wieder aufnehmen. Die Jungen müssen sich mit ihren Wurzeln auseinandersetzen, und die Alten müssen sich bewußt sein, daß sie ein Erbe hinterlassen. Der junge Mensch, der seinem Großvater oder seiner Großmutter begegnet, erhält einen Saft, empfängt Dinge und trägt sie weiter. Und der alte Mann, wenn er seinen Enkel oder seine Enkelin trifft, hat Hoffnung. Es gibt eine sehr schöne Zeile von Bernárdez, ich weiß nicht, in welchem Gedicht, die lautet: „Was der Baum an Blumen hat, kommt von dem, was er vom Boden hat“. Da steht nicht: „Die Blumen kommen von dort unten“. Nein, die Blumen sind oben. Aber dieser Dialog von oben nach unten, der von den Wurzeln ausgeht und weitergeführt wird, ist die wahre Bedeutung der Tradition. Mir ist auch ein Zitat des Komponisten Gustav Mahler aufgefallen: „Tradition ist die Garantie für die Zukunft“. Es handelt sich nicht um ein Museumsstück. Es ist das, was dir Leben gibt, solange es dich wachsen läßt. Alles andere wäre ein Rückschritt und damit ein ungesunder Konservatismus. „Weil das schon immer so gemacht wurde, wage ich keinen Schritt nach vorne“, so die Begründung. Vielleicht bedarf dies einer weiteren Erklärung, aber ich gehe auf den Kern des Dialogs der Jungen mit den Alten ein, denn darin liegt die wahre Bedeutung der Tradition. Es ist kein Traditionalismus. Es ist die Tradition, die uns wachsen läßt, sie ist die Garantie für die Zukunft.
Die Übel der Zeit
Bernarda Llorente (Télam): Franziskus, Sie beschreiben oft drei Übel der Zeit: Narzißmus, Entmutigung und Pessimismus. Wie kann man sie bekämpfen?
Franziskus: Die drei von Ihnen genannten Dinge – Narzißmus, Entmutigung und Pessimismus – sind Teil der sogenannten Spiegelpsychologie. Narziß schaute natürlich in den Spiegel. Und dieser Blick auf sich selbst ist kein Blick nach vorne, er ist ein Blick zurück und ein ständiges Lecken der eigenen Wunde. Dabei ist es in Wirklichkeit die Philosophie des Andersseins, die uns wachsen läßt. Wenn es im Leben keine Konfrontation gibt, kann man nicht wachsen. Die drei von Ihnen genannten Dinge sind die des Spiegels: Ich schaue ihn an, um mich selbst zu betrachten und mich zu beschweren. Ich erinnere mich an eine Ordensfrau, die sich ständig beschwerte, und im Kloster nannte man sie ‚Schwester Beschwerde‘. Nun, es gibt Leute, die sich ständig über die Übel der Zeit beklagen. Aber es gibt etwas, das gegen diesen Narzißmus, die Entmutigung und den Pessimismus sehr hilft: Sinn für Humor. Es ist das, was uns menschlicher macht. Es gibt ein wunderschönes Gebet des heiligen Thomas Morus, das ich seit mehr als 40 Jahren jeden Tag bete und das mit der Bitte beginnt: „Gib mir, Herr, eine gute Verdauung und auch etwas zum Verdauen. Gib mir einen Sinn für Humor, damit ich einen Witz zu schätzen weiß [„Gib mir, o Herr, einen Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Witz zu verstehen“, Anm. Télam] Sinn für Humor relativiert vieles und tut gut. Es widerspricht diesem Geist des Pessimismus, des „Jammerns“. Es war Narziß, nicht wahr? Zurück zum Spiegel. Typischer Narzißmus.
Bernarda Llorente (Télam): Schon 2014 haben Sie behauptet, die Welt stehe vor einem Dritten Weltkrieg, und heute bestätigt die Realität Ihre Vorhersage. Ist der Mangel an Dialog und Zuhören ein verschärfender Faktor in der derzeitigen Situation?
Franziskus: Der Ausdruck, den ich damals verwendete, war ‚Weltkrieg in Stücken‘. Was in der Ukraine geschieht, erleben wir hautnah mit, und deshalb sind wir besorgt, aber denken Sie an Ruanda vor 25 Jahren, an Syrien vor 10 Jahren, an den Libanon mit seinen internen Kämpfen oder an Myanmar heute. Was wir hier sehen, geschieht schon seit langem. Ein Krieg ist leider eine Grausamkeit pro Tag. Im Krieg tanzt man nicht das Menuett, man tötet. Und es gibt eine ganze Struktur von Waffenverkäufen, die dies begünstigt. Jemand, der sich mit Statistiken auskennt, hat mir gesagt – ich erinnere mich nicht an die Zahlen –, daß es keinen Hunger mehr in der Welt gäbe, wenn ein Jahr lang keine Waffen hergestellt würden. Ich denke, es ist an der Zeit, das Konzept des „gerechten Krieges“ zu überdenken. Es kann einen gerechten Krieg geben, es gibt das Recht, sich zu verteidigen, aber die Art und Weise, wie der Begriff heute verwendet wird, muß überdacht werden. Ich habe erklärt, daß der Einsatz und der Besitz von Atomwaffen unmoralisch ist. Die Dinge mit einem Krieg zu lösen, bedeutet, die Fähigkeit des Menschen zum Dialog, zum Konstruktiven, zu verleugnen. Diese Fähigkeit zum Dialog ist sehr wichtig. Ich verlasse den Krieg und gehe zum allgemeinen Verhalten über. Schauen Sie, wenn Sie sich mit jemandem unterhalten und bevor Sie fertig sind, werden Sie unterbrochen und wird Ihnen erwidert. Wir wissen nicht, wie wir uns gegenseitig zuhören sollen. Wir erlauben dem anderen nicht, seine eigene Meinung zu sagen. Wir müssen zuhören. Hört zu, was er sagt, empfangt. Wir erklären den Krieg vorher, das heißt, wir brechen den Dialog ab. Denn Krieg ist im wesentlichen ein Mangel an Dialog.
Als ich 2014 anläßlich des hundertsten Jahrestages des Krieges von 1914 nach Redipuglia fuhr, sah ich auf dem Friedhof das Alter der Toten und weinte. Ich habe an diesem Tag geweint. Am 2. November, einige Jahre später, besuchte ich den Friedhof von Anzio, und als ich das Alter der toten Jungen sah, weinte ich auch. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Welche Grausamkeit. Und als der Jahrestag der Landung in der Normandie begangen wurde, dachte ich an die 30.000 Jungen, die leblos am Strand zurückgelassen wurden. Sie öffneten die Boote und erhielten den Befehl: „Runter, runter“, während die Nazis auf sie warteten. Ist das gerechtfertigt? Ein Besuch auf den Soldatenfriedhöfen in Europa hilft, dies zu erkennen.
Die Krise der Institutionen
Bernarda Llorente (Télam): Versagen die multilateralen Organisationen angesichts dieser Kriege? Ist es möglich, durch sie Frieden zu erreichen? Ist es machbar, gemeinsame Lösungen zu suchen?
Franziskus: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viel Hoffnung in die Vereinten Nationen. Ich möchte niemanden beleidigen, ich weiß, daß dort sehr gute Leute arbeiten, aber im Moment haben sie keine Macht, sich durchzusetzen. Sie helfen, Kriege zu vermeiden, und ich denke dabei an Zypern, wo argentinische Truppen stationiert sind. Aber um einen Krieg zu beenden, um eine Konfliktsituation zu lösen, wie wir sie heute in Europa oder in anderen Teilen der Welt erleben, hat die UNO keine Macht. Nichts für ungut. Es ist so, daß die Verfassung, die sie hat, ihr keine Macht gibt.
Bernarda Llorente (Télam): Haben sich die Kräfteverhältnisse in der Welt geändert und hat sich das Gewicht einiger Institutionen verändert?
Franziskus: Das ist eine Frage, die ich nicht zu sehr verallgemeinern möchte. Ich möchte es so ausdrücken: Es gibt einige verdiente Institutionen, die sich in einer Krise oder, schlimmer noch, in einem Konflikt befinden. Jene, die sich in einer Krise befinden, geben mir Hoffnung auf mögliche Fortschritte. Jene, die sich in einem Konflikt befinden, sind damit beschäftigt, Lösungen für interne Probleme zu finden. Im Moment sind Mut und Kreativität gefragt. Ohne diese beiden Dinge werden wir keine internationalen Institutionen haben, die uns helfen können, diese sehr ernsten Konflikte, diese tödlichen Situationen zu überwinden.
Zeit, Bilanz zu ziehen
Bernarda Llorente (Télam): Im Jahr 2023 werden 10 Jahre seit Ihrer Wahl in den Vatikan vergangen sein, ein ideales Jubiläum, um Bilanz zu ziehen. Konnten Sie alle Ihre Ziele erreichen? Welche Projekte stehen noch aus?
Franziskus: Die Dinge, die ich getan habe, habe ich nicht erfunden oder mir nach einer Nacht mit Verdauungsstörungen ausgedacht. Ich habe alles gesammelt, was die Kardinäle bei den Treffen vor dem Konklave gesagt haben, was der nächste Papst tun sollte. Dann wurde gesagt, was geändert werden muß, welche Punkte angefasst werden müssen. Was ich in Gang gesetzt habe, war das, worum man mich gebeten hat. Ich glaube nicht, daß es etwas Originelles war, was ich getan habe, sondern eher, daß ich das umgesetzt habe, was von uns allen gewünscht wurde. So mündete die Kurienreform in der neuen Apostolischen Konstitution Praedicate Evangelium, mit der wir nach achteinhalb Jahren Arbeit und Konsultationen die von den Kardinälen geforderten und bereits in die Praxis umgesetzten Änderungen umsetzen konnten. Heute gibt es eine missionarische Erfahrung. Praedicate Evangelium, das heißt: „Seid missionarisch“, predigt das Wort Gottes. Mit anderen Worten: Das Wichtigste ist, rauszugehen.
Kurios: Bei diesen Treffen sagte ein Kardinal, daß Jesus im Text der Apokalypse sagt: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn mir jemand öffnet, werde ich eintreten“. Dann sagte er: „Jesus klopft immer wieder an, aber damit wir ihn rauslassen, weil wir ihn gefangenhalten“. Darum wurde bei diesen Kardinalsversammlungen gebeten. Und als ich gewählt wurde, habe ich das in Gang gesetzt. Einige Monate später fanden erste Konsultationen statt, bis die neue Verfassung fertig gestellt war. Und in der Zwischenzeit wurden Änderungen vorgenommen. Mit anderen Worten: Das sind nicht meine Ideen. Damit das klar ist. Es sind die Ideen des gesamten Kardinalskollegiums, das dies gefordert hat.
Bernarda Llorente (Télam): Aber es gibt ihre Prägung, eine Prägung durch die lateinamerikanische Kirche?
Franziskus: Ja, die gibt es.
Bernarda Llorente (Télam): Wie hat diese Perspektive die Veränderungen ermöglicht, die wir heute erleben?
Franziskus: Die lateinamerikanische Kirche hat eine lange Geschichte der Volksnähe. Wenn wir die Bischofskonferenzen betrachten – die erste in Medellín, dann in Puebla, Santo Domingo und Aparecida –, so stand sie immer im Dialog mit dem Volk Gottes. Und das hat sehr geholfen. Sie ist eine Volkskirche, im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelt sich um eine Kirche des Volkes Gottes, die denaturiert wurde, als das Volk sich nicht mehr äußern durfte, und schließlich zu einer Kirche der Vorarbeiter wurde, in der die Seelsorger das Sagen hatten. Das Volk drückte sich aber immer religiöser aus und wurde schließlich zum Protagonisten seiner Geschichte.
Es gibt einen argentinischen Philosophen, Rodolfo Kusch, der am besten erfaßt hat, was ein Volk ist. Da ich weiß, daß man mich hören wird, empfehle ich die Lektüre von Kusch. Er ist einer der großen argentinischen Denker und hat Bücher über die Philosophie des Volkes geschrieben. Zum Teil hat die lateinamerikanische Kirche diese Erfahrung gemacht, auch wenn es Versuche der Ideologisierung gab, wie etwa das Instrument der marxistischen Analyse der Wirklichkeit für die Befreiungstheologie. Es war eine ideologische Instrumentalisierung, ein Weg der Befreiung – sagen wir es mal so – der lateinamerikanischen Volkskirche. Aber die Völker sind eine Sache, der Populismus ist eine andere.
Die Lehre der Peripherie
Bernarda Llorente (Télam): Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden?
Franziskus: In Europa muß ich das immer wieder sagen. Dort haben sie eine sehr traurige Erfahrung mit dem Populismus gemacht. Es gibt ein Buch, das gerade erschienen ist, „Syndrom 1933“, das zeigt, wie sich Hitlers Populismus entwickelte. Deshalb sage ich gerne: Verwechseln wir nicht Populismus mit Popularismus. Volkstümlichkeit bedeutet, daß das Volk seine eigenen Angelegenheiten regelt, seine Wünsche im Dialog äußert und souverän ist. Populismus hingegen ist eine Ideologie, die die Leute zusammenklebt und versucht, sie in eine Richtung zu lenken. Und wenn man hier mit ihnen über Faschismus und Nazismus spricht, verstehen sie, was Populismus ist. Die lateinamerikanische Kirche weist in einigen Fällen Aspekte der ideologischen Unterwerfung auf. Es hat sie gegeben und wird sie auch weiterhin geben, denn das ist eine menschliche Einschränkung. Aber es ist eine Kirche, die ihre Volksfrömmigkeit immer besser zum Ausdruck bringen konnte und kann, zum Beispiel ihre Religiosität und ihre volkstümliche Organisation.
Wenn Sie feststellen, daß die Misachicos (Misachicos sind kleine Prozessionen, die von Familien oder Gruppen organisiert werden, die das Bild eines Heiligen tragen, typisch für den Nordwesten Argentiniens, Anm. Télam) aus 3.000 Metern Höhe herunterkommen, dann gibt es dort eine religiöse Einheit, die kein Aberglaube ist, weil sie sich mit ihr identifizieren. Die lateinamerikanische Kirche ist in diesem Bereich stark gewachsen. Und es ist auch eine Kirche, die es verstanden hat, die Ränder zu pflegen, weil man die wahre Wirklichkeit von dort aus sieht.
Bernarda Llorente (Télam): Warum kommt der wahre Wandel von den Rändern?
Franziskus: Ich war beeindruckt von einem Vortrag der inzwischen verstorbenen Philosophin Amelia Podetti, in dem sie sagte: „Europa sah das Universum, als Magellan den Süden erreichte“. Mit anderen Worten: Es verstand sich selbst von der größeren Peripherie aus. Die Peripherie läßt uns das Zentrum verstehen. Man kann zustimmen oder nicht, aber wenn man wissen will, was ein Volk fühlt, muß man sich an die Ränder begeben. Die existenziellen Ränder, nicht nur die sozialen.
Gehen Sie zu den Rentnern, zu den Kindern, gehen Sie in die Viertel, in die Fabriken, in die Universitäten, gehen Sie dorthin, wo sich der Alltag abspielt. Und dort zeigen sich die Menschen. Die Orte, an denen sich die Menschen freier ausdrücken können. Das ist für mich der Schlüssel. Eine Politik aus dem Volk, die kein Populismus ist. Respekt vor den Werten der Menschen, Respekt vor dem Rhythmus und dem Reichtum eines Volkes.
Bernarda Llorente (Télam): In den vergangenen Jahren hat Lateinamerika begonnen, durch den Aufbau volksnaher und integrativer Projekte Alternativen zum Neoliberalismus aufzuzeigen. Wie sehen Sie Lateinamerika als Region?
Franziskus: Lateinamerika befindet sich noch immer auf dem langsamen Weg des Kampfes, des Traums von San Martín und Bolívar von der Einheit der Region. Es war immer ein Opfer des ausbeuterischen Imperialismus und wird es auch bleiben, solange es sich nicht befreien wird. Das gilt für alle Länder. Ich möchte sie nicht erwähnen, weil sie so offensichtlich sind, daß jeder sie sieht. Der Traum von San Martín und Bolívar ist eine Prophezeiung, die Begegnung aller lateinamerikanischen Völker mit der Souveränität, jenseits von Ideologien. Darauf müssen wir hinarbeiten, um die Einheit Lateinamerikas zu erreichen. Wo jedes Volk das Gefühl hat, daß es seine eigene Identität hat und gleichzeitig die Identität des anderen braucht. Das ist nicht einfach.
„Die wahre Realität sieht man von den Rändern aus“
Bernarda Llorente (Télam): Sie zeigen einen Weg auf, der auf bestimmten politischen Prinzipien beruht.
Franziskus: Es gibt vier politische Grundsätze, die mir helfen, nicht nur dabei, sondern auch bei der Lösung von Problemen in der Kirche. Vier Prinzipien, die philosophisch, politisch oder sozial sind, was immer Sie wollen. Ich werde sie erwähnen:
- „Die Wirklichkeit kommt vor der Idee“, mit anderen Worten, wenn man sich dem Idealismus verschreibt, verliert man; es ist die Wirklichkeit, die die Realität berührt.
- „Das Ganze kommt vor dem Teil“, d. h. immer die Einheit des Ganzen anstreben.
- „Einheit ist besser als Konflikt“, mit anderen Worten: Wenn man den Konflikt begünstigt, schadet man der Einheit.
- „Die Zeit kommt vor dem Raum“, wobei zu beachten ist, daß der Imperialismus immer versucht, den Raum zu besetzen, während die Größe der Völker darin besteht, Prozesse in Gang zu setzen.
Diese vier Grundsätze haben mir immer geholfen, ein Land, eine Kultur oder die Kirche zu verstehen. Es sind menschliche Prinzipien, Prinzipien der Integration. Und es gibt noch andere Prinzipien, die eher ideologischer Natur sind, nämlich die der Desintegration. Aber das Nachdenken über diese vier Grundsätze ist sehr hilfreich.
Medienmanipulation
Bernarda Llorente (Télam): Sie sind vielleicht die wichtigste Stimme der Welt, wenn es um soziale und politische Führerschaft geht. Haben Sie manchmal das Gefühl, daß Sie mit Ihrer dissonanten Stimme die Möglichkeit haben, viele Dinge zu verändern?
Franziskus: Daß sie dissonant ist, habe ich manchmal gespürt. Ich glaube, daß sich meine Stimme ändern kann, aber ich glaube nicht zu sehr daran, weil es einem wehtun kann. Ich sage das, was ich fühle, vor Gott, vor den anderen, mit Ehrlichkeit und mit dem Wunsch zu dienen. Ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber, ob sich dadurch etwas ändern wird oder nicht. Mir geht es mehr darum, Dinge zu sagen und ihnen zu helfen, sich selber zu ändern. Ich glaube, daß es in der Welt und insbesondere in Lateinamerika eine große Kraft gibt, die Dinge mit diesen vier Prinzipien, die ich gerade genannt habe, zu verändern.
Und es stimmt, daß, wenn ich spreche, alle sagen: „Der Papst hat gesprochen und dies gesagt“. Aber es ist auch wahr, daß sie einen Satz aus dem Zusammenhang reißen und dich dazu bringen, etwas zu sagen, was du nicht gemeint hast. Mit anderen Worten: Man muß sehr vorsichtig sein. Im Zusammenhang mit dem Krieg gab es zum Beispiel einen ganzen Streit über eine Aussage, die ich in einer Jesuitenzeitschrift gemacht hatte: Ich sagte: „Es gibt hier keine Guten und keine Bösen“, und ich erklärte, warum. Aber sie nahmen nur diese Aussage und sagten: „Der Papst verurteilt Putin nicht!“ In Wirklichkeit ist der Kriegszustand etwas viel Allgemeingültigeres, Ernsteres, und es gibt hier keine Guten und Bösen. Wir sind alle betroffen, und das müssen wir lernen.
Bernarda Llorente (Télam): Die Welt ist immer ungleicher geworden, und das spiegelt sich auch in den Medien wider, die durch die Konzentration der Unternehmen, die digitalen Plattformen und die sozialen Netzwerke immer mehr Macht in der Produktion von Diskursen gewinnen. Welche Rolle sollten Ihrer Meinung nach die Medien in diesem Zusammenhang spielen?
Franziskus: Ich vertrete den Grundsatz „Die Realität kommt vor der Idee“. Ich erinnere mich an ein Buch des Philosophen Simone Paganini, Professor an der Universität Aachen, in dem er über Kommunikation und die Spannungen spricht, die zwischen dem Autor eines Buches, dem Leser und der Kraft des Buches selbst bestehen. Er argumentiert, daß sowohl bei der Kommunikation als auch bei der Lektüre des Buches eine Spannung entsteht. Und das ist der Schlüssel zur Kommunikation. Denn in gewisser Weise muß die Kommunikation in eine Beziehung gesunder Spannung eintreten, die den anderen zum Nachdenken anregt und ihn zu einer Antwort veranlaßt. Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich nur um Information.
Die menschliche Kommunikation – und er spricht von Journalisten, Kommunikatoren, was auch immer – muß in die Dynamik dieser Spannung einbezogen werden. Wir müssen uns bewußt sein, daß Kommunikation bedeutet, sich zu engagieren. Und wir müssen uns sehr bewußt sein, daß wir uns gut einbringen müssen. Zum Beispiel gibt es die Objektivität. Ich kommuniziere etwas und sage: „Das ist passiert, ich denke das“. Das ist mein Einsatz, und ich bin offen für die Antwort meines Gegenübers. Wenn ich aber mitteile, was passiert ist, indem ich es beschneide, ohne zu sagen, daß ich es beschneide, bin ich unehrlich, weil ich keine Wahrheit mitteile. Man kann eine Wahrheit nicht objektiv kommunizieren, denn wenn ich sie kommuniziere, werde ich sie mit meiner Soße versehen. Deshalb ist es wichtig zu unterscheiden: „Das ist passiert und das denke ich, ist passiert“. Heute führt das „Ich denke“ leider zu einer Verzerrung der Realität. Und das ist sehr ernst.
Bernarda Llorente (Télam): Sie haben bei mehreren Gelegenheiten über die Sünden der Kommunikation gesprochen.
Franziskus: Ich habe dies zum ersten Mal auf einer Konferenz in Buenos Aires gesagt, als ich Erzbischof war. Es kam mir in den Sinn, von den vier Sünden der Kommunikation, des Journalismus, zu sprechen. Erstens: Desinformation: Ich sage, was mir passt, und verschweige das andere. Nein, sie dürfen nicht desinformieren. Zweitens: Verleumdung. Sie erfinden Dinge und zerstören manchmal eine Person mit einer Mitteilung. Drittens die Verleumdung, die keine üble Nachrede ist, aber eine Person auf einen Gedanken reduziert, den sie in einer anderen Zeit hatte, aber bereits geändert hat. Das ist so, als würde dir ein Erwachsener schmutzige Windeln aus deiner Kindheit mitbringen. Als ich ein Kind war, habe ich auch so gedacht. Das hat sich geändert, jetzt ist es so. Und für die vierte Sünde habe ich das Fachwort Koprophilie verwendet, also die Liebe zu Exkrementen [Franziskus verwendet ein deftigeres Wort], die Liebe zum Dreck. Das heißt, man will sich schmutzig machen, man will einen Skandal um des Skandals willen. Ich erinnere mich, daß Kardinal Antonio Quarracino sagte: „Ich lese diese Zeitung nicht, denn wenn ich das tue, spritzt das Blut heraus“. Es ist die Liebe zum Schmutzigen, zum Häßlichen.
Ich glaube, daß die Medien darauf achten müssen, nicht in Desinformation, Verleumdung, Diffamierung und Koprophilie zu verfallen. Ihr Wert besteht darin, die Wahrheit auszudrücken. Ich sage die Wahrheit, aber ich bin derjenige, der sie ausdrückt, und ich füge meine eigene Soße dazu. Aber ich stelle klar, was meine Soße ist und was objektiv ist. Und ich übermittle sie. In dieser Übertragung geht manchmal die Ehrlichkeit ein wenig verloren: Von der mündlichen Überlieferung geht man also in einen ersten Schritt über, bei dem Rotkäppchen vor dem Wolf flieht, der sie fressen will, und landet am Ende der Übertragung bei einem Bankett, bei dem die Großmutter und Rotkäppchen den Wolf essen. Man muß darauf achten, daß die Kommunikation das Wesen der Realität nicht verändert.
Kommunikation und Macht
Bernarda Llorente (Télam): Welchen Wert messen Sie der Kommunikation bei?
Franziskus: Kommunikation ist etwas Heiliges. Sie ist vielleicht eines der schönsten Dinge, die ein Mensch hat. Kommunikation ist göttlich, und man muß wissen, wie man sie mit Ehrlichkeit und Authentizität betreibt. Ohne etwas von mir hinzuzufügen und zu sagen: „Das ist passiert, ich denke, es muß so sein, oder ich interpretiere es so“. Machen Sie deutlich, daß Sie es sind, die etwas sagen. Heutzutage haben die Medien eine große didaktische Verantwortung: Sie sollen den Menschen Ehrlichkeit beibringen, sie sollen sie lehren, mit gutem Beispiel voranzugehen, sie sollen sie lehren, miteinander zu leben. Aber wenn man Medien hat, die den Eindruck erwecken, daß sie eine Granate in der Hand haben, um Menschen zu zerstören – mit einer selektiven Wahrheit, mit Verleumdung, mit Diffamierung oder damit, sie in den Schmutz zu ziehen – dann wird das niemals ein Volk wachsen lassen.
Ich verlange von den Medien diese gesunde Objektivität, was nicht bedeutet, daß es sich um destilliertes Wasser handelt. Ich wiederhole: „So ist es, und das ist meine Meinung“. Sie gehen da raus, aber machen Sie deutlich, was Sie denken. Das ist sehr edel. Aber wenn man mit dem Programm einer bestimmten politischen Bewegung, einer bestimmten Partei spricht, ohne zu sagen, was es ist, dann ist das schäbig und nicht gut. Um ein guter Kommunikator zu sein, muß der Kommunikator gut geboren sein.
Bernarda Llorente (Télam): Viele Medien, die ihre Interessen in den Vordergrund stellen, geben einer Agenda der Globalisierung der Gleichgültigkeit nach. Das sind die Themen, die die Medien aus verschiedenen Gründen sichtbar machen oder verschweigen wollen.
Franziskus: Ja, wenn ich manchmal an Medien denke, die ihre Aufgabe leider nicht gut erfüllen, wenn ich an diese Dinge in unserer Kultur im allgemeinen, in der Weltkultur, denke, die der Gesellschaft selbst schaden, kommt mir ein Satz aus unserer Philosophie in den Sinn, der pessimistisch erscheint, aber die Wahrheit ist: „Dale que va, todo es igual, que allá en el horno se vamo“. Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, was die Wahrheit ist und was nicht. Es spielt keine Rolle, ob diese Person gewinnt oder verliert. Alles ist gleichgültig. „Dale que va“. Wenn diese Philosophie in den Medien verbreitet wird, ist das verheerend, weil es eine Kultur der Gleichgültigkeit, des Konformismus und des Relativismus schafft, die uns allen schadet.
Bernarda Llorente (Télam): Der Technologie wird oft ein gewisses Eigenleben zugeschrieben, da sie für Übel verantwortlich gemacht wird, die jenseits ihres Einsatzes begangen werden. Wie können wir in dieser technologischen Welt den Humanismus zurückgewinnen?
Franziskus: Sehen Sie, ein Operationssaal ist ein Ort, an dem die Technik bis auf den Millimeter genau eingesetzt wird. Doch welche Sorgfalt wird bei einem chirurgischen Eingriff mit den neuen Technologien walten gelassen? Denn es gibt ein Leben, um das man sich kümmern muß. Das Kriterium ist, daß die Technik immer gesehen wird, daß sie mit Menschenleben arbeitet. Wir müssen an die Operationssäle denken. Das ist die Ehrlichkeit, die wir immer haben müssen, auch in der Kommunikation. Es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Wir können nicht so tun, als wäre nichts geschehen.
Die Hirten des Volkes
Bernarda Llorente (Télam): Sie waren immer ein Hirte, aber wie kann man diese Kirche der Hirten, diese Kirche der Straße, die zu den Gläubigen spricht, weitergeben? Ist der Glaube heute anders? Hat die Welt weniger Glauben? Kann der Glaube wiedergewonnen werden?
Franziskus: Ich unterscheide gerne zwischen Volksseelsorgern und Staatsseelsorgern. Ein Geistlicher des Staates ist ein Geistlicher des französischen Hofes, wie Monsieur L’Abbé, und manchmal sind wir Priester versucht, den Machthabern zu nahe zu kommen, und das ist nicht der richtige Weg. Der wahre Weg ist das Hirtenamt. In der Mitte deines Volkes zu sein, vor deinem Volk und hinter deinem Volk. Mittendrin zu sein, es gut zu riechen, es gut zu kennen, weil man von dort geholt wurde. Vor den eigenen Leuten zu stehen und manchmal das Tempo vorzugeben. Und hinter deinen Leuten zu sein, um denen zu helfen, die zurückbleiben, und sie allein gehen zu lassen, um zu sehen, wohin sie gehen, denn Schafe haben manchmal die Intuition zu wissen, wo das Gras ist. Das ist die Aufgabe des Hirten. Ein Hirte, der allein vor dem Volk steht, geht nicht. Er muß sich engagieren und am Leben seines Volkes teilnehmen. Wenn Gott Sie zum Seelsorger macht, dann um sie zu weiden, nicht um sie zu verurteilen. Gott ist gekommen, um zu retten, nicht um zu verdammen. Das sagt der heilige Paulus, nicht ich. Retten wir die Menschen, seien wir nicht zu hart.
Was ich jetzt sage, wird einigen nicht gefallen: Es gibt ein Kapitell aus der Basilika von Vézelay, ich weiß nicht mehr, ob es von 900 oder 1100 ist. Sie wissen, daß im Mittelalter die Katechese mit Skulpturen, mit Kapitellen durchgeführt wurde. Die Menschen sahen sie und lernten. Und ein Kapitell von Vèzelay, das mich wirklich berührt hat, ist das des hängenden Judas, der vom Teufel heruntergezogen wird und auf der anderen Seite ein guter Hirte, der ihn ergreift und mit einem ironischen Lächeln davonträgt. Damit lehrt er die Menschen, daß Gott größer ist als deine Sünde, daß Gott größer ist als dein Verrat, daß du nicht verzweifeln sollst wegen des Unrechts, das du begangen hast, daß es immer jemanden gibt, der dich auf seinen Schultern tragen wird. Es ist die beste Katechese über die Person Gottes, über die Barmherzigkeit Gottes. Denn Gottes Barmherzigkeit ist keine Gabe, die er dir schenkt, sie ist er selbst. Es kann nicht anders sein. Wenn wir diesen strengen Gott präsentieren, bei dem es nur um Strafe geht, ist er nicht unser Gott. Unser Gott ist der Gott der Barmherzigkeit, der Geduld, der Gott, der nicht müde wird, zu vergeben. Das ist unser Gott. Nicht der, den wir Priester manchmal verunstalten.
Bernarda Llorente (Télam): Wenn die Gesellschaft diesem Gott und diesem Volk, das manchmal nicht gehört wird, zuhört, glauben Sie, daß es dann möglich sein wird, einen anderen Diskurs, eine Alternative zum vorherrschenden Diskurs zu konstruieren?
Franziskus: Ja, natürlich. Hegemonie ist nie gesund. Bevor ich zum Schluß komme, möchte ich noch etwas ansprechen: In unserem liturgischen Leben, im Evangelium, gibt es die Flucht nach Ägypten. Jesus muß mit seinem Vater und seiner Mutter fliehen, weil Herodes ihn töten will. Die Heiligen Drei Könige und diese ganze Geschichte. Aber da ist auch die Flucht nach Ägypten, bei der wir uns so oft vorstellen, daß sie in einer Kutsche waren und daß sie ruhig auf einem Esel erfolgte.
Vor zwei Jahren dachte ein piemontesischer Maler an das Drama eines syrischen Vaters, der mit seinem Sohn flieht, und sagte: „Das ist der heilige Josef mit dem Kind“. Was dieser Mann erleidet, ist das, was der heilige Josef damals erlitt. Es ist dieses Gemälde, das dort steht, das er mir geschenkt hat.
Bergoglio und Franziskus
Bernarda Llorente (Télam): Abgesehen von dem Stolz, einen argentinischen Papst zu haben, denke ich immer darüber nach, wie Sie sich selbst sehen: Wie sieht der Papst Bergoglio und wie würde Bergoglio Franziskus sehen?
Franziskus: Bergoglio hätte nie gedacht, daß er einmal hier landen würde. Niemals. Ich kam mit einem kleinen Koffer in den Vatikan, mit den Kleidern am Leib und ein bißchen mehr. Ich habe schon die Predigt für den Palmsonntag in Buenos Aires vorbereitet. Ich dachte mir: Am Palmsonntag wird kein Papst sein Amt antreten, also fahre ich am Samstag wieder nach Hause. Mit anderen Worten: Ich hätte nie gedacht, daß ich einmal hier sein würde. Und wenn ich dort Bergoglio und seine ganze Geschichte sehe, sprechen die Fotos für sich. Es ist die Geschichte eines Lebens mit vielen Gaben von Gott, vielen Fehlschlägen meinerseits und vielen nicht so weltbewegenden Positionen.
Man lernt im Leben, universell zu sein, barmherzig zu sein, weniger böse zu sein. Ich glaube, daß alle Menschen gut sind. Mit anderen Worten, ich sehe einen Mann, der einen Weg gegangen ist, mit Höhen und Tiefen, und so viele Freunde haben ihm geholfen, weiterzugehen. Ich habe mein Leben nie allein verbracht. Es waren immer Männer und Frauen, angefangen bei meinen Eltern, meinen Brüdern, von denen einer noch lebt, die mich begleitet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich ein einsamer Mensch bin, denn das bin ich nicht. Ein Mensch, der seinen Lebensweg ging, der studierte, der arbeitete, der Priester wurde, der tat, was er konnte. Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen.
Bernarda Llorente (Télam): Und wie würde Bergoglio den Papst sehen?
Franziskus: Ich weiß nicht, wie er ihn ansehen würde. Ich glaube, tief im Inneren würde er sagen: „Armer Kerl, was hast du nur durchgemacht!“ Aber es ist nicht so tragisch, Papst zu sein. Man kann ein guter Seelsorger sein.
Bernarda Llorente (Télam): Vielleicht würde er ihn so betrachten, wie wir alle ihn betrachten: Er würde ihn entdecken.
Franziskus: Ja, vielleicht. Aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen, mir diese Frage zu stellen, sie zu beantworten. Ich werde darüber nachdenken.
Bernarda Llorente (Télam): Haben Sie das Gefühl, daß Sie sich als Papst sehr verändert haben?
Franziskus: Manche Leute sagen mir, daß Dinge, die in meiner Persönlichkeit keimten, an die Oberfläche kamen. daß ich barmherziger geworden bin. In meinem Leben gab es strenge Phasen, in denen ich zuviel verlangte. Dann wurde mir klar, daß man diesen Weg nicht einschlagen kann, daß man wissen muß, wie man führt. Es ist diese Väterlichkeit, die Gott hat. Es gibt ein sehr schönes neapolitanisches Lied, das beschreibt, was ein neapolitanischer Vater ist. Es heißt: „Der Vater weiß, was mit dir geschieht, aber er tut so, als wüßte er es nicht“. Ein Vater weiß, wie man auf andere wartet. Er weiß, was mit dir geschieht, aber er schafft es, daß du von allein gehst, er wartet auf dich, als ob nichts geschehen wäre. Das ist ein bißchen das, was ich heute an diesem Bergoglio kritisieren würde, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, nicht immer, als Bischof etwas wohlwollender war. Aber als Jesuit war ich sehr streng. Und das Leben ist sehr schön mit Gottes Art, immer zu hoffen. Wissen, aber so tun, als wüßte man es nicht, und es reifen lassen. Es ist eine der schönsten Weisheiten, die uns das Leben schenkt.
Bernarda Llorente (Télam): Es scheint Ihnen gut zu gehen, Franziskus. Werden wir den Papst und Franziskus noch eine Weile haben?
Franziskus: Das entscheidet der oben.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Kurze Anmerkungen
von Giuseppe Nardi
Das langatmige Interview zeichnet sich bedauerlicherweise vor allem durch zwei Faktoren aus: viel Worte, wenig Substanz und Horizontales ohne Vertikales. Damit könnte man enttäuscht zur Tagesordnung übergehen. Einige Fragen seien aber erlaubt:
Gibt es für einen Papst wirklich nichts Wichtigeres zu sagen? Woher bezieht Franziskus seine Gewißheit, daß Afrika „dringend Impfstoff“ brauche? Woher bezieht er seine Gewißheit einer Mutation von Coronaviren von einer Erkältung zum… ja, wozu eigentlich… zum „Killervirus“? Woher bezieht er die Gewißheit seines klimahysterischen Narrativs? Warum widerspricht sich Franziskus damit selbst noch im selben Interview, indem er verlangt zu unterscheiden zwischen dem, „was ist“, und dem, von dem jemand nur „denkt“, daß es ist? Ebensowenig scheint er den Widerspruch zu erkennen, wenn er außerhalb eines christlichen Kontextes von einer unerbittlichen Natur redet, die „nie vergibt“, „Tribut“ verlangt, sich also „rächt“, aber zugleich die Corona-Impfung mit genmanipulierenden Seren propagiert, von denen niemand sagen kann, was sie im Körper verursachen, und diese „Impfung“, die keine ist, seinen eigenen Untergebenen sogar unter Androhung der Entlassung aufzwingt.
Franziskus spricht in einem Aufguß von Corona, Klima und Desinformation, ohne die Stolpersteine zu bemerken, weder für sich noch für die Menschen, die er durch seine Anleitung darüber stolpern läßt.
Was er zu Covid und Klima mit jener Gewißheit verkündet, mit denen er Glaubenswahrheiten verkünden sollte, macht ihn vom Glaubensverkündiger zum Ideologen, der nicht Science (Wissenschaft), sondern Science Fiction von sich gibt.
Er ignoriert, daß inzwischen der Nachweis erbracht wurde, daß SARS-CoV‑2 aus dem Labor stammt. Damit aber zerfallen alle seine Aussagen zu Staub, besonders die skurrile Warnung, ja nicht zum Zustand vor Corona zurückzukehren. Eine solche Warnung kannte man bisher nur von… ja, von Leuten wie Klaus Schwab & Co. Wäre Corona ein natürliches Virus, warum sollte man nach dessen inzwischen erfolgtem Abflauen nicht zur Normalität zurückkehren? Hier scheint sich, um es guarango wie Franziskus zu sagen, der Hund in den eigenen Schwanz zu beißen. Die einzig logisch Folgerung daraus müßte also die mahnende Forderung nach einer strengen Ächtung so gefährlicher Forschungen sein. Doch dazu schweigt sich Franziskus aus.
Ebenso wurde die CO2 zugeschriebene Relevanz für die angeblich menschengemachte Erderwärmung widerlegt. Neuere Wissenschaftsmodelle weisen in eine ganz andere, entspannte Richtung, die vor allem eines tun, was Franziskus zwar einfordert, aber selbst nicht beherzigt: die Wirklichkeit anzuerkennen.
Anmerkungen zu einer in den Papstworten anklingenden Mythisierung der Natur sollen an dieser Stelle unterbleiben. Bedenklicher ist seine Berufung auf Rodolfo Kusch. Siehe dazu: Die Unbekannte „Volk“ – Papst Franziskus enthüllt, wer ihm den „Pueblo“-Mythos erzählt hat.
Was macht Franziskus also? Er spricht nur beiläufig von Gott und gar nicht von Christus. Er gibt einige mehr oder weniger nützliche Tipps und dafür umso mehr Platitüden von sich. Er spricht vorwiegend über Politik, rehabilitiert wieder einmal Eugen Drewermann (Vézelay), natürlich ohne ihn beim Namen zu nennen, und bedient, wo er konkreter wird, kein genuines, aber präzises Narrativ, jenes der starken Mächte, jenes Establishments, das direkt mit Namen wie Klaus Schwab, Bill Gates oder George Soros und dem linksliberalen Polit-Establishemts der EU und der USA in Verbindung gebracht werden kann.
Und noch etwas fällt auf und schmerzt: Franziskus vermied es erneut, das Jahrhunderturteil des Obersten Gerichtshofes der USA für das Lebensrecht ungeborener Kinder und gegen die Abtreibung anzusprechen, geschweige denn zu loben und zugunsten des elementarsten aller Rechte, des Lebensrechts, zu nützen. Doch obwohl Franziskus selber sagt, durch das Interview gehört zu werden, empfiehlt er stattdessen, Rodolfo Kusch zu lesen.
Was bleibt von dem Mainstream-Interview? Der unangenehme Beigeschmack, durch die Lektüre die eigene Zeit vergeudet zu haben. Und das ist traurig.
Franziskus gefällt es nicht, wie die Welt die Pandemie überwindet. Da kommt einem ein Aufsatz des unvergessenen Rechtsphilosophen Mario Palmaro in den Sinn, mit dem er am 9. Oktober 2013 erklärte, warum ihm dieser Papst „nicht gefällt“.
Bild: Télam (Screenshots)