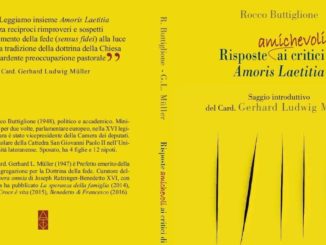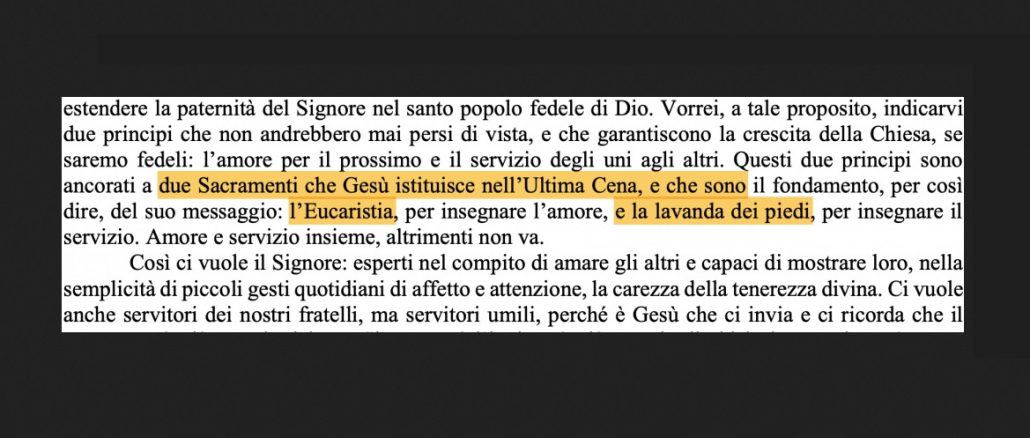
(Rom) Die Medien des Vatikans befinden sich „in völliger Verwirrung“, so der Vatikanist Sandro Magister: „Doch dem Papst gefällt das so.“ Am 19. Januar verkündete Papst Franziskus, laut vatikanischen Medien, die „explosive Sensation“, daß Jesus Christus beim Letzten Abendmahl „zwei Sakramente“ eingesetzt habe: die Eucharistie und die Fußwaschung. „Unglaublich, aber wahr“, so Magister. Und (fast) niemand bemerkte es.
Der Grund dafür ist, daß sich die sensationelle Botschaft in einem wenig beachteten Text befand. Am 19. Januar übermittelte Papst Franziskus eine Videobotschaft an die Teilnehmer „des nationalen Treffens von Bischöfen und Priestern in Venezuela“. Franziskus bediente sich darin seiner spanischen Muttersprache. Der Heilige Stuhl veröffentlichte Übersetzungen in englischer, französischer, italienischer und portugiesischer Sprache.
Laut der italienischen Übersetzung, immerhin die faktische Referenzsprache des Heiligen Stuhls, sagte Franziskus, Jesus Christus habe beim Letzten Abendmahl auch die Fußwaschung als „Sakrament“ eingesetzt. Das aber hieße, daß es nicht sieben, sondern acht Sakramente gäbe.
Vielleicht erschien diese „Möglichkeit“ einigen Medienleuten des Vatikans nicht ganz unplausibel. Seit seiner Wahl 2013 machte Papst Franziskus nämlich die heilige Liturgie des Gründonnerstags unsichtbar. Anstatt den ersten Tag des Triduum Sacrum in seiner Bischofskirche mit seinem Bistum zu zelebrieren, besucht er jedes Jahr unter Ausschluß der Öffentlichkeit eine geschlossene Einrichtung, meist ein Gefängnis. Durch die begleitende Berichterstattung wurde die Geste der Fußwaschung, die von Bedeutung, aber nicht das zentrale Element des Gründonnerstags ist, immer stärker in den Vordergrund gerückt. Sollte die Behauptung eines achten Sakraments gar dieser Linie folgen?
Im Original der Botschaft sprach Franziskus aber nicht von „dos Sacramentos“ (zwei Sakramenten), sondern von „dos instituciones“. Die Stelle wurde später auch in der italienischen Fassung mit „zwei institutiven Akten“ übersetzt. Magister bemerkte dazu:
„Daß der Kommunikationsmaschine des Vatikans ein solcher Fehler unterläuft, überrascht uns. Aber es gibt noch viel mehr. Das ist nur ein Fragment eines allgemeineren Zustandes der Verwirrung.“
Drei Tage zuvor, am 16. Januar, hatte Franziskus den Präfekten des Kommunikationsdikasteriums, Paolo Ruffini, empfangen. Zehn Tage später wurde am 23. Januar die jährliche Botschaft des Papstes zum Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel mit den üblichen Tiraden gegen „Fake News“ veröffentlicht. „Die Lehren, die der Vatikan in dieser Sache zieht, sind aber nicht einwandfrei“, so Magister, der einige Beispiele dafür anführt.
1
In den ersten Tagen des Jahres 2021 startete Papst Franziskus „mit Feuer und Flamme“. Am 2. Januar veröffentlichte die Gazzetta dello Sport, die größte Sporttageszeitung der Welt, ein großes Interview mit ihm. Darauf folgte Franziskus als Titelgeschichte der Monatszeitschrift Vanity Fair und dann als Sonderteil in der international tonangebenden Modezeitschrift Vogue. Am 10. Januar schließlich wurde von Canale 5, dem größten privaten Fernsehsender Italiens, ein „Exklusivinterview“ des Papstes von 45 Minuten Länge ausgestrahlt.
Die Medienarbeit des Vatikans scheint perfekt zu funktionieren. „Doch ein Blick hinter die Kulissen offenbart ein anderes Bild“, so Magister.
Die Veröffentlichungen in Vanity Fair und Vogue scheinen zumindest teilweise mit dem Kommunikationsdikasterium abgesprochen gewesen. Das deuten entsprechende Hinweise von Andrea Tornielli, Chefredakteur mit Richtlinien- und Koordinierungsbefugnis für alle Vatikanmedien, und von P. Antonio Spadaro, dem Schriftleiter der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, an. Beide gehören zum engen Vertrautenkreis des Papstes.
Das Interview der Gazzetta dello Sport wurde jedoch von ganz anderer Seite eingefädelt, von Don Marco Pozza, dem Gefängniskaplan von Padua. Don Pozza steht in keinem Zusammenhang mit den vatikanischen Medien und Kommunikationsstellen, ist aber seit gut drei Jahren der von Franziskus bevorzugte Medienaktivist. Einem größeren Publikum wurde Pozza durch mehrere Interviews mit Papst Franziskus bekannt, die von TV2000, dem Fernsehsender der Italienischen Bischofskonferenz, gesendet wurden. Auf eines dieser Interviews geht es zurück, daß in der italienischen Volkssprache die vorletzte Bitte des Vaterunsers geändert wurde. Die Änderung erfolgte nicht, weil es dafür eine Anweisung des Papstes oder der römischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung gab, sondern allein deshalb, weil Franziskus in dem Fernsehinterview erklärte, mit der Formulierung des Vaterunsers nicht zufrieden zu sein.
Da das Interview mit der Gazzetta dello Sport an den vatikanischen Kommunikationsbeauftragten vorbei erfolgte, wurde es von den Vatikanmedien mit keinem Wort gewürdigt. Am 3. Januar beklagte Don Pozza dieses Schweigen auf seinem persönlichen Blog samt einer Anspielung, daß das einer „Zensur“ des Papstes gleichkomme.
Nicht nur Don Pozza handelt für den Papst an den zuständigen Stellen im Vatikan vorbei, sondern auch Franziskus selbst tut das. Nachdem die Gazzetta dello Sport das Interview abgedruckt hatte, griff Franziskus zum Telefon und rief in der Redaktion an, um ihr zu gratulieren. Öffentlichkeitsarbeit mit Breitenwirkung: Doch die Zuständigen im Vatikan erfuhren es erst aus der Zeitung.
Das Interview mit Canale 5, das zentrale Aussagen des Papstes zur Corona-Impfung enthält, organisierte Franziskus persönlich. Er setzte sich direkt mit seinem Interviewer Fabio Marchese Ragona in Verbindung und vereinbarte mit diesem den Termin für die Aufzeichnungen in Santa Marta. Übrigens auch in diesem Fall mit Unterstützung von Don Pozza, der dann auch Studiogast des Senders war, um das Interview am Tag der Ausstrahlung zu kommentieren und die darin getätigten Aussagen des Papstes zu unterstützen, auch jene, daß es eine „moralische Pflicht“ zur Corona-Impfung gebe. Dabei hatte Mitte Dezember 2020 die Glaubenskongregation die Einführung einer Impfpflicht mit Billigung von Franziskus ausdrücklich abgelehnt. Die Ablehnung einer gesetzlichen Impfpflicht bei gleichzeitiger Behauptung einer moralischen Impfpflicht wird von Beobachtern jener päpstlichen „Raffinesse“ zugeschrieben, versteckt durch die Hintertür doch erreichen zu wollen, was man offiziell an der Vordertür ablehnt.
Waren bisher alle Interviews von Medienmitarbeitern des Vatikans aufgezeichnet, geschnitten und kontrolliert worden, machte Canale 5 diesmal die Aufnahmen selbst und ohne jede Beteiligung vatikanischer Stellen. Franziskus selbst hatte es möglich gemacht.
Immer mit Unterstützung von Don Pozza und außervatikanischen Medienleuten werden demnächst von Canale 9, dem italienischen Kanal von Discovery, weitere Interviews mit Papst Franziskus ausgestrahlt werden. Dabei wird es um die vier Kardinaltugenden und die drei Göttlichen Tugenden gehen. Erst recht am Kommunikationsdikasterium vorbei erfolgte die Entstehung von gleich vier neuen Filmen mit dem Papst, die von Netflix produziert und gesendet werden.
2
Ein weiterer beispielhafter Fall waren zwischen November und Dezember Breitseiten gegen die Abtreibung, die Franziskus in einigen Privatbriefen an argentinische Freunde abfeuerte, als das Parlament seiner Heimat über die Legalisierung der Tötung ungeborener Kinder abstimmte.
Der Inhalt dieser Briefe wurde nicht von Franziskus, sondern von den Empfängern bekanntgemacht. Franziskus selbst hüllte sich öffentlich und offiziell sowohl vor als auch nach der Verabschiedung des Gesetzes in Schweigen.
Magister hatte in der Vergangenheit darauf aufmerksam gemacht, daß Franziskus, wenn er, selten genug, gegen die Abtreibung Stellung nimmt, von den Medien ignoriert wird. Über seine Briefe nach Argentinien berichteten nicht einmal die Vatikanmedien. Seine Stellungnahmen zur Abtreibungsfrage werden von weltlichen Medien konsequent übergangen, während sie ihm ansonsten breiten und wohlwollenden Raum schenken.
Der Annahme, es handle sich dabei um eine Art von Zensur, widersprach am 17. Dezember der argentinische Philosoph José Arturo Quarracino, dessen Zuschrift Magister auf seinem Blog Settimo Cielo veröffentlichte. Der Philosoph ist ein Neffe von Kardinal Antonio Quarracino, dem Vorgänger Bergoglios als Erzbischof von Buenos Aires. Kardinal Quarracino machte Bergoglios Aufstieg möglich, indem er ihn zunächst von Rom als seinen Weihbischof und dann als seinen Koadjutor mit Nachfolgerecht erbat.
Sein Neffe José Arturo Quarracino empörte sich, daß Franziskus zwar gelegentlich harte Worte gegen die Abtreibung äußert, das aber so tue, daß sie in den großen Medien keine Resonanz finden und die breite Öffentlichkeit gar nicht erreichen können. Der Papst werde in der Abtreibungsfrage nicht Opfer einer Medienzensur, sondern passe sich selbst der Tabuisierung der Lebensrechtsfrage an. Anders gesagt: Das Schweigen in der Abtreibungsfrage ist ein päpstliches Ziel selbst dann, wenn er mit starken Worten die Abtreibung verurteilt.
Dabei beklagte Franziskus in einem seiner Privatbriefe selbst, daß man durch die Medien nicht erfahre, was er, der Papst, sage. Man erfahre nur, „was sie sagen, daß ich sage“ oder nur vom „Hörensagen“. Deshalb bevorzuge er Interviews, um ohne Vermittlung direkt mit dem Volk zu kommunizieren.
Damit scheint Franziskus rechtfertigen zu wollen, was er in der Abtreibungsfrage selbst anstrebt, denn in seinen Interviews spricht er Themen wie die Abtreibungsfrage nicht an. Darin bestätigt sich, daß das Schweigen dazu von ihm bewußt gewählt ist.
Politiker wie Alberto Fernández, der amtierende linksperonistische Staatspräsident von Argentinien, der soeben die Abtreibung legalisierte, und der soeben angelobte neue US-Präsident Joe Biden, der als Vertreter des linksliberalen Establishments sogleich ankündigte, das „Recht“ auf Abtreibung auch im letzten Winkel der Erde durchsetzen zu wollen, wissen das päpstliche Schweigen sicher zu schätzen.
3
Aber es gibt Interview und Interview. Einen ganz speziellen Fall stellen die zahlreichen Gespräche des Papstes mit seinem Freund, dem Atheisten Eugenio Scalfari, dar. Seit der päpstlichen Amtseinführung fanden zehn solcher Gespräche statt. Zu fast allen ging die Initiative von Franziskus aus. Scalfari, der stolz auf die ununterbrochene Linie von Freimaurern in seiner Familie seit seinem Ururgroßvater ist, bringt anschließend aus dem Gedächtnis zu Papier, was Franziskus ihm anvertraute. Herausgekommen ist:
- daß es keine Hölle gibt,
- daß Gott nicht katholisch ist,
- daß alle Religionen in Wirklichkeit eins sind,
- daß Jesus nicht Gott ist …
Nach jedem Interview warnte anfangs das Presseamt des Vatikans, damals noch unter der Leitung von Vatikansprecher Pater Federico Lombardi, die Worte, die der bekannte Journalist dem Papst zuschrieb, mit Vorsicht zu genießen. Dann aber kapitulierte das Presseamt und schwieg zu den Scalfari-Veröffentlichungen. Von Franziskus war nämlich auch intern weder ein Dementi noch eine Klärung der häretischen Aussagen zu bekommen. Magister erinnert daran, daß nur noch einmal vorsichtig Stellung bezogen wurde, als die Londoner Times titelte: „Der Papst schafft die Hölle ab“. Insgesamt merkt der Vatikanist dazu an:
„Aber Franziskus gefällt es so. Und auch Scalfari.“
Der jüngste Franziskus-Leitartikel aus der Feder Scalfaris stammt vom 22. November 2020, um überschwenglich zu berichten, daß sich der Papst telefonisch bei ihm für seinen Leitartikel über ihr jüngstes Gespräch bedankt hatte.
Am selben 20. November, als Scalfari sein Papst-Gespräch publizierte, enthüllte die New Yorker Jesuitenzeitschrift America, die sich ganz auf Bergoglio-Linie befindet, ein anderes Telefongespräch des Papstes. In den Tagen zuvor hatte Franziskus einen anderen Freund angerufen, den Sozialisten Evo Morales. Morales war nach fast vierzehnjähriger Amtszeit als Staatspräsident Ende 2019 zum Rücktritt gezwungen worden. Seine Partei konnte inzwischen aber die Macht im Land zurückgewinnen. Der Wahlsieg war auch der Anlaß für den päpstlichen Telefonanruf. Franziskus gratulierte Morales zur Rückkehr an die Macht. Daß die Bischöfe Boliviens die Ideologie und Politik von Morales und dessen Partei ganz anders beurteilen, weil er wiederholt gegen die Kirche vorging, scheint den Papst in Santa Marta nicht zu kümmern.
4
Wie verwirrt die Medienverantwortlichen im Vatikan sind, zeigt noch ein anderes jüngstes Beispiel. Grund für die Verwirrung sind nicht nur die Eigenmächtigkeiten des Papstes, der an den offiziellen Stellen vorbei handelt. Es ist vor allem sein „salopper“ Umgang mit der kirchlichen Lehre. Daran war bereits Vatikansprecher Pater Federico Lombardi gescheitert. Da das Presseamt über eigenwillige Stellungnahmen des Papstes nicht informiert war, konnte es auch nicht überzeugt dementieren, denn Lombardi kannte zwar die Lehre der Kirche, aber er konnte mangels Informationen nicht sicher sein, daß etwa von Scalfari behauptete Sonderlehren nicht doch aus dem Mund von Franziskus stammten, dem er dann mit einem Dementi in den Rücken fallen würde.
Der jüdische, israelisch-amerikanische Regisseur Jewgeni Afinjewski, ein bekennender Homosexueller, stellte bei den Filmfestspielen in Rom seinen Dokumentarfilm „Francesco“ über den Papst vor. Darin ist Franziskus mit der Aussage zu hören:
„Homosexuelle … haben das Recht auf eine Familie … Was wir erreichen müssen, ist ein Gesetz der eingetragenen Partnerschaften“.
In Wirklichkeit waren diese Worte eine Montage von Fragmenten eines früheren Interviews das Franziskus der mexikanischen Journalistin Valentina Alazraki gegeben hatte. Seinerzeit war das Interview vom vatikanischen Fernsehzentrum geschnitten und kontrolliert worden. Aus noch ungeklärtem Grund wurde Afinjewski jedoch das vollständige Originalmaterial zur Verfügung gestellt und von diesem bearbeitet. Im Original findet sich die erwähnte Aussage des Papstes nicht, was Magister zur Frage veranlaßte.
„Wie reagierten die Verantwortlichen des Vatikans angesichts dieser offensichtlichen Manipulation der Papstworte?“
Die Reaktion war völliges Schweigen. Dabei wurde am 22. Oktober in den Vatikanischen Gärten in Anwesenheit von Paolo Ruffini, dem Präfekten des Kommunikationsdikasteriums, Afinjewski der Kineo Movie for Humanity Award überreicht – und das ausgerechnet für seinen Dokumentarfilm „Francesco“.
Auch Franziskus hatte nichts zu beanstanden, als er Afinjewski am Tag zuvor festlich in Audienz empfing und für den Regisseur eigens eine Geburtstagstorte zubereiten ließ.
Erst zehn Tage später wurde eine „schüchterne, verspätete und halbgeheime Richtigstellung“ bekannt, so Magister, und das eher zufällig. Der Apostolische Nuntius in Mexiko, Erzbischof Franco Coppola, veröffentlichte auf seinem Facebook-Zugang eine „Präzisierung zum Verständnis einiger Aussagen des Papstes im Dokumentarfilm ‚Francesco‘“. Diese war vom vatikanischen Staatssekretariat vertraulich an die Nuntien auf der ganzen Welt geschickt worden.
5
Auch im Zusammenhang mit dem Kampf für die Demokratie in Hongkong wurde die Verwirrung der Vatikanmedien sichtbar.
Am Sonntag, dem 5. Juli hatte das Presseamt eine Stunde vor dem Angelus den akkreditierten Journalisten wie gewöhnlich die schriftlich vorbereitete Kurzansprache des Papstes übergeben. Darin war die erste vorsichtige Unterstützung für die Demokratiebewegung enthalten, nachdem Franziskus monatelang zu den Ereignissen in Hongkong geschwiegen hatte. Der Absatz umfaßte zwölf Zeilen, die vom Staatssekretariat in diplomatischer Sprache formuliert waren.
Als Franziskus am Fenster des Apostolischen Palastes den Text verlas, übersprang er jedoch diesen Absatz und zwar zur Gänze. Magister ist überzeugt, daß der Papst dies nach Durchsicht des Textes kurzerhand selbst so entschieden haben dürfte.
Die Vorfall hatte zur Folge, daß das Presseamt seither auch den akkreditierten Journalisten die Texte der Kurzansprache nach dem Angelus nicht mehr vorab zugänglich macht.
Zu Hongkong schweigt Franziskus bis zum heutigen Tag trotz zahlreicher Bitten, Aufforderungen und Proteste, die ihn erreichen, darunter jene von Lord Christopher Patten, dem letzten britischen Gouverneur der einstigen Kronkolonie. Patten ist Kanzler der Universität Oxford und Mitglied des britischen Oberhauses. Von 2011 bis 2014 war er Präsident des BBC Trust und organisierte als Katholik 2010 den ersten Besuch eines katholischen Kirchenoberhauptes im Vereinigten Königreich. 2014 ernannte ihn Franziskus zum Vorsitzenden der Kommission für die Reform der Vatikanmedien.
6
Die letzte Perle dieser Magister-Anthologie. Die Pressemitteilung des vatikanischen Presseamtes vom 6. März 2020 lautete:
„Seine Heiligkeit Franziskus hat den Vorschlag des Kardinalsrates und des Wirtschaftsrates angenommen und die Einrichtung der ‚Generaldirektion des Personals‘ in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten des Staatssekretariats angeordnet.“
In der Erklärung wurden genaue Angaben zu den Befugnissen des neuen Amtes gemacht. Und sie endete mit der feierlichen Aussage:
„Dies ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem vom Heiligen Vater eingeleiteten Reformweg.“
Aber nichts davon stimmte. Am Tag danach mußte das Presseamt mitteilen, daß die Errichtung des neuen Amtes erst ein Vorschlag einiger Kardinäle war, den der Papst erst studieren werde. Sollte er die Errichtung für angemessen halten, werde er das mit einem Motu proprio zu gegebenem Zeitpunkt tun.
Die Hintergründe dieses Durcheinanders sind nicht bekannt. Tatsache ist jedoch, daß es ein solches Motu proprio bald ein Jahr danach noch immer nicht gibt.
7
Magister verweist nicht nur auf die Häufung solcher Pannen, die von der „Kommunikationsmaschine“ des Vatikans produziert werden. Er beklagt auch einen Abbau des Informationsflusses, der zuvor selbstverständlich war.
- Seit Franziskus Papst ist, werden weder die Namen der Synodalen, die in der Synode das Wort ergreifen, noch Zusammenfassungen ihrer Wortmeldungen veröffentlicht, wie das früher täglich der Fall war. Dabei spielen die 1965 eingeführten Synoden im derzeitigen Pontifikat, wie es heißt, eine weit größere Rolle als unter seinen Vorgängern.
- Unter Franziskus werden keine Jahresbilanzen des Heiligen Stuhls und des Governatorats der Vatikanstadt mehr veröffentlicht.
- Unter Franziskus werden keine Jahresbilanzen des Peterspfennigs mehr veröffentlicht.
- Bei den im Tagesbulletin des Presseamtes veröffentlichten Rücktritten von Bischöfen wird kein Grund mehr angeführt.
- Anders als in der Vergangenheit werden die Teilnehmerzahlen bei den Generalaudienzen und dem sonntäglichen Angelus nicht mehr angegeben.
- Der letzte Band, in denen jedes Jahr die Aktivitäten des Heiligen Stuhls in den vorhergehenden zwölf Monaten veröffentlicht wurden, ist 2015 erschienen. Seither nicht mehr.
- Die Ansprache zur Eröffnung des Gerichtsjahres der vatikanischen Justiz „wird ein Jahr veröffentlicht, ein Jahr nicht. Niemand weiß, aus welchem Grund“, so Magister.
- Der Osservatore Romano in der italienischen Tageszeitungs-Ausgabe ist monatelang nicht erschienen, wofür das Coronavirus verantwortlich gemacht wurde. Nun wird er wieder gedruckt, ist aber aus fast allen Zeitungskiosken verschwunden. Der Preis für das Jahresabonnement wurde drastisch auf 450 Euro erhöht (für das Ausland sogar auf 750 Euro). Nicht einmal mehr im Presseamt liegen Exemplare auf. Und die Online-Ausgabe ist wegen der Art der Veröffentlichung praktisch unlesbar.
Das Kommunikationsdikasterium, dessen erster Präfekt wegen der Manipulaton eines Briefes von Benedikt XVI. stürzte, wurde von Franziskus errichtet. Es scheint jedoch, als würde sich seine Abneigung gegen Institutionen sogar gegen die von ihm selbst geschaffenen richten. Obwohl dieses Dikasterium die Öffentlichkeitsarbeit koordinieren sollte, läuft viel an ihm vorbei, und Franziskus steht dabei in der ersten Reihe. Er ergreift gerne selbst die Initiative und bindet die zuständigen Stellen nicht ein, oder er bedient sich informeller Mitarbeiter wie Don Pozza anstatt des von ihm eingesetzten Präfekten Ruffini oder des ebenfalls von ihm ernannten Chefredakteurs Tornielli.
Magister schließt mit einer Feststellung:
„Ende 2018 traten zwei geschätzte Journalisten wie Greg Burke und Paloma García Ovejero als Direktor und Vize-Direktor des vatikanischen Presseamtes zurück. Sie hatten gesehen und alles verstanden.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Settimo Cielo