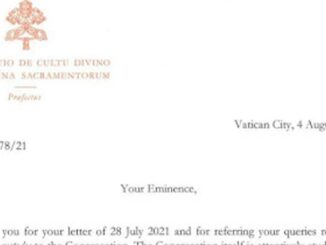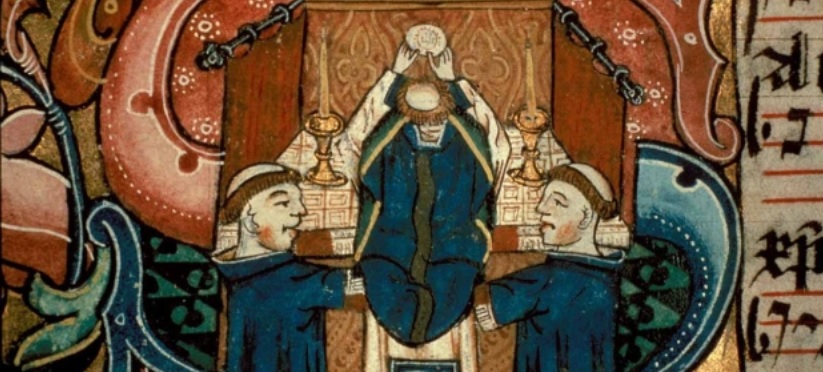
Von Clemens Victor Oldendorf.
Das Motuproprio Summorum Pontificum (SP) führt gleich zu Beginn in Art. 1 die Zweigestaltigkeit des einen Römischen Ritus an. Wer sich den jeweiligen Erscheinungsbildern des Usus ordinarius und des Usus extraordinarius, zumal in der tatsächlich alltäglichen Praxis vor Ort, unvoreingenommen stellt, dem würde in den seltensten Fällen in den Sinn kommen, beide Male ein und denselben Ritus vor sich zu haben.
Es fragt sich weiterhin, ob das Konstrukt eines Ritus in zwei Formen überhaupt notwendig war, um das von Benedikt XVI. in SP erstrebte Ziel zu erreichen. Man braucht sich nur vor Augen zu führen, dass es sich beim MR1962 um die letzte Editio typica des Missale Romanum handelt, die sich auf die Autorität und den Auftrag des Konzils von Trient (1545–1563) zurückbezieht, während das MR2002 die dritte Editio typica ist, seit die typischen Ausgaben des Missale Romanum beginnend mit 1969 vom Reformauftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) hergeleitet werden.
Während bei Papst Benedikt die Rechtsfiktion in der postulierten Zweiförmigkeit eines Ritus liegt, besteht sie bei Paul VI. in der Inanspruchnahme eines römischen Charakters für sein Messbuch. In diesem nachvatikanisch-paulinischen Missale wird nämlich in einer gewissen Paradoxie der Charakter eines Einheitsritus, der sich nach Trient durchzusetzen begann, sosehr zu letzter Konsequenz getrieben, dass anstelle eines Römischen Ritus von weltweiter Geltung eine Art global-ubiquitärer Ritus erscheint, der nur dem Namen nach noch römisch ist oder insofern, als er seinen Ursprung und Ausgang mit Paul VI. vom Papst in Rom genommen hat. Doch diese Fragestellung würde ein weiteres Thema eröffnen, dem gelegentlich eine eigene Untersuchung gewidmet werden kann, das aber hier nicht erörtert werden könnte, ohne unweigerlich zum Ausufern des Beitrags zu führen. Dies soll sich gerade nicht wiederholen, sondern wichtige Punkte, die wahrscheinlich für viele Leser in der Ausführlichkeit des vorangegangenen Beitrags untergegangen sind, sollen nochmals herausgestellt werden.
Diachrone Verbindlichkeit ermöglicht simultane Koexistenz
Da die Konzilien selbst zueinander nicht in das Verhältnis bloß chronologischer Ablösung treten, in der immer nur das aktuell letzte Konzil relevant wäre, sondern es stets eine diachrone Verbindlichkeit aller Konzilien gibt, in die sich das je letzte Konzil an- und einfügt, bleibt ein Nebeneinander der Editiones typicae des tridentinischen Missale und des nachvatikanischen Messbuchs möglich, während ein Nacheinander nur unter den typischen Editionen der liturgischen Bücher greift, insofern sie sich auf ein und dasselbe Konzil beziehen, das heißt: Das MR1962 hat zwar prinzipiell das MR1920 abgelöst, das MR1969 aber nicht das MR1962.
Letzteres blieb bestehen, während im Anschluss an das Zweite Vaticanum eine neue Zählung begann, so dass mittlerweile, und auch schon 2007 beim Erscheinen des Altritus-Motuproprio von Papst Benedikt, das tridentinisch-pianische MR1962 und das vatikanisch-paulinische MR2002 einander gegenüberstehen (während im deutschen Sprachraum das volkssprachliche Altarmessbuch formal immer noch der Editio typica des MR1970 entspricht). Wenn man diese beiden Messbücher unbedingt chronologisch vergleichen will, verkörpern sie weniger zwei Formen eines Ritus, höchstens zwei Stadien.
Geringfügige Eingriffe, wie zum Beispiel die 2008 erfolgte Neufassung der achten Karfreitagsfürbitte in Feiern nach SP, erfordern nicht sofort und jedesmal eine neue Editio typica. Diesbezüglich kann übrigens die Frage gestellt werden, warum Papst Benedikt damals nicht einfach diejenige Formulierung übernommen hat, die die Fürbitte bereits 1965 unter Paul VI. angenommen hatte.
Zwei neue Dekrete zum alten Brevier und Messbuch
Auch die Aufnahme neuer Präfationen, wie sie jetzt mit dem Dekret der Glaubenskongregation Quo magis ermöglicht wurde, hat niemals eine neue Editio typica erheischt, der Fortgang der Selig- und Heiligsprechungen noch viel weniger. Somit regelt das zweite Dekret, das am 25. März 2020 neben Quo magis veröffentlicht wurde, nämlich Cum Sanctissima, lediglich wie nach 1960 kanonisierte Heilige im BR1962 und MR1962 liturgisch berücksichtigt werden können, ohne das bestehende Kalendarium und die geltenden Rubriken zu verletzen. Dass sie im Usus antiquior verehrt werden können, brauchte die Glaubenskongregation selbstverständlich gar nicht erst ausdrücklich zu erlauben.
Hervorgerufen durch eine neuerliche Befragung aller Diözesanbischöfe zur weltweiten Umsetzung von SP, habe ich den Wunsch, ja die Notwendigkeit formuliert, präziser zu definieren, was zur Eignung eines Zelebranten gehört, der gestützt auf das Motuprorio von 2007 die Messe nach dem MR1962 feiern möchte. Lateinkenntnisse wurden dabei nur ganz kurz und flüchtig angesprochen. Daher möchte ich heute darauf zurückkommen und diesen Aspekt etwas näher beleuchten.
Eignung als Sprachkompetenz
In der Einleitung zu seinem zweisprachigen Diurnale Romanum sagt Pater Martin Ramm FSSP: „Wenn die überlieferte Liturgie wieder richtig lebendig werden soll, wird es unerlässlich sein, sich vermehrt um eine Wiederbelebung der lateinischen Kirchensprache zu bemühen. Das aber geht nicht ohne Hilfe“[1], wie Ramm schon vorher feststellt: „In der Praxis ist dies […] gar nicht so einfach, denn sowohl in der Messliturgie als auch beim Breviergebet stößt man bald auf die Hürde der lateinischen Sprache, die heute selbst ein guter Teil des Klerus kaum mehr beherrscht.“[2] Angesichts dessen kann es nicht genügen, wenn das Motuproprio SP in Art. 5 § 4 lediglich allgemein davon spricht, der Priester, der das MR1962 gebrauche, müsse dazu geeignet sein, und wenn die zugehörigen Ausführungsbestimmungen der Instructio Universae Ecclesiae aus dem Jahr 2011 in Nr. 20 b) für diese Eignung auf sprachlicher Ebene lediglich eine grundlegende Kenntnis verlangen, die es erlaubt, die Worte richtig auszusprechen und deren Bedeutung zu verstehen.
Jeder, der einmal versucht hat, den Kanon des Römischen Messritus zu übersetzen, hat ohne Zweifel bemerkt, dass man mit ihm nicht irgendeinen beliebigen lateinischen Text vor sich hat. Sein Vokabular ist weithin ein juristisches, stilistisch wurzelnd in Sprachebene und Syntax paganer römischer Religiosität, dabei indes zutiefst biblisch und christlich in der Aussage. Es handelt sich dabei also auch nicht etwa bloß ganz allgemein um Kirchenlatein, sondern aufgrund seines weit zurückreichenden Ursprungs um klassisches Kultlatein. Um dieses nicht nur als gottesdienstlich, sondern zugleich als rechtlich formalisiert zu charakterisieren, möchte ich den Begriff des Pontifikallateins vorschlagen, zumal in der Sphäre des Pontifikalen der gemeinsame Quellgrund des Römischen Rechts und der noch heidnischen, römischen Religion liegt.
Bonifatius Fischer OSB (1915–1997) erkennt dabei Stufungen in der Stringenz dieses Lateins, wobei die Präfation dem biblischen Latein am nächsten stehe, der Kanon das am stärksten formalisierte Latein aufweise und die Sprache der Orationen sich in einem dazwischen gelegenen Spektrum bewege. Der Liturgiewissenschaftler hält fest: „Dieses liturgische Latein ist charakterisiert durch die Tatsache, daß es eine Kunstsprache ist, eine stilisierte Sprache. Am ehesten läßt sie sich unter diesem Gesichtspunkt mit der Sprache der griechischen Epiker (Homer usw.) vergleichen. […] Der Kanon […] zeigt die strengste, ausgesprochen hieratische Form des liturgischen Stils. Zwei Züge fallen besonders auf: der feierliche Wortreichtum (Häufung von Synonymen) und die juridische Präzision; die rechtlich-sakrale Häufung des Ausdrucks.“[3] Die römische Mentalität ist dabei so prägend, dass die stilistische Ausdrucksweise des Kanons ins Vorchristliche zurückreicht, sie ist „aus dem altrömischen, heidnischen Gebetsstil ererbt. […] Wir finden hier den gleichen Wortreichtum, die gleiche Parallelgliederung, Alliteration, juridische Präzision“[4], doch Vokabular und Gedankengang sind thematisch typisch biblisch und christlich. Übernommen werden nur Fachausdrücke und juristische Fachterminologie, der Gesamtduktus ist dabei charakteristisch römisch gestaltet.[5]
Im Gebrauch der lateinischen Liturgie, an dieser Stelle ausdrücklich verstanden als Liturgie in lateinischer Sprache, sollte doch tieferes Sprachverständnis bestehen als reines Wort- und oberflächliches oder ungefähres Sinnverständnis und die Fähigkeit, Vokabeln richtig zu betonen und auszusprechen.
Ein gewisses Bewusstsein für das über das Pontifikallatein Gesagte ist anzustreben, denn von diesem Rechtsverständnis her ergibt sich dann auch die angemessene Einstellung zu rechtem Kultvollzug und zu Rubrikentreue. Deshalb wäre eine sprachliche Schulung und ein objektiver Nachweis über die erworbenen Kenntnisse so wichtig, ehe ein Priester in der Praxis beginnt, das MR1962 zu gebrauchen.
Römisches Rechtsdenken und Kultverständnis fortwirkend im christlichen Gottesdienst
Unzweifelhaft ist nämlich in der Eigenheit des Pontifikallateins auch der Grund zu suchen für einen rubrizistischen Zugang zu Ritus und Kult; schon die heidnischen Römer legten Wert auf einen exakten, korrekten Kultvollzug. Dass sich dabei eine Schnittmenge mit dem römischen Rechtsdenken ergibt, zeigt sich schön in der Stipulation, die in einer formelhaften Frage besteht, die ebenso formelhaft vom Vertragspartner affirmativ-repetierend aufgegriffen werden muss, damit dieser römischrechtliche Verbalkontrakt rechtswirksam zustande kommt. Mit dem Hinweis auf den sozusagen juridischen Ursprung römisch geprägter Religiosität, die auch christlich wirksam bleibt, wird ein gewisser Formalismus verständlicher, der häufig als mechanischer Rubrizismus verkannt wird.
Eignung als Fähigkeit zu korrektem Kultvollzug
Wenn Priester und Gläubige, die von der neuen Liturgie Pauls VI. herkommen, trotz einer Aufgeschlossenheit für die liturgische Tradition diese Einstellung nicht mehr mitbringen, ohne weiteres verstehen und einsehen, zeigt das bloß, dass die nachkonziliare Liturgiereform auch auf dieser Ebene das substantiierte Merkmal des Römischen, das bis ins Vorchristliche reicht, zerbrochen hat.
Somit kann namentlich ein Priester, der mit der Praxis der nachkonziliaren Liturgie vertraut ist und diese vielleicht sogar subjektiv traditionsorientiert interpretiert, nicht voraussetzen, dass er nur das tridentinische Messbuch aufzuschlagen brauche, und schon könne er als Zelebrant an den Altar treten. Deswegen habe ich verbindlich zu absolvierende Zelebrationsschulungen gefordert, die in ihrem Erfolg ebenso nachzuweisen sind wie die sprachliche Eignung im Gebrauch und Erfassen des Lateinischen. UE 20 c) ist hier regelrecht sträflich nachlässig, wenn die rituelle Eignung eines Priesters als Zelebrant generell vermutet wird, sobald er bloß unter Verwendung des MR1962 zelebrieren möchte und dies in der Vergangenheit bereits getan hat.
Einwand: Magie – Abgrenzung und Entgegnung
Bisweilen begegnet schließlich dem römisch-formelhaften Kultverständnis und folglich ebenfalls dem Usus antiquior ein Magievorwurf. Davon abgesehen, dass der juristische Ursprung und Kontext, den wir gesehen haben, wohl doch überzeugend und unbestritten in starkem Gegensatz zu abergläubischen Praktiken der Esoterik steht, anstatt selbst Teil davon zu sein, ist ein römisch bestimmtes Liturgieverständnis von Magie eindeutig abzugrenzen, wenn man bedenkt, was der Münsteraner Philosoph Josef Pieper (1904–1997) von dieser sagt: „Magie ist der Versuch, durch ein bestimmtes Tun übermenschliche Mächte für menschliche Zwecksetzungen verfügbar zu machen und in Dienst zu nehmen. So verstanden ist also Magie etwas dem religiösen Akt Entgegengesetztes: Religion ist Anbetung, Hingabe, Dienst; Magie hingegen ist im Grunde ein Bemächtigungsversuch […] [,] eine zu jeder Zeit mögliche Perversion der Haltung des Menschen zu Gott“, so dass „einem konkreten Tun wahrscheinlich von außen kaum anzusehen sein wird, ob es ‚religiös‘ ist oder ‚magisch‘.“[6] Konzediert kann also höchstens werden, dass Rubrikentreue zu einem veräußerlichten Zelebrationsperfektionismus entstellt werden kann. Doch diese Gefährdung bietet keine Ausrede, es mit Ritus und Rubriken nicht so genau zu nehmen, denn: Abusus non tollit usum.
[1] Priesterbruderschaft St. Petrus (Hrsg.), Diurnale Romanum. Die Horen des Römischen Breviers gemäß dem am 25. Juli 1960 von Papst Johannes XXIII. approbierten Codex Rubricarum – mit Ausnahme der Matutin – lateinisch und deutsch, (Verlag St. Petrus) Thalwil ²2016, S. viii.
[2] Ebd., S. vii.
[3] Fischer, Bon., Deutsche Liturgie und liturgisches Deutsch, in: BenM 29 (1953), S. 470–480, hier: S. 471f.
[4] Ebd., S. 472.
[5] Vgl. ebd., S. 472.
[6] Pieper, J., Sakralität und ‚Entsakralisierung‘ (1969), in: Berthold Wald (Hrsg.), Josef Pieper – Werke in acht Bänden, Bd. 7, (Felix Meiner) Hamburg 2000, S. 395–419, hier: S. 410.