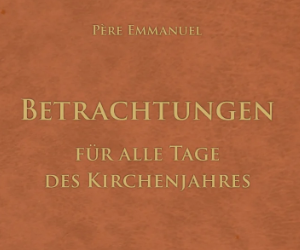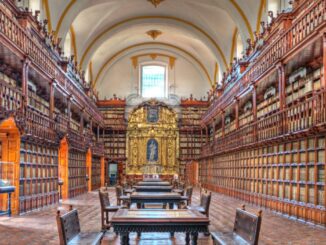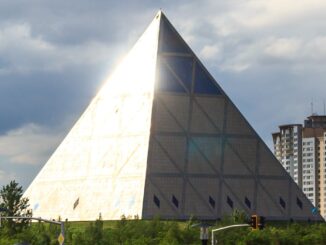(Mexiko-Stadt) Manche europäische Medien konnten ihre Freude kaum darüber verhehlen, daß am Sonntag die Präsidentschaftswahl in Mexiko von einem Linkskandidaten gewonnen wurde. Das Hemd ist eben näher als die Hose. Am Tag danach klangen die Meldungen zumindest etwas differenzierter. Nun war, im Gefolge der tonangebenden, internationalen Presseagenturen, davon die Rede, daß Mexikos neuer Staats- und Regierungschef Andres Manuel López Obrador, von den Mexikanern AMLO genannt, ein „Linksnationalist“ oder gar ein „Linkspopulist“ sei. Dennoch liegt die Betonung darauf, daß sein Wahlsieg etwas „Neues“ in der mexikanischen Geschichte sei. Trifft das aber zu?
Mit der Angelobung, die für 1. Dezember vorgesehen ist, wird AMLO neuer Staats- und Regierungschef der Vereinigten Mexikanischen Staaten sein, wie der Staat amtlich heißt.

Jenseits der instinktiven Genugtuung linker Journalisten über einen linken Wahlsieg tröpfeln solide Informationen erst langsam ein über den neuen Hausherren im Palacio Nacional, dem prächtigen, auf das Jahr 1563 zurückgehenden Regierungssitz in Mexiko-Stadt. Einige historische Hinweise scheinen angebracht.
Die vergangenen hundert Jahre war Mexiko die meiste Zeit eine Diktatur. 82 Jahre davon wurde das Land von der Revolutionären Partei – nomen est omen – beherrscht, die sich wegen ihrer langen Herrschaft seit 1946 sogar Institutionalisierte Revolutionäre Partei (PRI) nennt. Sie gehört der Sozialistischen Internationale an.
Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks mußte auch der PRI endgültig einer Demokratisierung Mexikos zustimmen. Die Folge war, daß er bald die Macht verlor. Nur 12 Jahre, von 2000–2012, gelang es dem an der Basis katholisch getragenen, tatsächlich aber bürgerlich-rechtsliberalen PAN (Partei der Nationalen Aktion) den PRI an der Staatsspitze abzulösen. Das war immerhin Zeit genug, um noch letzte antikatholische Gesetze abzuschaffen.
2012 kehrten die alten Seilschaften, im Staatsapparat noch immer fest verankert, wieder an die Macht zurück. Die herrschende Rechtsunsicherheit und die epidemische Korruption der PRI-Mandatare ließ die Wähler allerdings schnell nach einer neuen Alternative Ausschau halten.
AMLOS geistige Wurzeln
Was von internationalen Medien an AMLO als „neu“ bezeichnet wird, hat in Wirklichkeit tiefe Wurzeln in der mexikanischen Geschichte. Sie gehen bereits auf Benito Juarez zurück, der von 1858–1872 Präsident von Mexiko war und mit einer antiklerikalen Gesetzgebung die katholische Kirche bekämpfte. 1847 war Juarez in die Freimaurerei initiiert worden und erhielt den Logen-Decknamen Guillermo Tell. Zwei Monate später wurde er Gouverneur von Oaxaca. Seine Rücksichtslosigkeit als „Zwingherr zum Glück“ ging soweit, daß er lieber einen Aufstand der Katholiken und Konservativen in Kauf nahm, der zum Bürgerkrieg führte – den er blutig niederschlug –, als eine Verständigung zu suchen. Kein Wunder also, daß der Episkopat jene Kräfte – auch aus Europa – unterstützte, die ihr gegen einen so unerbittlichen Feind zu Hilfe kamen. Das war den Kirchengegnern wiederum Vorwand, die Kirche landesverräterischer Umtriebe zu bezichtigen.
Der überzeugte Freimaurer Juarez stieg bis zum 33. Grad des Schottischen Ritus auf. Noch heute wird er in verschiedenen freimaurerischen Riten wie ein „Säulenheiliger“ verehrt.

Noch deutlicher wird die geistige Herkunft von AMLO, wenn der Blick auf die Revolution des Jahrzehnts zwischen 1910 und 1920 fällt.
Der „Linkspopulismus“ oder „Linksnationalismus“, den AMLO repräsentiert, mag viel sein, aber neu ist er nicht. Neu sind auch nicht die Rezepte, die er anbietet. Diese sozialistisch geprägten Ideen wurden bereits im fernen 1917 in der Verfassung des Landes festgeschrieben (u.a. Landreform, Aufteilung des Grundbesitzes, staatliche Kontrolle der Bodenschätze und Ressourcen). Das war auch die ideologische Grundlage der Revolutionären Partei, die aus dem radikalen Kampf gegen die katholische Kirche und die Katholiken des Landes als Sieger hervorging und Mexiko jahrzehntelang diktatorisch regierte. Die Kirche wurde kategorisch aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen, war nicht mehr als Rechtssubjekt anerkannt, durfte keinerlei Besitz haben (sogar die Kirchengebäude wurden vom Staat enteignet), weder Schulen betreiben noch karitativ tätig sein, Priester gingen ihrer bürgerlichen Rechte verlustig und verfügten nur über eingeschränkte Meinungsfreiheit. Religiöse Orden waren kategorisch verboten. Die von der mexikanischen Freimaurerei zum Todfeind erklärte Kirche sollte mundtot gemacht und ausgelöscht werden.
In den 1920er Jahren wurden vom „obersten Revolutionsführer“ Plutarco Elias Calles, einem Freimaurer wie Juarez (die gesamte Staatsführung bestand damals aus Freimaurern), der katholische Kultus, also die Heiligen Messen und andere Gottesdienste verboten, und überhaupt jede Handlung der Bischöfe untersagt. Diese bedingungslose Feindseligkeit, mit der die freimaurerisch dominierte, radikale Linke des Landes die katholische Bevölkerungsmehrheit knebelte, führte 1926–1929 zum katholischen Cristero-Aufstand. Der Kinofilm „Cristiada“ (Greater Glory) mit Andy Garcia brachte 2012 deren unterschlagene Geschichte auf die große Leinwand. Die historische Wahrheit stört jedoch noch immer so sehr, daß die Auslieferung des Films boykottiert und der Film in verschiedenen Ländern nie gezeigt wurde, auch nicht im deutschen Sprachraum. (Der Film ist im Handel als DVD erhältlich, allerdings mit wenig gelungener, deutscher Synchronisation.)
Die „perfekte Diktatur“
In Summe kann die PRI-Herrschaft als Mischung aus autoritärem Regime, Dritter Welt und sozialistischer Sozialpolitik mit klientelistischem Zuschnitt bezeichnet werden. Dieser Klientelismus der linken Diktatur hatte einen „Vorteil“, wenn man es so sehen will – linke Journalisten werden es sicher so sehen: Er verhinderte, was viele lateinamerikanische Staaten erschütterte: Militärputsche.

Mario Vargas Llosa, Literaturnobelpreisträger aus Peru, der sich im Alter zwar vom Sozialisten zum Liberalen läuterte, der Kirche aber gleich fern blieb, war einst sogar der Meinung, daß das autoritäre Linksregime Mexikos die „perfekte Diktatur“ gewesen sei. Mit anderen Worten, Hauptsache links, dann ist selbst die Diktatur etwas Gutes, und es wird achselzuckend über linkes Brandschatzen und Morden hinweggesehen.
López Obrador, genannt AMLO, ist nichts „Neues“, sondern das perfekte Produkt der PRI-Herrschaft. 1976 war er im Alter von 23 Jahren Mitglied und auch gleich hauptberuflicher Aktivist des PRI geworden. 1982 war er erfolgreicher PRI-Wahlkampfleiter bei den Wahlen im Staat Tabasco und stieg in der Parteikarriere Stufe um Stufe nach oben.
1989 verließ er zusammen mit anderen Links-Abweichlern die Partei, als diese unter den Staatspräsident Carlos Salinas de Gortari (PRI) sich dem Neoliberalismus öffnete, oder dem, was die radikale Linke so nannte. Der PRI vollzog nach dem Zusammenbruch des Ostblocks dieselbe Entwicklung wie die europäische Linke. Der Zusammenbruch des Kommunismus schien den Sozialismus definitiv zu desavouieren. Stattdessen kam es zu einer Neuorganisation, indem sich die kommunistische Linke in Windeseile nach westlichem Muster sozialdemokratisierte. Die westliche Linke, selbst um ihren Fortbestand bangend, nahm die neuen Verbündeten großmütig auf und schmiedete an neuen Bündnissen mit den bereitwilligen Liberalen und der verbliebenen radikalen Linken.
Der PRI tat diesen Schritt ebensowenig freiwillig wie die kommunistischen Parteien Europas. Es waren die von ihm selbst heraufbeschworene Wirtschaftskrise und die internationalen Umbrüche, die ihn dazu zwangen.
Die Linksabspaltung
López Obrador spaltete sich 1989 mit dem linken Flügel vom PRI ab, der sich als Partei der Demokratischen Revolution (PRD) konstituierte. Und siehe da, auch der PRD wurde neben dem PRI Vollmitglied der Sozialistischen Internationale. Inzwischen gehört er auch der 2013 gegründeten Progressiven Allianz an und zum Unterschied des PRI, da weiter links, auch dem Sozialforum von Sao Paulo an. Die mexikanische Situation von PRI und PRD läßt sich in etwa mit SPD und Die Linke oder in Spanien mit PSOE und Podemos vergleichen.

López Obrador saß seit der Gründung im Vorstand des PRD- Von 1996 bis 1999 war er dessen Bundesvorsitzender.
Von 2000–2005 regierte er Mexiko-Stadt (Bundesdistrikt), ein Stadtstaat wie Berlin, Wien und Hamburg als Bürgermeister. Als solcher setzte er im ersten mexikanischen Gliedstaat die Legalisierung der Abtreibung durch.
2006 und 2012 bewarb er sich zweimal erfolglos um das Anr des mexikanischen Staatspräsidenten. Zuerst mußte er sich dem Bürgerlichen Felipe Calderón und dann dem PRI-Vertreter Enrique Peña Nieto geschlagen geben. Allerdings wollten López und seine Anhänger die Niederlage von 2006, trotz mehrfacher Nachzählungen, nicht akzeptieren und starteten verschiedene Aktionen des zivilen Ungehorsams bis hin zu Besetzungen und Nötigungen, einschließlich einer Schlägerei im Parlament. Das Verhalten ließ Zweifel an seiner demokratischen Gesinnung aufkommen.
Die Aura des „Systemgegners“ (Enrique Krauze spricht von einem „Mesía tropical“) ist allerdings ein bloßes PR-Etikett, denn AMLO entstammt dem Zentrum des alten Regimes aus der Zeit der linkspopulistischen Herrschaft der PRI-Präsidenten Echeverria und López Portillo, die Mexiko von 1970–1982 regierten – und das wenig demokratisch.
2011 gründete López die Plattform Morena, was soviel wie Bewegung zur nationalen Regenerierung heißt, zur Unterstützung seiner Präsidentschaftskandidatur 2012. 2014 trennte sich AMLO vom PRD und machte aus Morena eine neue Partei. Die Bewegung wurde am Sonntag stärkste Kraft in beiden Kammern des Bundesparlaments. Kurioserweise ernannte López Obrador 2013 einen Jesuiten, P. Camilo Daniel Pérez, zum Berater seiner Bewegung.
AMLOS Versicherung: Abtreibung und „Homo-Ehe“ bleiben
AMLOS Linie ist die Rückkehr zu den Wurzeln des PRI, die dieser (und inzwischen auch der PRD) verraten habe. Aus diesem Grund vertritt er auch den radikalen, kirchenfeindlichen Laizismus, der die mexikanische Diktatur so lange geprägt hatte. Erst 1992 waren wieder diplomatische Beziehungen zwischen Mexiko und dem Heiligen Stuhl hergestellt worden.

AMLO unterhält Beziehungen zum sogenannten „lateinamerikanischen Sozialismus“, der von Hugo Chavez und Evo Morales begründet wurde. Chavez ist bereits tot, aber Morales schickte noch am Wahlabend ein Glückwunschtelegramm.
Obradors Dreierkoalition enthält zwar auch eine kleine Partei, den Encuentro Social (Soziale Begegnung), die gegen die Tötung ungeborener Kinder und gegen die „Homo-Ehe“ ist, doch im Wahlkampf versicherte López Obrador, daß er weder das eine noch das andere Gesetz ändern werde. Dazu muß angemerkt werden, daß die Parteienlandschaft Mexikos jener Europas und nicht jener der USA gleicht. Der bürgerliche PAN entspricht nicht dem Modell der Republikanischen Partei der USA, sondern der zahnlosen europäischen Christdemokratie wie sie der Partido Popular (PP) in Spanien repräsentiert. Mexikos Familien- und Lebensrechtsbewegung schrieb vor der Wahl: Obradors Partei Morena „ist eine eindeutig familienfeindliche Partei, besessen vom Sex und Unterstützerin der Gender-Ideologie“.
Seit 1994 verfügt Mexiko über eine demokratische Verfassung. Sie gibt dem Staatspräsidenten, der zugleich Regierungschef ist, zahlreiche Vollmachten, begrenzt seinen Handlungsspielraum aber auch. Die Frage ist, wie sich das in der Verfassungsrealität auswirken wird. Der PRI, obwohl 2000 abgewählt, war durch seine lange Herrschaft im Staatsapparat fest verankert und konnte dadurch die bürgerlichen Präsidenten überwintern. Nun, da ein Vertreter des einstigen linken Flügels des PRI an die Regierung kommt, muß sich zeigen, welche neuen Allianzen sich mit den staatstragenden Kräften ergeben. Der eigentliche Streßtest für die mexikanische Demokratie steht erst bevor.
Auf die neue Regierung warten enorme Probleme, unter denen vor allem Gewalt, Korruption, soziale Probleme und die Beziehungen zu den USA herausragen. Im Wahlkampf war der linke Populismus von López Obrador siegreich. Die Bewährungsprobe hat er aber noch vor sich. Für Mexiko bleibt zu hoffen, daß er, von der Realität in die Enge getrieben, nicht zu denselben Mitteln greift wie seine geistigen Ahnherren Juarez und Plutarco Calles, in deren Fußstapfen er sich sieht.
Erst 2012, fast 90 Jahre nach dem Aufstand der Katholiken, hatte Papst Benedikt XVI. den Tabubruch vollzogen und bei seinem Mexiko-Besuch öffentlich jene „verbotenen“ Worte „Viva Cristo Rey“ ausgesprochen, das Motto der Katholiken in ihrem Freiheitsringen gegen die freimaurerisch-sozialistische Revolution von 1910 und zugleich Schlachtruf der katholischen Cristeros in den 20er Jahren.
Mit dem Ruf Viva Cristo Rey auf den Lippen wurden Tausende von Katholiken hingerichtet, nicht nur in Mexiko, später auch im kommunistischen Kuba.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Catholicus (Screenshot)