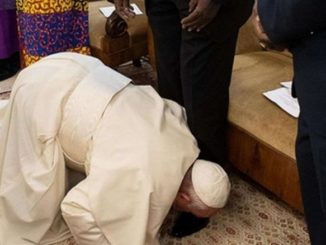(Rom) 2018 wurde zu drei Fragen von Papst Franziskus in entscheidenden Momenten eine Kehrtwende vollzogen. „Er gab aber nie zu verstehen, ob sie definitiv und ehrlich gemeint sind“, so der Vatikanist Sandro Magister. War es Einsicht, oder wurde Franziskus vom Mut verlassen, oder sind seine Kehrtwendungen lediglich taktischer Art? Die Unklarheit ergebe sich aus dem, was der regierende Papst vorher und nachher sagte und tat, nachdem er den Rückwärtsgang einlegte.
Erste Kehrtwende: Frauenordination
Die erste Handbremse zog Franziskus gegen das Frauenpriestertum. In diesem Punkt widersprach er sich allerdings nicht selbst. Seit seiner Wahl zum Papst sprach er sich, wann immer er danach gefragt wurde, persönlich gegen eine Frauenordination aus. Das geschah beispielsweise am 1. November 2016 auf dem Rückflug aus Schweden, wo er am Tag zuvor bei dem gemeinsamen „Reformationsgedenken“ die lutherische Erzbischöfin von Schweden umarmt hatte.
„Gleichzeitig ließ er aber lange den Meinungen der Befürworter freien Lauf, darunter auch durch Persönlichkeiten, die mit ihm befreundet sind, wie dem Wiener Kardinal Christoph Schönborn“, so Magister.
Erst am vergangenen 29. Mai veröffentlichte der Osservatore Romano eine Erklärung von Glaubenspräfekt Luis Ladaria Ferrer, der klarstellte, daß bereits 1994 Papst Johannes Paul II. auf „unfehlbare“ und „definitive“ Weise ein Nein zum Frauenpriestertum verkündet hatte. Der Jesuit Ladaria war von Franziskus an die Spitze der Glaubenskongregation gesetzt und vor wenigen Tagen zum Kardinal kreiert worden.
Die Verfechter des Frauenpriestertums geben sich aber nicht geschlagen. Sie folgen einem rechtspositivistischen Denken, laut dem letztlich jede Regel durch jene geändert werden könne, die Macht (nicht unbedingt Vollmacht) dazu haben.
Kardinal Martinis Ratschlag
Die Marschroute gab Kardinal Carlo Maria Martini, ebenfalls Jesuit, als Reaktion auf das Nein von Johannes Paul II. vor. Mit einem „Ratschlag“ empfahl er, sich nun auf das Frauendiakonat zu konzentrieren, denn das sei von Johannes Paul II. nicht ausdrücklich genannt worden. Dann sehe man weiter.
In der Anglikanischen Kirche wurde mit dieser Salamitaktik vorgegangen. Unterstützt wurde die Frauen-Agenda jeweils von einer Mehrheit der Bischöfe. Den meisten Widerstand leisteten die Gläubigen. Auf der anglikanischen Synode wurde vor wenigen Jahren zur Brechung des Widerstandes gegen die Einführung von Bischöfen so lange abgestimmt, bis das gewünschte Ziel erreicht war. Progressive, katholische Kreise denken diesbezüglich nicht anders.
Bestärkt werden sie durch denselben Franziskus, der sich persönlich gegen eine Zulassung von Frauen zum Weihesakrament aussprach, weil er 2016 eine Kommission zum Studium der historischen Figur der Diakonissen errichtete. Er selbst erklärte scherzend, daß ihm ein „weiser Mann“ einmal empfohlen habe, daß man Dinge durch die Errichtung von Kommissionen auf die lange Bank schieben könne. Doch niemand weiß so recht, was Franziskus nun wirklich will.
Dient die Diakonissenkommission zur Vertröstung der Befürworter der Frauenordination oder dient sie zur Vorbereitung des Frauendiakonats, also letztlich der Täuschung rechtgläubiger Kirchenkreise, die eine Frauenordination definitiv für unmöglich halten?
Dazu trägt auch bei, daß Franziskus selbst verschwommen einmal von Diakonissen und einmal von Diakoninnen spricht und im Unklaren läßt, welchen Auftrag die Kommission wirklich hat (siehe Frauendiakonat: Als der Vatikan noch ohne Studienkommission zu antworten wußte, ebenso Kardinal Müller: Wurde bereits ausführlich studiert).
Auch Magister äußert solche Zweifel:
„Nach dem Vorbereitungspapier zur Amazonassynode zu beurteilen, die 2019 stattfindet, ist vorhersehbar, daß genau dort die ersten Diakoninnen geweiht werden. Und dann, wer weiß …“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)