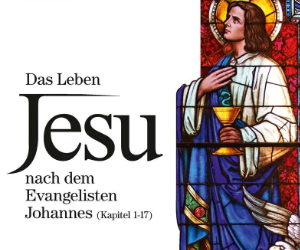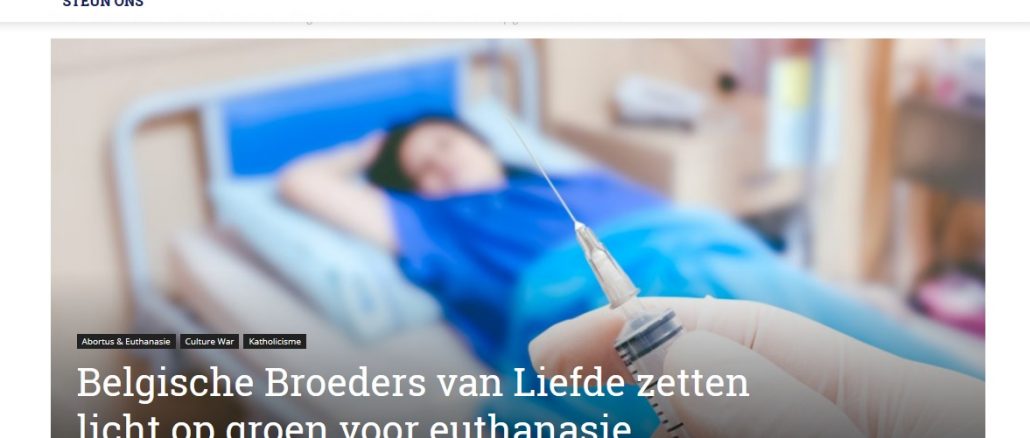
Ein Gastkommentar zur neuen Rechtfertigunglehre von Euthanasie-Tötungen durch belgische Ordensleute.
Von Hubert Hecker.
Vertreter des belgischen Pflege-Ordens „Broeders van Liefde“ beharren darauf, in ihren 15 Häusern für psychisch Kranke das liberale belgische Euthanasiegesetz anzuwenden. Der Staat erlaubt dort, dass Ärzte lebensmüde Menschen, unheilbar kranke Patienten und sogar Kinder auf Wunsch der Eltern straffrei töten können.
Euthanasie-Tötungen entgegen der katholischen Lehre
Diese Regelung widerspricht diametral der katholischen Lehre, nach der allein Gott der Herr über Leben und Tod des Menschen ist. Der Vatikan hat die belgische Ordensleitung aufgefordert, eine Erklärung zur Rechtgläubigkeit zu unterzeichnen. Danach sollen sich die Verantwortlichen der belgischen Ordensprovinz uneingeschränkt zum Lehramt der katholischen Kirche bekennen, „die immer gelehrt hat, dass das Menschenleben von der Zeugung bis zum natürlichen Tod absolut respektiert und geschützt werden muss“. Aus dem Absolutheitsanspruch dieser Norm ergibt sich, dass ein Verstoß dagegen, etwa als vorgeburtliche Kindstötung oder Euthanasie-Tötung von Erwachsenen, eine objektiv unmoralische Handlung ist – in jedem Fall.
Kürzlich machten Mitglieder der Ordensleitung in einer Presseerklärung ihre Antwort publik, dass sie sich dem Einspruch Roms widersetzen würden, um weiterhin Euthanasie-Tötungen in ihren Einrichtungen vorzunehmen.
Vorschieben von Gewissensfreiheit für Unrechtstaten
Die Begründung dafür ist genauer zu analysieren: Man werde die Gewissensfreiheit der Ärzte „respektieren, Euthanasie zu verüben oder nicht“. Ebenso würden die Ordensleute die freie Entscheidung des Pflegepersonals bezüglich der Teilnahme an Euthanasieaktionen respektieren. Die Entscheidungsfreiheit werde durch das belgische Gesetz festgelegt.
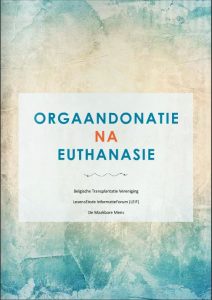
Es ist zunächst zu würdigen, dass dem Pflegepersonal per Gesetz das Recht zugestanden wird, sich ohne Sanktionen der Teilnahme an Euthanasie-Aktionen zu enthalten. Ein solches gesetzliches Weigerungsrecht bei medizinischen Tötungsmaßnahmen ist nicht in allen westlichen Staaten gewährleistet. In Schweden z. B. müssen zwei Hebammen in teuren Prozessen darum kämpfen, nicht an Abtreibungen teilnehmen zu müssen.
Doch mit dem belgischen Zugeständnis zur einen Seite soll ein anderes Ziel erkauft werden: die Einverständniserklärung zur Euthanasie von anderen Pflegekräften. Darauf kommt es dem Gesetzgeber und auch den „Broeders“ an. Mit dem Respekt vor der Gewissensfreiheit der Ärzte, Krankentötungen durchzuführen, sieht der Orden die Euthanasieaktionen insgesamt legitimiert.
Aber ist der Bezug auf die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen als Rechtfertigung der Euthanasie zulässig?
Die verfassungsmäßigen Grund- und Freiheitsrechte sind als Abwehrrechte gegenüber problematischen Ansprüchen staatlicher Macht konzipiert. Die „Freiheit des Gewissens“ im Artikel 4 des Grundgesetzes beinhaltet in diesem Kontext, dass niemand gezwungen werden darf, an Handlungen teilzunehmen, die gegen seine Gewissens- und Glaubensüberzeugung sind. Ausdrücklich und exemplarisch genannt wird das Recht auf Verweigerung des „Kriegsdienstes mit der Waffe“.
Das Weigerungsrecht gegenüber Unrecht wird zu einem Täterrecht pervertiert
Wenn aber der Respekt vor der freien Gewissensentscheidungen zur Legitimierung von staatlich erlaubtem Unrecht herangezogen wird, ist das offensichtlich eine Verkehrung der Rechtsintention. Als die französischen Jakobiner im September 1792 dem Pariser Pöbel die Freiheit gewährten, 3000 Gefangene umzubringen, war das eine Perversion der Freiheitsrechte.
Somit ergibt sich die Schlussfolgerung: Die Freiheit der Gewissensentscheidung kann nur als Weigerungsrecht, nicht als Legitimierung von Unmoralischem beansprucht werden. Letzteres tut aber die belgische Ordensleitung.
Der Respekt vor der freien Entscheidung des Personals zu Euthanasieaktionen ist damit nur ein vorgeschobenes, unzulässiges Statement des Pflegeordens, um Tötungshandlungen ihrer Angestellten zu legitimieren. Der Orden als Krankenhausträger erlaubt und gewährleistet seinen Ärzten und Pflegern, in katholisch geführten Einrichtungen unmoralische Handlungen zu vollziehen, nämlich Menschen zu töten. Das klassische Freiheits- und Weigerungsrecht gegenüber aufgetragenen Unrechtshandlungen wird damit zu einem Täterrecht pervertiert.
Die Grenzen der moralischen Gewissensfreiheit
Aber auch im moralischen Sinne weiten die Ordensleute den Gewissensspielraum unzulässig aus. Dem einzelnen Gewissen kann niemals die freie Entscheidung über Lebenlassen oder Tötung eines anderen Menschen überlassen werden. Selbst nach staatlicher Rechtsauffassung ist die Entscheidung einer Mutter, ihr ungeborenes Kind töten zu lassen, „rechtswidrig“ – so das Bundesverfassungsgericht von 1993. Der Staat allerdings nimmt sein eigenes Unrechtsurteil nicht ernst, indem er die Entscheidung und Durchführung von unrechtmäßigen Kindstötungen duldet, unter anderem durch den Verzicht auf Strafverfolgung der Abtreibungsärzte.
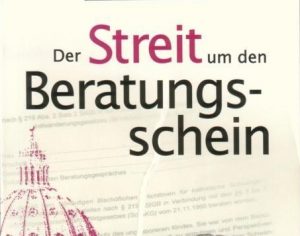
Die Kirche aber als moralische Instanz kann niemals anerkennen, dass Leben und Tod eines Ungeborenen der ungebundenen Gewissensentscheidung eines anderen Menschen anheim gegeben wird. Deshalb dürfen kirchliche Einrichtungen auch nicht im Rahmen des staatlichen Abtreibungsgesetzes mitarbeiten – etwa durch Vergabe des „Beratungsscheins“ als Legitimierung der vorgeburtlichen Kindstötung.
Diese kirchliche Haltung ist auf die Konstellation der belgischen Euthanasie-Gesetzgebung und –Praxis zu übertragen. Papst und Kurie haben die Pflicht und Aufgabe, für die Einhaltung der katholischen Lehre zu sorgen. Sie müssen bei den belgischen Ordensleuten in der Euthanasiefrage genauso konsequent vorgehen wie vor zwei Jahrzehnten gegenüber den deutschen Bischöfen in der Abtreibungsfrage.
Mit dem oben erwähnten Ultimatum zur Erklärung der Rechtgläubigkeit hat Rom den ersten Schritt eingeleitet. Aber wird die Kurie angesichts der Widerstände und Winkelzüge der belgischen Ordensbrüder (und dahinterstehenden Liberaltheologen) ihre Linie durchhalten? Oder wird sich die biegsame Richtung durchsetzen, die die katholische Morallehre an den herrschenden Zeitgeist von absoluter Gewissensfreiheit und Selbstbestimmung anpassen will?
Die kirchliche Morallehre ist durch ein päpstliches Lehrschreiben geschwächt
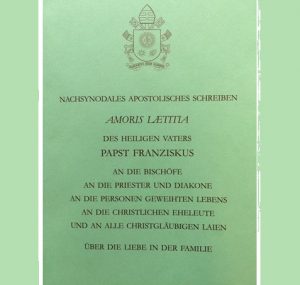
Unter dem Pontifikat von Papst Franziskus ist die Lehre der Kirche in moralischen Fragen schon aufgeweicht worden. Die Verunklarung geschah insbesondere in dem päpstlichen Lehrschreiben Amoris laetitia (AL). Die entscheidende Neuerung betrifft die Zuordnung von Gebot und Gewissen. Danach können subjektive Gewissensentscheidungen objektive Normen aushebeln und kirchlich festgestellte Normverstöße als irrelevant angesehen werden.
Mit dieser Relativierung von Gebotsnormen durch individuelle Gewissensfreiheit sind die in Belgien aufgeworfenen Fragen berührt. Indem die belgischen Ordensleute auf „freie Entscheidungen“ in eindeutig entschiedenen Moralfragen insistieren, können sie sich auf die Schwachpunkte des päpstlichen Lehrschreibens beziehen.
Die einschlägige Neuerung ist im Abschnitt 303 von AL versteckt. Dort heißt es:
- Das Gewissen kann nicht nur erkennen, dass eine Situation wie Leben im Ehebruch „objektiv“ schuldhaft und unmoralisch ist.
- Es kann aber auch „mit einer gewissen moralischen Sicherheit entdecken“ und „ehrlich erkennen“, dass „Gott fordert“, in solchen sündhaften Konstellationen mit „Hingabe“ zu verbleiben und sie weiterzuentwickeln.
Der österreichische Philosoph Prof. Josef Seifert hat sich mit den Dimensionen und Konsequenzen dieser moraltheologischen Neudefinition des Gewissens auseinandergesetzt. Er schreibt dazu:
„Wenn unser Gewissen wissen kann, dass Gott will, dass wir in bestimmten Situationen in sich schlechte Handlungen begehen, Ehebruch oder homosexuelle Handlungen, dann müsste man aufgrund der Logik dieselben Konsequenzen auch im Zusammenhang mit der Verhütung, der Abtreibung und allen anderen Handlungen ziehen, die von der Kirche und den Geboten Gottes ‚absolut’ ausgeschlossen werden.“
Katastrophale Konsequenzen aus der moraltheologischen Logik von Amoris laetitia
Wenn man die genannte Logik von Amoris laetitia auf den Euthanasiekomplex überträgt, würden sich folgende Konsequenzen ergeben: Ein Christ kann in seinem Gewissen mit moralischer Sicherheit erkennen, dass Gott in bestimmten Situationen von ihm die Teilnahme an Euthanasie-Tötungen gutheißen und sogar fordern würde.
Die Haltung Roms zum Euthanasievorstoß der belgischen Ordensbrüdern könnte zum Testfall werden für die Konsistenz der katholischen Morallehre:
Ein Nachgeben auf der Linie von Amoris laetitia würde darin bestehen, dass das individuelle Gewissen die Euthanasie-Tötung gutheißen könnte, was Gottes 5. Gebot und kirchliche Norm seit jeher als verwerfliches Unrecht beurteilt. Die Durchsetzung dieser Individual- oder Situationsethik würde in moralischen Relativismus münden und das verbindliche kirchliche Lehramt in Glaubens- und Sittenfragen überflüssig machen.
Wenn dagegen der Vatikan der bisherigen kirchlichen Lehrtradition treu bleibt, nach dem der absolute Schutz des Menschenlebens von der Zeugung bis zum natürlichen Tod vor allen subjektiven Gewissensentscheidungen steht, ist eine andere Konsequenz angesagt. Dann sollten die fehlerhaften Fußnoten und Textstellen von Amoris laetitia, die mit ihrem Gewissens-Subjektivismus den ethischen Relativismus auch in anderen kirchlichen Bereichen fördert, als Abweichungen von der kirchlich-katholischen Lehre korrigiert werden.
Text: Hubert Hecker
Bild: Sceptr