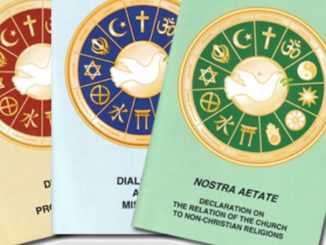Msgr. Athanasius Schneider, Weihbischof der Erzdiözese der Heiligen Maria in Astana in Kasachstan, gehört zu den renommiertesten Bischöfen der Katholischen Kirche. Im folgenden Text analysiert er den Zusammenhang zwischen dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seiner Interpretation und der aktuellen Kirchenkrise. Es ist der Text eines Oberhirten, der messerscharf analysiert und glasklar argumentiert, der vor allem aber die Lehre Jesu Christi verkündet und die Gläubigen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe stärkt.
Die deutsche Fassung des bereits in anderen Sprachen veröffentlichten Textes wurde von Weihbischof Schneider zur Verfügung gestellt, und die Veröffentlichung von ihm autorisiert.
Das II. Vatikanische Konzil und seine Interpretation in Verbindung mit der aktuellen Kirchenkrise
von Msgr. Athanasius Schneider
Die aktuelle Situation einer präzedenzlosen Krise der Kirche ist mit der großen Krise im 4. Jahrhundert vergleichbar, als der Arianismus die überwältigende Mehrheit des Episkopates angesteckt und im Leben der Kirche eine dominierende Stellung eingenommen hatte.
Wir müssen versuchen, der jetzigen Situation einerseits mit Realismus zu begegnen und andererseits mit einem übernatürlichen Geist, mit einer tiefen Liebe zur Kirche, unserer Mutter, die wegen dieser ungeheuren und allgemeinen doktrinellen, liturgischen und pastoralen Verwirrung die Passion Christi erleidet.

Wir müssen unseren Glauben erneuern und glauben, dass die Kirche in den sicheren Händen Christi ist, und dass Er immer eingreifen wird, um die Kirche in den Augenblicken zu erneuern, in denen das Boot der Kirche zu kentern scheint, wie es offensichtlich in unserer Zeit der Fall ist.
Was die Haltung zum II. Vatikanischen Konzil angeht, müssen wir zwei Extreme vermeiden: die vollständige Ablehnung (wie es die Sedisvakantisten und ein Teil der FSSPX tun) und die „Unfehlbarmachung“ all dessen, was das Konzil gesagt hat.
Das II. Vatikanische Konzil war eine legitime Versammlung, dem die Päpste vorstanden, und wir müssen gegenüber diesem Konzil eine respektvolle Haltung haben. Allerdings bedeutet das nicht, dass es uns verboten ist, wohlbegründete Zweifel zum Ausdruck zu bringen oder respektvoll Verbesserungsvorschläge zu bestimmten Themen zu machen mit Berufung auf die gesamte Überlieferung der Kirche und auf das beständige Lehramt.
Traditionelle und beständige doktrinelle Äußerungen des Lehramts während einer jahrhundertelangen Periode haben Vorrang und bilden ein Kriterium, um die Genauigkeit späterer Aussagen des Lehramts nachzuprüfen.
Diejenigen Aussagen des II. Vaticanums, die zweideutig sind, müssen gemäß der gesamten Überlieferung und dem beständigen Lehramt der Kirche interpretiert werden.
In Zweifelsfällen haben die Aussagen des beständigen Lehramtes (frühere Konzile und Päpstliche Dokumente, deren Inhalt sich durch die Jahrhunderte als sichere und wiederholte Tradition erwiesen hat) Vorrang gegenüber zweideutigen oder neuen Aussagen des II. Vatikanischen Konzils, die nur schwer mit bestimmten Aussagen des beständigen und vorherigen Lehramtes übereinstimmen (z. B. die Pflicht des Staates, Christus, den König aller menschlichen Gesellschaften, öffentlich zu verehren; der wahre Sinn der bischöflichen Kollegialität im Verhältnis zum Päpstlichen Primat und der Gesamtleitung der Kirche; die Schädlichkeit aller nichtkatholischen Religionen und ihre Gefährlichkeit für das ewige Seelenheil).
Das II. Vatikanische Konzil muss als das gesehen und akzeptiert werden, was es wirklich war: ein vorrangig pastorales Konzil. Dieses Konzil hatte nicht die Absicht, neue Lehren vorzulegen oder sie sogar in einer endgültigen Form vorzulegen. In seinen Aussagen hat das Konzil die beständige und traditionelle Lehre der Kirche weitgehend bestätigt.
Einige der neuen Aussagen des II. Vaticanums (z. B. Kollegialität, Religionsfreiheit, ökumenischer und religiöser Dialog, die Haltung gegenüber der Welt) haben keinen endgültigen Charakter und wenn sie anscheinend oder tatsächlich mit den traditionellen und beständigen Aussagen des Lehramtes nicht übereinstimmen, müssen sie durch genauere Erklärungen und durch präzisere Ergänzungen lehrhafter Natur vervollständigt werden. Eine blinde Anwendung des Prinzips der „Hermeneutik der Kontinuität“ allein hilft auch nicht, weil dadurch zwanghafte Interpretationen geschaffen werden, die nicht überzeugen und nicht hilfreich sind, um zu einem klareren Verständnis der unwandelbaren Wahrheit des katholischen Glaubens und seiner konkreten Anwendung zu gelangen.
Es hat Fälle in der Geschichte gegeben, bei denen nicht-endgültige Aussagen gewisser ökumenischer Konzile später – dank einer gelassenen theologischen Debatte – verfeinert oder stillschweigend verbessert wurden (z. B. die Aussagen des Konzils von Florenz bezüglich der Materie des Weihesakraments, d.h. dass die Materie die Überreichung der Gegenstände wäre, wobei aber die sicherere und beständige Überlieferung sagte, dass die Auflegung der Hände des Bischofs genügen würde, eine Wahrheit, die zuletzt von Pius XII. im Jahre 1947 bestätigt wurde).
Wenn nach dem Konzil von Florenz die Theologen das Prinzip der „Hermeneutik der Kontinuität“ zu dieser konkreten Aussage des Konzils von Florenz (einer objektiv irrigen Aussage) blind angewendet hätten, und die These der Übergabe der Instrumente als Materie des Weihesakramentes als mit dem beständigen Lehramt übereinstimmend verteidigt hätten, wäre es wahrscheinlich nicht zum allgemeinen Konsens der Theologen gekommen bezüglich der Wahrheit, die besagt, dass nur die Handauflegung durch den Bischof die eigentliche Materie des Weihesakrament sei.
In der Kirche muss ein gelassenes Klima für eine doktrinelle Diskussion über jene Aussagen des II. Vaticanums geschaffen werden, die zweideutig sind oder die zu irrigen Interpretationen geführt haben. An einer solchen Diskussion ist nichts Skandalöses; im Gegenteil, sie wird ein Beitrag sein, um auf eine sicherere und vollständige Weise das Gut des unveränderlichen Glaubens der Kirche zu erhalten und zu erklären.
Man darf ein bestimmtes Konzil nicht überbetonen, indem man es absolut setzt und es de facto mit dem mündlichen (Heilige Überlieferung) oder dem geschrieben (Heilige Schrift) Wort Gottes gleichsetzt.
Das II. Vaticanum sagt selbst richtigerweise (vgl. Dei Verbum, 10), dass das Lehramt (Papst, Konzile, ordentliches und universales Lehramt) nicht über dem Wort Gottes steht, sondern unter ihm, ihm unterworfen und nur sein Diener ist (des mündlichen Wortes Gottes = Heilige Überlieferung und des geschriebenen Wortes Gottes = Heilige Schrift).
Von einem objektiven Standpunkt aus haben Aussagen des Lehramtes (Päpste und Konzile) definitiven Charakters mehr Wert und mehr Gewicht als Aussagen pastoralen Charakters, welche naturgemäß eine veränderliche und zeitliche Eigenschaft haben, die von geschichtlichen Umständen oder seelsorglichen Notwendigkeiten bestimmter Zeiten abhängen, wie es auf die meisten Aussagen des II. Vaticanums zutrifft.
Der originelle und wertvolle Beitrag des II. Vatikanischen Konzils besteht in der Lehre von der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit aller Kirchenmitglieder (Kap. 5 von Lumen Gentium), in der Lehre über die zentrale Rolle unserer Lieben Frau im Leben der Kirche (Kap. 8 von Lumen Gentium), in der Lehre von der Wichtigkeit der Laien in der Erhaltung und Verteidigung des katholischen Glaubens und ihrer Pflicht, die zeitlichen Dinge zu evangelisieren und zu heiligen gemäß dem beständigen Sinn der Kirche (Kap. 4 von Lumen Gentium), in der Lehre vom Primat der Anbetung Gottes im Leben der Kirche und in der Feier der Liturgie (Sacrosanctum Concilium 2; 5–10). Den Rest kann man in gewisser Hinsicht als sekundär betrachten, der in der Zukunft wahrscheinlich vergessen wird, wie es auch mit nicht definitiven pastoralen und disziplinären Aussagen verschiedener ökumenischer Konzilen der Vergangenheit der Fall war.
Die folgenden Themen: die Allerseligste Jungfrau Maria, Heiligung des persönlichen Lebens der Gläubigem mit der Heiligung der Welt gemäß dem beständigen Sinn der Kirche und der Primat der Anbetung Gottes, sind die dringendsten Gesichtspunkte, die in unseren Tagen gelebt werden müssen. Hierin hat das II. Vaticanum eine prophetische Rolle, die – unglücklicherweise – bisher noch nicht befriedigend umgesetzt worden ist.
Anstatt diese vier Aspekte im Leben zu verwirklichen, hat ein erheblicher Teil der theologischen und administrativen „Nomenklatura“ im Leben der Kirche während der vergangenen 50 Jahre zweideutige doktrinelle, pastorale und liturgische Themen vorangetrieben und tut es noch, wodurch die ursprüngliche Absicht des Konzils verzerrt oder seine weniger klaren oder zweideutigen Aussagen missbraucht werden, um eine andere Kirche zu schaffen – eine Kirche relativistischen oder protestantischen Typs.
Wir erleben in unseren Tagen den Höhepunkt dieser Entwicklung.
Das Problem der aktuellen Krise der Kirche besteht teilweise in der Tatsache, dass einige Aussagen des II. Vaticanums, die objektiv zweideutig sind, oder jene wenigen Aussagen, die schwer mit der beständigen Lehrtradition der Kirche übereinstimmen, „unfehlbar“ erklärt worden sind. Auf diese Weise wurde eine gesunde Diskussion mit einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Korrektur blockiert.
Zur selben Zeit wurde viel Mühe auf die Schaffung theologischer Aussagen verwandt, die im Gegensatz zur beständigen Überlieferung stehen (z. B. bzgl. der neuen Theorie von einem doppelten ordentlichen höchsten Subjekt in der Leitung der Kirche, d. h. der Papst allein und der gesamte Episkopat zusammen mit dem Papst; der Lehre von der Neutralität des Staates gegenüber der öffentlicher Anbetung, die er dem wahren Gott schuldet, der Jesus Christus ist, der König auch jeder menschlichen und politischen Gesellschaft; die Relativierung der Wahrheit, dass die katholische Kirche der einzige, von Gott gewollte und angeordnete Weg zum Heil ist).
Wir müssen uns von den Ketten der Verabsolutierung und der totalen Unfehlbarmachung des II. Vaticanums befreien. Wir müssen um ein Klima einer gelassenen und respektvollen Diskussion bitten: aus tiefer Liebe zur Kirche und zum unveränderlichen Glauben der Kirche heraus.
Wir können als ein positives Zeichen in dieser Richtung die Tatsache sehen, dass Papst Benedikt XVI. am 2. August 2012 ein Vorwort zu einem Band geschrieben hat, der sich in der Gesamtausgabe seiner Werke mit dem II. Vaticanum beschäftigt. In diesem Vorwort drückt Benedikt XVI. seinen Vorbehalt bzgl. bestimmter Inhalte in den Dokumenten Gaudium et spes und Nostra aetate aus. Aus dem Tenor dieser Worte Benedikts XVI. kann man sehen, dass gewisse konkrete Fehler in bestimmten Teilen dieser Dokumente durch die „Hermeneutik der Kontinuität“ nicht behebbar sind.
Eine volle und kanonisch ins Kirchenleben integrierte FSSPX könnte einen wertvollen Beitrag zu dieser Debatte beisteuern – wie es auch Erzbischof Marcel Lefebvre wünschte. Die volle kanonische Präsenz der FSSPX im heutigen Kirchenleben könnte ein allgemeines Klima einer konstruktiven Diskussion schaffen, damit das, was 2000 Jahre lang immer und überall und von allen Katholiken geglaubt wurde, auf eine klarere und sicherere Weise auch in unseren Tagen geglaubt werde und dadurch auch die wahre pastorale Absicht der Väter des II. Vatikanischen Konzils verwirklicht werde.
Die authentische pastorale Absicht zielt auf die ewige Rettung der Seelen ab – eine Seelenrettung, die nur durch die Verkündung des gesamten Willens Gottes erlangt werden wird (Apg. 20, 7). Die Zweideutigkeit in der Glaubenslehre und in ihrer konkreten Anwendung (in der Liturgie und dem pastoralen Leben) würde die ewige Rettung der Seelen gefährden und folglich anti-pastoral sein, weil ja die Verkündung der Klarheit und Vollständigkeit des katholischen Glaubens und seine getreue Anwendung der ausdrückliche Wille Gottes ist.
Nur der vollkommene Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, Der uns durch Christus, das menschgewordene Wort, und durch die Apostel den wahren Glauben offenbarte, den Glauben, der vom Lehramt beständig in demselben Sinn ausgelegt und verwirklicht wurde, wird die Rettung der Seelen bringen.
+ Athanasius Schneider
Weihbischof der Erzdiözese der Heiligen Maria in Astana, Kasachstan
Bild: MiL/fratresinunum.com (Screenshots)