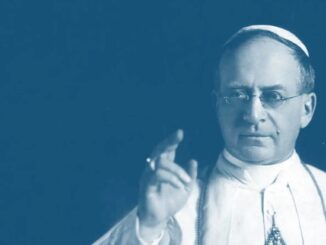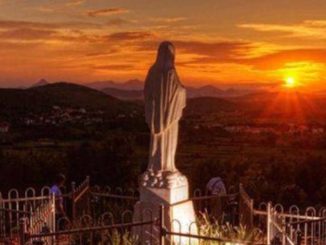(Rom) „Russicum Addio“, schreibt der Vatikanist Sandro Magister. „Für das glorreiche, 1929 von Papst Pius XI. gegründete Päpstliche Kolleg für die Ausbildung russischer Seminaristen, aber mehr noch um den katholischen Glauben in der Sowjetunion wachzuhalten, ist die Schließung eine beschlossene Sache.“
Das Päpstliche Kollge Russicum befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Patriarchalbasilika Santa Maria Maggiore. Die Kirche ist dem Mönchsvater Antonius geweiht.
Träger der Einrichtung, die nach der blutigen Christenverfolgung durch die Bolschewisten errichtet wurde, ist von Anfang an der Jesuitenorden, dem Papst Pius XI. diesen Zufluchtsort für russische Katholiken, aber auch orthodoxe Russen anvertraute, die unter dem Eindruck der apokalyptischen Ereignisse im ehemaligen Zarenreich nach der Oktoberrevolution zum katholischen Glauben konvertierten.
Zufluchtsort während der Sowjetzeit
Im Russicum wurden die Missionare ausgebildet, die den Mut hatten, für ihren Glauben in die Sowjetunion zu gehen, um dort zu evangelisieren. „Es herrschte ein gewisser Enthusiasmus, nach Rußland zu gehen, um das Evangelium zu verkünden und notfalls dafür zu sterben“, so der 1915 geborene österreichisch-schweizerische Jesuit, Pater Ludwig Pichler, über seine Erinnerungen am Russicum.
Zu den Studenten des Russicums gehörten der selige Theodor Romscha (1911–1947), Eparch der Ruthenischen griechisch-katholischen Kirche von Mukatschewe, der das Martyrium erlitt. Ebenso Pater Pietro Leoni (1909–1995), Pater Paul Chaleil (1913–1983), Pater Walter Ciszek (1904–1984), Pater Viktor Nowikow (1905–1979), die alle dem Jesuitenorden angehörten, alle in der Sowjetunion missionierten und alle im Gulag interniert wurden.

Zu den vergessenen Gestalten dieses Päpstlichen Kollegs gehört Julia Nikolajewna Dansas, die von 1939 bis zu ihrem Tod 1942 am Russicum lehrte. Die Nachfahrin eines alten byzantinischen Adelsgeschlechtes, zu dessen Vorfahren Kaiser Romanos III. Agyros (968‑1034) gehörte, hatte sich in ihrer Jugend mit okkulten Praktiken befaßt, Geschichte und Philosophie in Paris studiert, wurde Hofdame der russischen Zarin und kämpfte nach der Oktoberrevolution in einem Kosakenregiment gegen die Bolschewisten. 1920 lernte sie den später von der katholischen Kirche seliggesprochenen Leonid Fjodorow kennen und konvertierte zum katholischen Glauben. Sie trat in St. Petersburg in einen neugegründeten katholischen Schwesternorden ein. 1923 wurde sie im Zuge der kommunistischen Katholikenverfolgung verhaftet und wurde auf den Solowezki-Inseln interniert. 1932 kam sie frei und durfte 1934 unter der Bedingung nach Berlin ausreisen, über die sowjetischen Konzentrationslager eine Schweigeerklärung zu unterschreiben. In Frankreich trat sie in ein Kloster des Dominikanerinnenordens ein und verfaßte in ihren letzten Lebensjahren mehrere Schriften, in denen sie das Christentum dem Marxismus gegenüberstellte, und diesen einer Kritik unterzog. Schriften, darunter ihr Buch Katholische Gotteserkenntnis und marxistische Gottlosigkeit, die unter den veränderten Bedingungen der Nachkriegszeit nicht nur im Bereich der Philosophie, sondern auch innerkirchlich kaum mehr Beachtung fanden.
Gebäude übernimmt das Päpstliche Orientalische Institut
Das Gebäude, in dem das Russicum untergebracht ist, soll an das angrenzende, ebenfalls vom Jesuitenorden geführte Päpstliche Orientalische Institut abgetreten werden. Das Orientalische Institut, das im kommenden Jahr das 100. Jahr seines Bestehens begeht, soll erweitert werden. Die Zahl der Fakultät wird erhöht und gleichzeitig auch der Rang von einem Institut zu einer Universität.
Dabei erfreute sich das Orientinstitut des Papstes zuletzt keiner allzu guten Gesundheit. Vor einem Jahr war es zu Turbulenzen an der Institutsspitze gekommen.

Neuer Rektor am Orientinstitut ist Pater David Nazar, ein kanadischer Jesuit ukrainischer Abstammung . Von 2005–2015 war er Ordensoberer in der Ukraine. Er ist fest entschlossen, das Institut aus den Schlagzeilen zu führen und zu neuem Ruhm zu bringen. Das Orientinstitut war immerhin bereits Schauplatz „historischer Begegnungen“ und konnte „illustre Gäste“ begrüßen.
Pater Nazar rechnet, daß er bald grünes Licht für die Übernahme des Russicums bekommt sowohl von der Kongregation für die Ostkirchen, deren Präfekt, der argentinische Kardinal Leonardo Sandri, auch Großkanzler des Orientinstituts ist als auch vom Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen und von Papst Franziskus, aber „nicht zuletzt auch das Wohlwollen des Moskauer Patriarchats und des Kremls“, so Magister. Der russisch-orthodoxe Metropolit Nikodim von Leningrad und Nowgorod war in der Breschnew-Zeit bei den Jesuiten in Rom „zu Hause“. Bei seinen Rom-Aufenthalten nächtigte er entweder im Russicum oder „mit allen Ehren“ in der Villa Cavalletti von Frascati als Gast des damaligen Ordensgenerals Pedro Arrupe.
Nikodim wiederum berief den Jesuiten Miguel Arranz als Professor an seine Theologische Akademie in Leningrad, während eine Schar russischer Studenten zum Studium an die päpstlichen Universitäten nach Rom geschickt werden konnten.
Als zwischen Katholiken und Russisch-Orthodoxen Interkommunion herrschte

Pater Arranz war als Übersetzer bei jener Audienz am 5. September 1978 im Vatikan im Einsatz, als Nikodim von Papst Johannes Paul I. empfangen wurde. Während der Audienz erlitt der Metropolit einen Herzinfarkt und starb vor den Augen des Papstes. „Der Jesuit wollte nie preisgeben, was der Metropolit bei dieser Begegnung dem Papst gesagt hat, der selbst drei Wochen später sterben sollte“, so Magister.
Mit dem Tod Nikodims hielt wieder Winter Einzug in den Beziehungen zwischen Rom und Moskau. „Unter dem Metropoliten hatte der Dialog zwischen der Kirche von Rom und dem Patriarchat von Moskau einen Höhepunkt erreicht“, so Magister. Das Moskauer Patriarchat erlaubte in jener Zeit sogar die Interkommunion zwischen Orthodoxen und Katholiken, die kurze Zeit darauf unter dem Druck des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel und Rivalen wieder verboten wurde.
Die Interkommunion hatte von 1439–1453 bestanden, als durch das Konzil von Florenz die volle Einheit zwischen West- und Ostkirche unter der Führung des Papstes verwirklicht worden war. Die türkischen Eroberer setzten dann jedoch aus politischen Gründen antiwestliche Kirchenvertreter an die Spitze des Patriarchats. Erst mehr als 500 später konnte sie unter Nikodim noch einmal kurzzeitig erreicht werden.
„Das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel hat die Interkommunion mit den Katholiken, trotz seines superdialogfreundlichen Rufs, bis heute nicht erlaubt“, so Magister.
„Es ist kurios, daß Pater Antonio Spadaro“, der Schriftleiter der römischen Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica und enger Papst-Vertrauter, „diesen glücklichen, ökumenischen Frühling mit keinem Wort erwähnte“, als er in seiner Zeitschrift am 12. März die Umarmung zwischen Franziskus und dem Moskauer Patriarchen Kyrill in Havanna als einen in der Geschichte nie gekannten Neubeginn feierte. Eine Unterlassung die ganz dem revisionistischen Stil der Sowjetunion entspricht, wie die bevorstehenden Auslöschung des glorreichen Russicums.“
Das folgende Video zeigt einen Bericht der italienischen Wochenschau vom 15. April 1940 über das Russicum.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Youtube