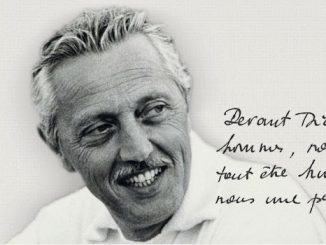Während der Papst seit seiner Wahl unter ständiger Beobachtung steht und diese Aufmerksamkeit auf seine ganz eigene Art und Weise nützt, ist sein Leben als Mario Jorge Bergoglio noch nicht so bekannt und teilweise wenig beleuchtet. Argentinien ist eben weit. Zudem muß ein Katholik nicht unbedingt das Vorleben eines Papstes kennen.
Die Jahre als Ordensprovinzial und seine ordensinterne Ausgrenzung
Eine ganze Reihe von Büchern sind erschienen und noch viel mehr werden folgen. Ihre Qualität ist unterschiedlich. Einige erhellen einzelne Details. Dazu gehört etwa das Buch „Die Bergoglio-Liste“ (La lista di Bergoglio) des Journalisten Nello Scavo über die Rettung von Regimegegnern während der Militärdiktatur in Argentinien durch den damaligen Jesuitenprovinzial.
Dennoch ist insgesamt noch wenig über die sechs Jahre bekannt, die Bergoglio 1973 bis 1979 Provinzial der argentinischen Provinz seines Ordens war. Dabei geht es auch um die wirklichen Gründe, die zu seiner Ausgrenzung innerhalb der Provinz und des Ordens führten und schließlich zu seiner Strafversetzung in die tiefste argentinische Provinz nach Cordoba als Spiritual. Eine Ächtung unter Jesuiten, die erst durch Papst Johannes Paul II. durchbrochen wurde, als er ihn 1992 zum Weihbischof von Buenos Aires ernannte.
Studienaufenthalt in Deutschland von Ordensoberen angeordnet?
Eine offene Frage ist auch Bergoglios Deutschland-Aufenthalt im Jahr 1986. Offiziell heißt es in der Biographie des Vatikans, um seine Dissertation fertigzustellen und zu promovieren. Dazu ist es aber nie gekommen. Bergoglios Aufenthalt in Deutschland beschränkte sich auf wenige Monate. Mit seiner Dissertation scheint er sich in dieser Zeit nicht wirklich befaßt zu haben.
Als er im März 1986 in Frankfurt am Main ankam, bestand die Absicht, wie von der Jesuitenhochschule Sankt Georgen bestätigt wird, eine Arbeit über den großen deutschen Theologen Romano Guardini zu verfassen. Von ihm hatte der ehemalige Jesuitenprovinzial, bei seiner Ankunft in Deutschland schon 49 Jahre alt, vor allem zwei Schriften gelesen, in spanischer Übersetzung. Eine war „Der Gegensatz“, mit dem spanischen Titel Contrasteidad, die sich sehr kritisch mit Hegel und der marxistischen Dialektik auseinandersetzt.
Magister äußert inzwischen die Vermutung, daß der ganze Deutschland-Aufenthalt weniger ein Wunsch Bergoglios war, als vielmehr eine Anweisung seiner Oberen im Jesuitenorden. Das erklärt auch, daß die Dissertation nie über die Planungsphase hinauskam und nach wenigen Monaten abgebrochen wurde.
Magister verweist in diesem Zusammenhang auch auf Bergoglios autobiographisches Interviewbuch „El Jesuita“. Darin schildert der heutige Papst, daß er sich, wann immer er in Deutschland ein Flugzeug aufsteigen sah, vorstellte, selbst drinnen zu sitzen, um nach Argentinien zurückzukehren.
Das Gnadenbild Maria Knotenlöserin von Augsburg

Den Aufenthalt an Rhein und Main nützte der Argentinier, um die Jesuitenniederlassungen in Deutschland ein bißchen kennenzulernen. So kam er auch nach Augsburg, wo es seit 1954 in St. Peter am Perlach eine Jesuitengemeinschaft gibt. In der dortigen Kirche entdeckte Bergoglio das Gnadenbild von Maria Knotenlöserin. Das barocke Bild von Johann Georg Melchior Schmidtner stammt aus dem Jahr 1700. Das Gnadenbild zeigt die auf einer Mondsichel stehende Gottesmutter Maria mit Sternenkranz, von Engeln umgeben, vom Heiligen Geist in Form einer Taube überschwebt, wie sie die Knoten eines langen Bandes löst und zugleich mit dem Fuß den Kopf einer „verknoteten“ Schlange zertritt. Die Knoten stellen die Probleme, Schwierigkeiten und Sünden im Leben eines Menschen dar. Und Maria ist jene, die Zuflucht und Hilfe ist, wenn der Mensch mit seinen „Knoten“ im Leben nicht mehr weiter weiß.
Die Darstellung hatte es dem Jesuiten Bergoglio angetan. Als er bald darauf nach Argentinien zurückkehren konnte, nahm er eine größere Anzahl von Karten mit der Darstellung der Knotenlöserin von Augsburg mit. Die Begegnung mit dem Gnadenbild und der Anrufung Mariens als Knotenlöserin scheint den von Heimweh geplagten Bergoglio etwas mit Deutschland versöhnt und seinem Aufenthalt eine neue, unerwartete Wendung gegeben zu haben.
Die Dissertation war schnell und nun endgültig vergessen und auch Romano Guardini hinterließ, wie es scheint, keine bleibenden Eindrücke. Wie Magister bereits vor kurzem aufmerksam machte, erwähnte ihn Papst Franziskus in seinem Civiltà Cattolica-Interview nicht, als er über die Autoren sprach, die ihn geprägt haben und ihm besonders wichtig sind. Auch sonst hat er Guardini noch nie genannt.
Die Verehrung der Knotenlöserin in Argentinien
Durch den Deutschland-Aufenthalt brachte Bergoglio die Verehrung von Maria Knotenlöserin nach Argentinien. Als er bereits Weihbischof von Buenos Aires war, gab er eine Kopie des Gnadenbildes von Perlach in Auftrag und schenkte es einer Pfarrei im Barrio de Agronomia, einem Stadtteil von Buenos Aires. Altes Jesuitenland, das dem Orden nach der Aufhebung im 18. Jahrhundert von der Regierung genommen wurde.
In der Pfarrei begann das Bild der Maria „desatanudos“ immer mehr Gläubige anzuziehen. Innerhalb weniger Jahre etablierte sich eine Wallfahrt zum Gnadenbild aus ganz Buenos Aires und auch von weiter her, die an jedem 8. Tag des Monats stattfindet.
„Nie fühlte ich mich mehr als Instrument in der Hand Gottes als jenes Mal“, vertraute Bergoglio Pater Fernando Albistur, einem Mitbruder im Jesuitenorden an, der sein Schüler war. Pater Albistur unterrichtet heute Biblische Theologie am Colegio Maximo von San Miguel in Buenos Aires. Er gehört zu den 20 Freunden Bergoglios, zehn Jesuiten und zehn Laien, die Alejandro Bermà¹dez befragte und deren Interviews er als Buch mit dem Titel „Pope Francis. Our Brother, Our Friend“ im Verlag Ignatius Press in den USA veröffentlichte.
Im selben Buch findet sich auch ein Interview mit Pater Juan Carlos Scannone, dem renommiertesten argentinischen Theologen, der bereits den jungen Bergoglio unterrichtete. Pater Scannone meint, daß anhand von Maria Knotenlöserin das pastorale Profil von Papst Franziskus und seine Betonung des „Volkes“ besser verständlich werde. Laut Pater Scannone ist Bergoglio ein Vertreter der „Volkstheologie“, die auch als „Argentinische Schule“ der Befreiungstheologie bekannt ist, allerdings nichts mit der marxistischen Hauptströmung der Befreiungstheologie zu tun hat.
Bergoglio war nicht Theologe und noch weniger Akademiker – De Lubac und de Certeau
„Bergoglio war nicht ein Theologe und noch weniger ein Akademiker“, so Magister. Zu seinen bevorzugten Theologen zählt der heutige Papst Henri De Lubac und Michel de Certeau, beide Jesuiten, wenn auch von ganz unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. De Lubac war ein Vertreter der Nouvelle théologie, den die Entwicklung der Nachkonzilszeit allerdings zu einem gewissen Umdenken veranlaßte. Papst Johannes Paul II. machte ihn im hohen Alter zur Würdigung seines Lebenswerkes zum Kardinal. An de Certreau scheinen Bergoglio vor allem soziologische Studien interessiert zu haben. Zitiert hat er bisher nur De Lubac und von diesem eigentlich nur ein Werk, „Betrachtungen über die Kirche“ (deutsche Ausgabe, Styria Verlag 1954), und daraus eigentlich nur eine Stelle, jene über die „Weltlichkeit“ der Kirche, so Magister.
„Auch als Papst ist er also vor allem ein Mann der Tat, der pastoralen Aktion“, so der Vatikanist. Wer ihn aus der Nähe kennt, wie die 20 von Alejandro Bermà¹dez Interviewten bekräftigt einhellig, daß Jorge Mario Bergoglio Führungsqualitäten besitzt, was im vergangen Sommer Kardinal Timothy Dolan in Frage stellte, vor allem aber eine besondere Geschicklichkeit des Kalküls. „Keine seiner Gesten, keines seiner Worte ist dem Zufall überlassen“, so Magister. „Seine Priorität gilt der Seelsorge. Seine Predigten sind bewußt diesem Profil angepaßt. Er wendet sich vor allem an die einfachen Menschen, an die Glaubensschwachen, die Sünder und die Fernstehenden. Nicht als Gesamtheit, sondern so, als spreche er zu jedem einzeln.“
Lieber Seelsorge statt Glaubenslehre
In Argentinien wird dem Kardinal Bergoglio bescheinigt, in der Glaubenslehre durch und durch orthodox zu sein. Dennoch rührt er die umstrittenen Themen, in denen die kirchliche Lehre auf Widerstand stößt, die heißen Themen der aktuellen Auseinandersetzung nicht gerne an. Im Civiltà Cattolica-Interview war er kurz angebunden und sagte nur: „Im übrigen kennt man ja die Ansichten der Kirche, und ich bin ein Sohn der Kirche.“ Er scheint in der Lehre eine Behinderung seiner seelsorgerischen Aufgabe zu sehen.
Seelsorge ohne Glaubenslehre? Eine schwer vorstellbare Gratwanderung gerade für einen Papst, dessen Aufgabe die Seelsorge ist, mehr noch aber die Bewahrung des Glaubens und seine Verkündigung. Die zitierte Antwort in der Civiltà Cattolica mag sich für Personen der hinteren Reihen eignen. Eignet sie sich aber für einen Papst?
Die Einmischung in politische Fragen überläßt er den Bischöfen. Die Darlegung der Glaubenslehre überläßt er ebenso lieber anderen. „Sich selber behält er den barmherzigen Stil eines Seelenhirten vor“, so Magister.
Bewahrung der Glaubenslehre liegt in der Hand von Kurienerzbischof Gerhard Ludwig Müller
Wem aber kann ein Papst die Darlegung der Glaubenslehre überlassen? Da bliebe nur noch der Präfekt der Glaubenskongregation, dem in diesem Pontifikat mehr denn je die sprichwörtliche Rolle eines obersten Glaubenswächters ganz real zuzufallen scheint. Kurienerzbischof Gerhard Ludwig Müller, noch von Papst Benedikt XVI. berufen, aber von Papst Franziskus im August bestätigt, scheint diese Situation erkannt zu haben und nimmt die Herausforderung an. Am 23. Oktober ließ er seine ausführliche Stellungnahme zur Frage der Unauflöslichkeit der Ehe vom Juni in allen verschiedenen Sprachausgaben des Osservatore Romano veröffentlichen. Darin bekräftigte er die katholische Lehre des Ehesakraments und verwarf vor allem deutsche Bestrebungen einer „Lockerung“. Eine Zulassung wiederverheirateter Geschiedener sei ebenso unmöglich wie die Übernahme der orthodoxen Praxis einer Zweitehe in Form eines Bußaktes.
Magister ist der Überzeugung, daß der Schritt mit Papst Franziskus abgesprochen ist. Der Papst war es gerade, der durch einige Äußerungen die Diskussion über eine Änderung der kirchlichen Lehre und Praxis angeheizt hatte.
Glaubenspräfekt Müller korrigierte „Mißverständnisse“ zu Wiederverheirateten und Gewissen
Sollte Kurienerzbischof Müller auch in Eigenregie gehandelt haben, dürfte die Richtung durchaus der päpstlichen Intention entsprechen. Dem Glaubenspräfekten fiel es seiner Stellungnahme auch zu, weitere „Mißverständnisse“ um einige Formulierungen von Papst Franziskus rund um „Barmherzigkeit“ und „Gewissen“ zu korrigieren.
Damit zeichnet sich eine Doppelspitze ab, eines pastoral handelnden Papstes und einer die Orthodoxie gewissermaßen allein wahrenden Glaubenskongregation, die auch die Aufgabe hat, einen „spontanen“ Papst nachträglich „zu korrigieren“. Wobei das Wort „spontan“ nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern mehr für „Spielraum“ steht.
Die „Arbeitsteilung“ zwischen Papst Franziskus und Glaubenspräfekt Müller ist nicht unproblematisch. Sie verlangt, daß der Kurienerzbischof ganz seiner Verantwortung bewußt, über sich selbst hinauswachsen muß und unerbittlich mit sich selbst es in Kauf nehmen muß, was der Papst nicht in Kauf nehmen möchte, nämlich notfalls der Buhmann zu werden. Nicht nur der Kirchengegner, sondern auch mancher kirchlicher Kreise. Eine Aufgabe, die Erzbischof Müller durchaus zugetraut werden darf.
Kann der Glaubenspräfekt mit päpstlicher Kommunikationsstrategie mithalten?
Nicht unbedenklich ist aber vor allem die Außenkommunikation. Beim konkreten Thema der wiederverheiratet Geschiedenen wurde die „Öffnung“ des Papstes von den Medien sofort als „Sensation“ um die Welt getragen mit allem damit verbundenen Wecken von Wünschen, Begehrlichkeiten und Forderungen. Die „korrigierende“ und die katholische Lehre bekräftigende Stellungnahme von Erzbischof Müller wurde von der weltlichen Presse, die nun mal für die breite Meinungsbildung entscheidend ist, nicht wahrgenommen. Wahrgenommen wurde sie von den katholischen Medien, wenn auch nicht allen. Das Beispiel zeigt eine völlig ungleiche Möglichkeit, Inhalte zu kommunizieren. Besteht nicht die Gefahr, daß die unumstößliche Glaubenslehre gegenüber einer pastoralen „Priorität“ ins Hintertreffen gelangt. Weit mehr noch, als sie es ohnehin schon in der kirchlichen Praxis vieler Pfarreien und Diözesen ist?
Eine Frage, auf die der Vatikanist Sandro Magister nicht eingeht. Er ist jedoch überzeugt, daß sich dieser Dualismus Papst – Glaubenspräfekt, wie er zum aktuellen Thema der Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zur Kommunion vorexerziert wurde, in Zukunft zu anderen Themen wiederholen wird.
Kann damit der Knoten gelöst werden, der dieses Pontifikat belastet? Nämlich die offensichtliche Abkehr von Papst Franziskus von der „anthropologischen Herausforderung“, der sich Johannes Paul II. und Benedikt XVI. so intensiv gestellt hatten.
Papst Franziskus erwähnte ausdrücklich Maria als Knotenlöserin am 12. Oktober auf dem Petersplatz, am Vorabend zum Marientag des Jahrs des Glaubens, für den eigentlich die Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens angekündigt war. Die Knotenlöserin wird der Papst und wird die Kirche wohl noch dringend brauchen.
Text: Settimo Cielo/Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Diözese Regensburg