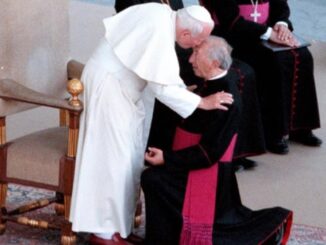Während Papst Leo XIV. am Freitag der Vorwoche belgische Mißbrauchsopfer empfing, blieb der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Victor Manuel „Tucho“ Fernández, abwesend – ausgerechnet an dem Tag, an dem die Opfer ihn sprechen sollten.
Es war ein Termin, der für die fünfzehn belgischen Mißbrauchsopfer von großer Bedeutung war – und für die Kirche eine Gelegenheit, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Doch was als Zeichen der Nähe und des Dialogs geplant war, endete in einer Szene, die einige Beobachter als symptomatisch empfinden: Das Treffen mit dem Präfekten des Glaubensdikasteriums fiel aus. Der Grund? Kardinal Tucho Fernández, der oberste Verantwortliche für die Untersuchung kirchlicher Mißbrauchsfälle, „arbeitet freitags nicht“.
Wie belgische Medien berichten, hatte ein Untergebener den Termin auf den Freitagnachmittag gelegt – offenbar in Unkenntnis dieser Gewohnheit. Das Ergebnis: Fünfzehn Menschen, die über Jahrzehnte um Anerkennung und Gehör ringen, fanden bei Papst Leo XIV. offene Türen, während sie beim Glaubenspräfekten vor verschlossenen standen. Der Mann, der nach eigenem Bekunden die Kirche „vom Mißtrauen zur Zärtlichkeit“ führen will, hatte frei.
Der Vorfall überschattete den Besuch der Betroffenen, die am folgenden Tag von Papst Leo XIV. empfangen wurden. Der Papst, der im Mai das Erbe seines Vorgängers Franziskus antrat, erfüllte damit ein Versprechen, das Franziskus während seiner Pastoralreise nach Belgien im September 2024 gegeben hatte. Das Gespräch im Vatikan dauerte über zwei Stunden – länger als geplant – und wurde von den Teilnehmern als ehrlich und sehr menschlich beschrieben.
„Der Papst hat uns zugehört und Mitgefühl gezeigt“, erklärte Aline Colpaert, eine der Betroffenen. Sie sprach über die Notwendigkeit, angehende Priester besser auf ihre Verantwortung vorzubereiten, damit sich Mißbrauch nicht wiederhole. Der Papst, so berichtete sie, habe zugestimmt und erzählt, er selbst habe in seiner Ausbildung entsprechende Schulung erhalten – ohne freilich zu behaupten, das könne jedes Risiko bannen.
Auch Jean Marc Turine, Schriftsteller und einer der Teilnehmer, zeigte sich bewegt, doch zugleich ernüchtert: „Er war ehrlich, aber wir dürfen nicht zu viel erwarten. Besonders nicht von der Kirche in Belgien“. Mehrere Opfer übergaben dem Papst eine schriftliche Bitte um die Entlassung des Erzbischofs von Mecheln-Brüssel, Luc Terlinden, dem sie völlige Empathielosigkeit vorwerfen.
Leo XIV. zeigte Verständnis. Er versprach, die belgische Kirche zur Übernahme größerer Verantwortung zu drängen. Doch zugleich räumte er ein, seine Einflußmöglichkeiten seien begrenzt: „Ich bin erst seit sechs Monaten im Amt“, habe er wiederholt gesagt.
In Belgien selbst bleibe die Situation prekär. Die von der Kirche gegründete Stiftung Dignity gewährt seit 2022 anerkannten Opfern von Mißbrauch von Klerikern und kirchlichen Mitarbeitern eine Unterstützung von 3.000 Euro für psychotherapeutische Behandlung – zusätzlich zu früheren Entschädigungen zwischen 2.500 und 25.000 Euro, wie sie der belgische Staat 2012 gesetzlich festgelegt hatte. Für die Betroffenen ist das zu wenig, wie sie betonen, denn „die seelischen und körperlichen Folgen begleiten sie ein Leben lang“.
Zum Vergleich: In der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden existieren klare Entschädigungsprogramme; in den USA hingegen, wo ein ganz anderes Entschädigungssystem gilt, mußten Diözesen – darunter Los Angeles, San Francisco und Milwaukee – infolge milliardenschwerer Schadenersatzforderungen Insolvenz anmelden.
Im Gegensatz dazu bleibt die belgische Kirche zurückhaltend. Der Zwischenfall mit Kardinal Fernández wurde in Brüssel wie in Rom als beschämend empfunden. Denn er berührt die Glaubwürdigkeit eines Mannes, der sich selbst als geistigen Erneuerer versteht, als Hüter der Lehre und Freund des verstorbenen Papstes Franziskus. Doch sein Image des verständnisvollen Theologen wirkt brüchig, wenn ihm die Opfer von Mißbrauch gegenüberstehen möchten – und er einfach nicht erscheint.
Während Papst Leo XIV. ehrlich bemüht war, Nähe zu zeigen, wie die belgischen Besucher attestierten, gönnte sich Kardinal Fernández lieber einen freien Tag.
Völlig offen bleibt, ob Leo XIV. – anders als sein Vorgänger Franziskus – den Mut und die Absicht haben wird, das Hauptproblem des sexuellen Mißbrauchs durch Kleriker beim Namen zu nennen, denn die Zahlen sind eindeutig: In über achtzig Prozent der Fälle handelt es sich um homosexuellen Mißbrauch. Franziskus verschloß davor die Augen – und die Belgische Bischofskonferenz tat es ihm gleich. Doch wer wirklich Heilung will, muß die Wahrheit aussprechen, auch wenn sie unbequem ist. Schweigen heißt fortsetzen. Franziskus schwieg. Warum? Wen wollte er schonen – und wen schonen heute Belgiens Bischöfe? Wieviel Gender-Ideologie bedingt das Handeln?
Auch was die Opfer betrifft, wären einige Anmerkungen angebracht, auf die aber an dieser Stelle verzichtet werden soll.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL