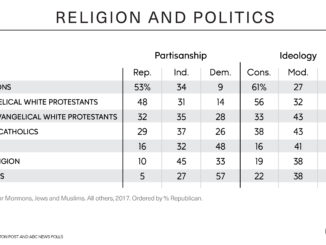Die Einweihung einer U‑Bahnstation in Teheran mit dem Namen „Heilige Jungfrau Maria“, geschmückt mit christlicher Ikonographie, stellt eine symbolische Geste gegenüber der christlichen Minderheit in dem sich seit 1979 „Islamische Republik“ nennenden Staat, dem einstigen Persien. Derselbe Iran wird von Menschenrechtsorganisationen beschuldigt, andere Glaubensrichtungen zu verfolgen. Was stimmt nun?
Am Eingang der neuen Station der 2019 eröffneten Linie 6 der Teheraner U‑Bahn ist der Name „Maryam‑e Moqaddas“ oder „Heilige Jungfrau Maria“ zu lesen. Die Station befindet sich im Zentrum der iranischen Hauptstadt und ist mit sieben Wandgemälden geschmückt, die Jesus, Maria sowie kulturelle Elemente der christlichen armenischen Minderheit des Landes zeigen.
Die Station liegt direkt gegenüber der Kathedrale St. Sarkis der Armenisch-Apostolischen Kirche – angrenzend an ein Wandbild des Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, der mit strengem Blick auf den Platz schaut. Die spanische Nachrichtenagentur EFE stellte die neue U‑Bahnstation in einem Videobericht vor (siehe unten). Das Teheraner U‑Bahnnetz befördert täglich über vier Millionen Fahrgäste und verfügt über eine Gesamtlänge von mehr als 220 Kilometern – das entspricht in etwa dem U‑Bahnnetz von Paris, übertrifft jedoch jenes von Berlin, Wien oder Rom bei weitem.
Die neue Station, die 11 Millionen US-Dollar kostete und in 32 Metern Tiefe liegt, „sendet die Botschaft an die Welt, daß Gläubige verschiedener Religionen im Iran problemlos und in Freiheit leben“, erklärte Abbas Fathalipour, der schiitische Projektleiter, während einer geführten Besichtigung.
„Der Name der Jungfrau Maria ist den Iranern sehr heilig, und im Koran gibt es eine Sure, die ihr gewidmet ist“, fügte Fathalipour hinzu.
Für Pfarrer Grigoris Nersisian vom armenischen Patriarchat in Teheran ist die neue U‑Bahnstation ein Zeichen dafür, „daß dem Christentum im Iran großer Respekt entgegengebracht wird von seiten der Muslime“.
Die Station ist ohne Zweifel eine Hommage an das Christentum – mit Wandbildern, die die betende Jungfrau Maria zusammen mit der Taube des Heiligen Geistes oder Jesus Christus als Symbol des Lichts und der Hoffnung für die Menschheit zeigen, erklärt die Schiitin Tania Khaligh Mehr, die Architektin, die für die Gestaltung verantwortlich war.
Wie es kaum anders zu erwarten war, finden sich auch Verse des persischen Dichters Hafez über die Auferstehung Jesu an den Wänden, ebenso wie Zitate des obersten iranischen Führers Ali Chamenei über die Rolle Christi als Bote der Barmherzigkeit.
Die christlichen Darstellungen in der Station haben in den sozialen Netzwerken eine hitzige Debatte über Religionsfreiheit im Iran ausgelöst – mit Vergleichen zu Israel, dem erbitterten Feind der Islamischen Republik.
Die Realität ist jedoch komplexer: Im Iran lebten Christen und Juden schon lange bevor der Islam aufkam, vor allem armenische und assyrische Christen, aber auch die kleine katholische Gemeinschaft. Diese beiden Gruppen haben aufgrund ihres Glaubens keine Schwierigkeiten im Iran. Es gibt Hunderte von Kirchen und Synagogen im Land.
Das armenische Viertel Teherans wird zur Weihnachtszeit festlich geschmückt mit christlicher Dekoration, Christkindern, und es erklingen Weihnachtslieder – wovon viele muslimische Iraner angezogen werden, um Photos zu machen und um es als fröhlich und farbenfroh empfundene Festzeit zu genießen.
Gleichzeitig aber prangern Menschenrechtsorganisationen die Verfolgung an.
„Religiöse Minderheiten litten unter Diskriminierung, sowohl gesetzlich als auch in der Praxis – etwa beim Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen, Adoption, politischen Ämtern und religiösen Stätten“, heißt es im jüngsten Menschenrechtsbericht von Amnesty International über den Iran.
„Die Behörden durchsuchten Hauskirchen und nahmen konvertierte Christen willkürlich fest“, heißt es dort weiter – konkret zu dem Druck, dem die christliche Gemeinschaft im Land ausgesetzt ist. Gemeint sind vor allem protestantische Freikirchen nach US-amerikanischem Stil.
Die iranische Staatsführung betrachtet freikirchliche Gruppen nicht als einen historisch-kulturellen Bestandteil des Landes. Zudem wurde ihr Vorgehen in den 60er und 70er Jahren als „aggressiv“ wahrgenommen. Vor allem aber sehen die Mullahs freikirchliche Aktivitäten als Tarnung für geheimdienstliche Operationen der USA. Tatsächlich gibt es dokumentierte Fälle, in denen US-Geheimdienste – insbesondere die CIA – Missionswerke sowie religiöse Organisationen und Einzelpersonen aus dem freikirchlich-evangelikalen Spektrum als Deckmantel für ihre Operationen genutzt haben.
Insgesamt bekämpfte die 1979 von Khomeini gegründete theokratische Islamische Republik den westlichen Einfluß, der während der Herrschaft des Schahs gefördert worden war. Mohammad Reza Pahlavi war 1953 durch einen von den USA gesteuerten Putsch an die Macht gekommen und errichtete mit Unterstützung der USA und Israels ein säkulares, westlich orientiertes Regime. Der Geheimdienst des Schah-Regimes, die SAVAK, war für seine massive Repression und Brutalität berüchtigt. Zwar stand die SAVAK unter der Leitung der CIA, doch wurde sie konkret vom israelischen Mossad aufgebaut. Bis 1979, als der Schah gestürzt und die Beziehungen zu den USA und Israel abgebrochen wurden, prägte diese enge Zusammenarbeit die Innenpolitik des Landes.
Khomeini, der spätestens seit den frühen 1960er Jahren gegen Israel und dessen Einfluß im Iran agitierte, war dabei trotz seiner Radikalität nicht antisemitisch motiviert. Sein Antrieb war keine religiöse Kritik, sondern seine tiefe Abneigung gegen das, was er als „westlichen, imperialistischen Kolonialismus“ bezeichnete. Im Westen sah er nicht nur eine politische, sondern vor allem eine kulturelle Bedrohung. Israel betrachtete er als Produkt angelsächsischen Imperialismus. Deshalb bekämpfte er nicht nur die USA als Ursprung eines politischen und kulturellen Imperialismus, sondern auch Israel, das er als dessen „Arm und Waffe“ im Nahen Osten sah. In diesem Sinne war seine Haltung eindeutig antizionistisch – eine Position, die bis heute vom iranischen Regime vertreten wird.
Zurück zu den Christen im Iran: Die historischen christlichen Gemeinschaften sind im Iran anerkannt und werden vom Staat geschützt. Die Missionsmöglichkeiten, die während der Schah-Zeit bestanden, wurden nach 1979 aber massiv eingeschränkt. Von einer echten Freiheit der Kirche kann keine Rede sein, da Konversionen vom Islam zum Christentum verboten sind und sogar mit dem Tode bestraft werden können. Dennoch blieb das Verhältnis der katholischen Kirche zum neuen Regime relativ gut, da der Kultus vom Mullah-Regime geachtet wird. Aber auch, weil die katholische Seite in der Gesamtausrichtung mehr Anknüpfungspunkte zum schiitischen Islam als zum sunnitischen sieht.
Dies änderte sich erst unter Papst Franziskus, der seine Aufmerksamkeit – weniger religiös, sondern mehr politisch – verstärkt sunnitischen Akteuren zuwandte, insbesondere im Golfraum, und 2019 mit einem sunnitischen Vertreter in Abu Dhabi die umstrittene Erklärung zur Brüderlichkeit aller Menschen unterzeichnete.
Die grundsätzlich nicht schlechten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der iranischen Führung wurden in den vergangenen Jahrzehnten jedoch stark erschwert und überschattet durch den westlichen Druck, der den Iran als „Achse des Bösen“ und verruchten Feind stigmatisierte. Seitdem gilt auch jeder als stigmatisiert, der den Kontakt zu den „Ausgestoßenen“ pflegt – eine heikle Gratwanderung für die vatikanische Diplomatie. Dieselbe Gratwanderung erleben die Christen im Iran zwischen Anerkennung und Verfolgung.
Unklar ist, ob und inwieweit die im Jahre 1979 eingeführte Kopftuchpflicht für Frauen noch gilt.
Vor wenigen Wochen verbreitete sich die Meldung, diese Pflicht sei aufgehoben worden. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang jedoch nicht vor, weshalb das Gesetz weiterhin in Kraft ist.
Tatsache ist, daß sich viele Frauen schon längst nicht mehr flächendeckend daran halten. Ebenso gilt als Fakt, daß ein Teil der Behörden auf eine strikte Durchsetzung verzichtet.
Die Frage scheint innerhalb der iranischen Staatsführung jedoch noch nicht abschließend entschieden zu sein.
Die Iran-Frage, von der hier nur einige Aspekte angesprochen wurden, erweist sich jedenfalls als vielschichtiger und komplexer, als es die westliche Öffentlichkeit seit Jahrzehnten wahrzunehmen scheint.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Youtube/EFE (Screenshot)