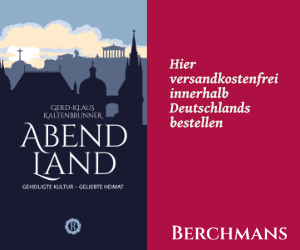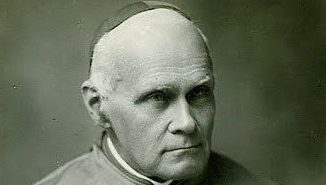In der Bibel gibt es weder den Papst noch ein Konklave, so wenden es protestantische Christen gegenüber Katholiken ein: Das Papsttum habe keine biblische Grundlage; es sei eine im Laufe der Zeit entstandene Institution, in der Schrift nicht vorhanden und von Jesus nicht gewollt. Dem ist aber nicht so.
Was sagt die Bibel über den Papst oder das Papsttum? Warum gibt es das Konklave nicht in der Bibel? Was ist die biblische Grundlage des Papsttums? Das sind Fragen, die einem katholischen Christen von einem nichtkatholischen Christen gestellt werden könnten, etwa von einem Evangelikalen.
Als Beispiel von vielen wird der Artikel eines protestantischen Predigers als Ausgangspunkt genommen, der alle Gründe darlegt, weshalb die Gestalt des Papstes nicht in der Bibel zu finden sei und der Begriff des Papsttums biblisch nicht begründet sei.1
Die Protestanten („getrennte Brüder“, wie Johannes Paul II. sie nannte) meinen zudem, daß die Anerkennung des Papstes für einen Christen nicht notwendig sei; da sie nicht auf der Bibel beruhe, halten sie die päpstliche Autorität für dem Evangelium fremd.
Da der Papst in der Bibel nicht vorkommt, sei er als Gestalt eine spätere Hinzufügung, Frucht geschichtlicher Entwicklungen und nicht eines ausdrücklichen Willens Christi. Die offene Feindseligkeit Martin Luthers gegenüber dem Papst und dem Papsttum tat das Ihre, um die Haltung des Protestantismus in dieser Frage nachhaltig negativ zu bedingen.
Aber ist das wirklich so, wie es die Protestanten denken? Wie antwortet man denen, die solche Argumente vertreten?
Mit dem folgenden Dossier werden die häufigsten Einwände gegen die biblische Fundierung des Papsttums dargelegt – und widerlegt.
1. Das protestantische Problem der „Sola Scriptura“
Bevor wir in die Argumentation einsteigen, ist vorwegzuschicken, daß diese Einwände gegen das Papsttum von einem typisch protestantischen Grundsatz ausgehen: der Sola Scriptura.
Dieser Ansatz behauptet, alles, was den Glauben betrifft, müsse ausdrücklich in der Bibel enthalten sein.
Aber dieser Gedanke ist schon aus dem einfachen Grund umstritten, daß er selbst nicht biblisch ist: Kein Vers erklärt, die Bibel allein sei die einzige normative Quelle des Glaubens.
Das ist derselbe Fehler wie bei jemandem, der behauptet: „Es gibt keine absolute Wahrheit“, und dabei vorgibt, eine absolute Wahrheit auszusprechen und sich damit selbst widerspricht. Oder bei dem, der behauptet, nur das sei wahr, was empirisch überprüfbar ist – ohne zu merken, daß das Prinzip selbst es nicht ist.
Technisch nennt man das einen performativen Fehler. Man kann tatsächlich sagen: Die Bibel selbst lehrt die Sola Scriptura nicht!
Im Gegenteil schreibt der heilige Paulus:
„So steht also fest, Brüder, und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr unterwiesen wurdet, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns“ (2 Thessalonicher 2,15).
Der christliche Glaube wird durch Schrift und Tradition überliefert, bewahrt und vom Lehramt der Kirche ausgelegt – allen voran vom Nachfolger Petri. Die Schrift kommt aus der Tradition und wurde durch die kirchliche Hierarchie fixiert, nicht zuletzt durch die des Petrus bzw. seiner Nachfolger.
Nebenbei bemerkt glauben die allermeisten Protestanten an die Trinität (Dreifaltigkeit). Auch dieser Begriff fehlt als Wort in der Bibel; das ist jedoch wenig bedeutsam, denn der Inhalt ist vollständig vorhanden, wie von ihnen anerkannt wird.
2. Petrus und die unmittelbare Einsetzung durch Jesus
Ein zweites Argument als Antwort an jene, die den Petrusprimat bezweifeln, besteht darin, sich auf die Gestalt des Apostels Petrus selbst zu konzentrieren.
Während protestantische Christen behaupten, Petrus habe keinerlei Vorrangstellung gegenüber den anderen Aposteln ausgeübt, genügt ein sorgfältiger Blick ins Neue Testament, um die Vorstellung zu widerlegen, Petrus sei nur „ein Apostel unter vielen“ gewesen.
Jesus selbst sagt zu ihm: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt 16,18). Er sagt nicht „ihr“, wie sonst, wenn er sich an seine Jünger wendet, sondern „du“.
Katholische Bibelwissenschaftler erinnern jedoch an eine wichtige Präzisierung zu diesem Vers.
Der herausragende Exeget John P. Meier (University of Notre Dame) schreibt beispielsweise, man solle im Begriff „Kirche“ hier nicht den ursprünglichen Sinn von ekklēsia lesen, also die spätere christliche Kirche, lokal oder universal, sondern die Versammlung Jesu, seine eschatologische Sammlung, das zum Hören und Anbeten Gottes versammelte Volk Israel. So schreibt J. P. Meier:
„Petrus sollte der Fels für die eschatologische Sammlung Israels sein. In seiner Führungsrolle sollte Petrus, der Fels, einen festen Schutz gegen alle zerstörerischen Kräfte der Sünde und des Todes bilden, die die Versammlung des Gottesvolkes anfallen würden […]. Die autoritative Lehre des Petrus, an Israel hier auf Erden gerichtet, würde von Gott im Himmel bestätigt werden und so ein sicherer Schutz gegen die feindlichen Mächte der Sünde und des Todes sein, die die eschatologische Versammlung zu zerstören suchen.“2
Der Name „Petrus“ (aramäisch Kepha) bedeutet „Fels/Stein“. Es ist kein Zufall, daß Christus den Namen des Simon in Petrus geändert hat – ein Akt, der in der Bibel stets eine besondere Sendung anzeigt (Abraham, Jakob usw.). Dieses Ereignis wird in verschiedener Weise von allen vier Evangelien bezeugt.
Unmittelbar danach überträgt Jesus ihm die Schlüssel des Himmelreichs (Vers 19), ein in der jüdischen Kultur sichtlich autoritätssymbolisches Zeichen (vgl. Jesaja 22,20–22).
Im Johannesevangelium vertraut der auferstandene Jesus zudem einzig Petrus die Sorge um seine Herde persönlich und direkt an: „Weide meine Lämmer … weide meine Schafe“ (Joh 21,15–17). Er wiederholt es feierlich dreimal. Keinem der anderen Apostel sagt er das einzeln.
Das weist auf einen pastoralen Primat hin, nicht auf eine bloße Ehrenstellung.
Auch der US-Exeget J. P. Meier erkennt darin eine Einsetzung des Petrus „zu einer Autorität über die ganze Kirche“.3 Und er fügt hinzu:
„Sowohl in Mt 16,18–19 als auch in Joh 21,15–17 wählt Jesus den Petrus unter den anderen im Kontext genannten Jüngern aus und verleiht allein Petrus eine besondere Funktion und Autorität über die Kirche bzw. die Herde Jesu […]. Nun, nach der Auferstehung, wird allein Petrus vom auferstandenen Jesus damit beauftragt, die Lämmer und Schafe der Herde zu weiden, zu nähren und für sie zu sorgen, wobei er seine Hirtenrolle dadurch erweist, daß er – in Nachahmung Jesu – sein Leben als Märtyrer hingibt. Die Autorität, die Petrus direkt von Jesus erhält, erstreckt sich allem Anschein nach ohne Einschränkung auf die gesamte Kirche: Petrus wird vom johanneischen Jesus beauftragt, ‚meine‘ Lämmer und ‚meine‘ Schafe zu weiden. Gewiß nicht nur eine bestimmte Ortsgemeinde.“4
Die Rolle des Petrus ist also unmittelbar durch Jesus eingesetzt.
Zusammengefaßt ist es gerade die Schrift, die die Sonderstellung des Petrus klar aufzeigt:
- Er steht in den Apostellisten stets an erster Stelle (Mt 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apg 1,13).
- Er ist der einzige, der zu Jesus über das Wasser geht (Mt 14,29).
- Er ist der einzige Apostel, der die Schlüssel des Himmelreichs empfängt (Mt 16,19).
- Er ist der erste Apostel, dem der Auferstandene erscheint (Lk 24,34).
- Nur er erhält vom auferstandenen Christus einen dreifachen Auftrag und eine dreifache Bestätigung (Joh 21,15–17).
- Er hält an Pfingsten die erste nachösterliche Rede (Apg 2).
- Er ist es, der Entscheidungen anführt (Apg 15).
- Er eröffnet die Heidenmission (Apg 10).
- Er ergreift die Initiative zur Nachwahl des Judas (Apg 1,15–26).
Blicken wir auf den ersten Punkt: Petrus steht in allen Verzeichnissen der zwölf immer an erster Stelle (einschließlich der vorpaulinischen Formel in 1 Kor 15,5).
Manche nehmen an, das liege daran, daß Petrus der zuerst berufene Jünger gewesen sei.
Das stimmt jedoch nicht, wie wiederum J. P. Meier erläutert5: Seine Berufung erfolgt zusammen mit anderen Jüngern und im Johannesevangelium erst, nachdem zwei andere (Andreas und Johannes) Jesus bereits begegnet waren.
Die einzige Erklärung dafür, daß Petrus immer zuerst genannt wird, bleibt demnach diese:
„Alle vier Evangelien (plus die Apostelgeschichte) stellen Petrus als Sprecher und/oder Führer der Jünger im allgemeinen oder der zwölf im besonderen dar (Mk 1,36; 8,29; 9,5; 10,28; 14,29–37; Mt 15,15; 16,18; 17,24; 18,21; Lk 12,41; Joh 6,68). Das – und nicht die zweifelhafte Behauptung, er sei der zuerst Berufene gewesen – erklärt zumindest teilweise, warum Petrus in den vier Listen der zwölf (die die markinische und die L‑Tradition repräsentieren) immer als erster genannt wird.“6
Demnach sind Primat, Sukzession und sogar eine anfängliche Form von Unfehlbarkeit bereits in den biblischen Texten impliziert.
Was hat es mit der Unfehlbarkeit auf sich? Gemeint sind die Worte Jesu an Petrus (und nur an ihn): „Alles, was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein“ (Mt 16,19).
Diese Verheißungen lassen sich nicht einfach mit der „persönlichen Ausstrahlung“ des Petrus erklären. Sie sind nur verständlich, wenn Christus ihn als sichtbaren Führer der Kirche eingesetzt hat.
2.1 Der Einwand vom „Ältesten“
Ein erster Einwand gegen die eben dargelegte Sonderrolle des Petrus verweist gewöhnlich auf eine Bibelstelle, nämlich 1 Petrus 5,1–5.
In diesem Brief wendet sich Petrus an die „Ältesten“ (Presbyter), also die Leiter der Gemeinden, und schreibt: „Eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird“ (1 Petrus 5,1–5).
Nach Auffassung derer, die diesen Einwand erheben, beweise die Aussage, er sei ein Ältester „wie sie“, daß er weder einen Primat noch eine besondere Autorität gehabt habe.
Das beweist die Abwesenheit eines Primats jedoch keineswegs.
Echte christliche Autorität äußert sich nämlich immer in Demut. Auch Paulus erklärt in 1 Korinther 15,9, er sei „der letzte der Apostel“, und doch bestreitet niemand seine lehramtliche Autorität.
Daß Petrus einen demütigen Ton anschlägt, entspricht dem Modell des Servus servorum, des Knechtes der Knechte Gottes, Dieners der Diener Gottes, das später selbst der Titel der Päpste sein wird.
So waren etwa im Jahr 2025 die ersten Worte von Papst Leo XIV.: „Es gibt eine unverzichtbare Anforderung für alle, die in der Kirche ein Leitungsamt ausüben: zu verschwinden, damit Christus bleibt, sich klein zu machen, damit ER erkannt und verherrlicht wird.“7
Zudem wird Autorität auch im Neuen Testament nie als Herrschaft, sondern als Dienst verstanden (vgl. Mt 20,25–28).
Daß sich Petrus also als einer unter den Ältesten vorstellt, heißt nicht, daß er nicht zugleich der erste unter Gleichen gewesen wäre.
2.2 Der Einwand betreffend das Konzil von Jerusalem
Ein zweiter Einwand, der gewöhnlich vorgebracht wird, um zu behaupten, Petrus habe keine besondere Autorität gehabt, ist die angeblich fehlende Führungsrolle beim ersten Konzil der Kirche, dem Konzil von Jerusalem.
In der Apostelgeschichte wird geschildert, wie die Jünger darüber stritten, ob die Heiden sich zur Rettung beschneiden lassen müßten.
Wer diese Passage als Einwand nutzt, meint, aus den Dynamiken der Wortmeldungen der verschiedenen Jünger sei eine fehlende Führungsrolle des Petrus abzulesen.
Tatsächlich aber trifft das Gegenteil zu.
Zunächst gilt es festzuhalten, daß Petrus als erster das Wort ergriff und erklärte: „Brüder, ihr wißt, daß Gott schon vor längerer Zeit unter euch die Entscheidung getroffen hat, daß durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und gläubig werden sollten“ (Apg 15,7).
Dann legte er einen grundlegenden Lehrsatz fest: „Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des Herrn, gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene“ (Apg 15,10–11).
Als die Versammlung schwieg, ergriffen Paulus und Barnabas das Wort, und Jakobus war es, der laut Text das Konzil abschloß und das letzte Wort sprach.
Niemand widersprach jedoch Petrus, und Jakobus schloß die Versammlung schlicht in Erinnerung an das, was Simon Petrus eingangs festgelegt hatte, und stimmte ihm zu: „Brüder, hört mich an! Simon hat berichtet, daß Gott selbst zuerst eingegriffen hat, um aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen“ (Apg 15,14).
All das zeigt genau das, was die Kirche immer geglaubt hat: Petrus handelt nicht als isolierter Tyrann, sondern als Leiter in der apostolischen Gemeinschaft. Sein Beitrag ist lehrmäßig entscheidend, auch wenn die Form synodal ist.
2.3 Der Einwand vom Tadel des Paulus
Ein dritter Einwand, der häufig erhoben wird, um zu behaupten, Petrus habe keine besondere Autorität gehabt, ist der Tadel, den er von Paulus erhielt.
Gemeint ist die bekannte Episode im Galaterbrief (2,11–14), in der Paulus berichtet, Petrus wegen seiner Unstimmigkeit im Verhalten gegenüber Christen aus dem Judentum zurechtgewiesen zu haben.
Beachten wir hierzu folgendes:
1. Paulus tadelt Petrus wegen seines Verhaltens (aus Angst vor Kritik aß er nicht mehr mit heidenchristlichen Brüdern), nicht wegen seiner Lehre. Beide stimmten in der Freiheit der Heiden gegenüber dem Gesetz überein. Petrus irrt aus Furcht („zog er sich von den Heiden zurück und trennte sich von ihnen, weil er die Beschnittenen fürchtete“, sagt Paulus), nicht in der Lehre;
2. daß Paulus Petrus korrigiert, negiert dessen Primat nicht. Auch heute kann ein Bischof den Papst in praktischen oder disziplinären Fragen kritisieren (das kam etwa unter Papst Franziskus öfter vor), ohne daß damit seine Stellung in Frage gestellt worden wäre.
Der Tadel selbst zeigt vielmehr, wie bedeutsam der Einfluß des Petrus war: Sein Verhalten erregte Anstoß, weil es als Vorbild gesehen wurde („Ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich die anderen Juden, sodaß auch Barnabas durch ihre Heuchelei verführt wurde“, präzisiert Paulus). Wäre Petrus ein „Apostel wie jeder andere“ gewesen, hätte niemand so viel Aufhebens gemacht.
Daß Petrus in Gemeinschaft wirkt und sich demütig korrigieren läßt, widerlegt also nicht das zuvor beschriebene katholische Modell des Primats, sondern bestätigt es: ein Primat des Dienstes, nicht der Herrschaft.
Zu dieser Episode zitieren wir einen Kirchenvater, den heiligen Cyprian, aus dem 3. Jahrhundert:
„Nicht einmal Petrus, den der Herr als ersten auswählte und auf dem er seine Kirche gründete, wollte unverschämt recht behalten oder eine hochmütige Haltung einnehmen, als hätte er den Primat und als wäre es eher angebracht, daß die Neuangekommenen und Jüngeren ihm gehorchten; noch verachtete er Paulus, weil dieser in der Vergangenheit ein Verfolger der Kirche gewesen war; vielmehr erkannte er die Gründe der Wahrheit an und stimmte bereitwillig der Vernünftigkeit zu, auf die Paulus pochte. So hinterließ er uns ein Zeugnis der Einmütigkeit und Geduld, damit wir nicht verbohrt an unseren eigenen Positionen hängen, sondern vielmehr das Nützliche und Heilsame annehmen, das uns bisweilen von unseren Brüdern und Mitbischöfen vorgeschlagen wird, sofern es wahr und rechtmäßig ist.“8
3. Das Papsttum ist kein mittelalterliches Konstrukt
Ein drittes Thema, das im Dialog mit einem protestantischen Christen aufkommen kann, lautet, ob das Papsttum eine im Lauf der Geschichte – insbesondere im Mittelalter – entstandene Institution sei, die sich eher aus historischen und politischen Notwendigkeiten als aus einem evangeliumsgemäßen Auftrag entwickelt habe.
Der genannte Baptistenpastor Adam Dooley schreibt zum Beispiel: „Der erste anerkannte Papst trat erst im 5. Jahrhundert hervor, als Leo I. Bischof von Rom wurde“. Außerdem seien Bischöfe wie Athanasius von Alexandria oder Cyprian von Karthago liebevoll „Papa“ genannt worden, was im Griechischen schlicht „geistlicher Vater“ bedeute. In der koptischen Kirche wird der Patriarch von Alexandria noch heute Papa (arab. Baba) genannt.
Diese Betrachtung gibt zwar reale historische Elemente wieder, verwechselt aber die Entwicklung des Papsttums mit dessen Ursprung.
Zunächst ist es richtig, daß der Titel „Papst“ in den ersten Jahrhunderten weiter gefaßt verwendet wurde; doch keiner der genannten Bischöfe wurde so zu Rate gezogen oder ihm so gehorcht wie dem Bischof von Rom.
Was das Papsttum betrifft, ist seine Entwicklung im Lauf der Jahrhunderte selbstverständlich – wie bei jeder lebendigen Institution –, aber wie wir im ersten Punkt gesehen haben, sind seine Wurzeln zutiefst biblisch.
Die Anerkennung der einzigartigen Rolle des Bischofs von Rom geht zudem Leo dem Großen lange voraus und beschränkt sich nicht auf die Verwendung eines Titels.
Apostolische Sukzession und römischer Primat sind bereits in den ersten Jahrhunderten bezeugt:
- Polykarp von Smyrna, um 100 n. Chr., war ein direkter Schüler des Apostels Johannes. Anläßlich der ersten Auseinandersetzung über das Osterdatum reiste er – obwohl fast hundertjährig – aus Asien nach Rom, um beim Bischof von Rom Nachsicht zu erwirken. Ein so bedeutsamer Besuch, daß der heilige Irenäus noch vierzig Jahre später in einem Brief an Papst Viktor davon sprach.9
- Papst Clemens I., Ende des 1. und Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr., wurde aufgefordert, einen Streit in der Kirche von Korinth zu schlichten. Sein feierlicher, von Autoritätsbewußtsein geprägter Brief wurde von der Kirche von Korinth sofort angenommen und – wie Dionysius von Korinth in einem an Papst Soter gerichteten Schreiben bezeugt10 – lange Zeit in den eigenen liturgischen Versammlungen verlesen.
- Der heilige Ignatius von Antiochien nennt zu Beginn des 2. Jahrhunderts die Kirche von Rom jene, die „der allumfassenden Gemeinschaft der Liebe vorsteht, die das Gesetz Christi trägt“.11
- Der heilige Irenäus von Lyon schrieb gegen Ende des 2. Jahrhunderts: „In Rom haben Petrus und Paulus das Evangelium verkündigt und die Kirche gegründet“12, und: „Mit dieser Kirche \[von Rom] muß schon um ihrer vorzüglicheren Herkunft willen notwendig jede Kirche übereinstimmen, das heißt die Gläubigen von überallher – denn in ihr ist die von den Aposteln stammende Tradition immer für alle Menschen bewahrt worden“13. Irenäus, ein sehr früher Zeuge, schrieb dies nicht aus Rom, sondern aus Gallien – und sprach vom römischen Primat als von einer bereits bekannten und anerkannten Gegebenheit.
- Das Konzil von Sardika (343/344 n. Chr.) legte in Kanon 3 das Recht eines von einer Provinzialsynode abgesetzten Bischofs fest, beim Bischof von Rom Berufung einzulegen.
- Auf dem Konzil von Chalkedon (451 n. Chr.) riefen die orientalischen Bischöfe aus: „Petrus hat durch Leos Mund gesprochen!“ – eine Anerkennung der Verbindung zwischen dem regierenden Papst und Petrus auch seitens des Ostens.
Die römische Kirche, geleitet von den Nachfolgern Petri, genoß also bereits eine anerkannte Autorität, ehe Rom ein politisches Zentrum des lateinischen Christentums wurde und ihm mit dem Kirchenstaat weltliche Macht zuwuchs. Rom wurde auch nicht deshalb Zentrum des Glaubens, weil es kaiserliche Hauptstadt war, sondern weil dort Petrus und Paulus starben und dort ihre apostolische Sukzession ununterbrochen bewahrt wurde.
Die Frage ist daher nicht, wann der Titel „Papst“ formell erstmals verwendet wurde oder ob der Begriff „Papst“ in der Bibel steht, sondern ob Petrus von Christus einen Autoritätsprimat erhalten hat – und ob diese Autorität an seine Nachfolger weitergegeben wurde.
3.1 Der Einwand des Abendländischen Schismas
Ein verbreiteter Einwand nimmt das Abendländische Schisma (1378–1417) in den Blick, während dessen – so heißt es – das Papsttum erst als geeintere und anerkanntere Institution hervorgetreten sei.
Das ist historisch richtig, doch die innere Krise der lateinischen Kirche mit mehreren Prätendenten stritt darüber, wer der wahre Papst sei, ohne die Funktion des Papsttums je selbst in Zweifel zu ziehen (das taten nicht einmal die gemäßigten Hussiten).
Im Gegenteil: Das Konzil von Konstanz (1414–1418) arbeitete daran, die Einheit um den rechtmäßigen Nachfolger Petri wiederherzustellen. Das Papsttum entstand nicht erst damals – es wurde vielmehr verteidigt.
Wer daran Anstoß nimmt, daß die Gestalt des Papsttums im Laufe der Zeit gewachsen ist, muß verstehen, daß dies für jede Lehre etwas Natürliches ist.
Beispielsweise wurde Maria nicht erst 1950 in den Himmel aufgenommen, als das Dogma verkündet wurde. Jesus wurde nicht im Jahr 325 göttlich, als Nicäa seine Gottheit definierte. Und die Bücher der Heiligen Schrift wurden nicht erst auf dem Konzil von Trient irrtumsfrei.
Es braucht manchmal Zeit, bis die Kirche formal anerkennt – oft im Zuge von aufgeworfenen Streitfragen –, was von Anfang an vorhanden ist. Solange etwas nicht in Frage gestellt wird, wird es allgemein angenommen. Erst Streitfragen machen ausdrückliche, konkrete lehramtliche Definitionen notwendig.
Es ist, als wollte man die Eiche in der Eichel sehen: Es scheinen zwei verschiedene Dinge zu sein. Und doch wird aus dem Samen in einem organischen und kontinuierlichen Wachstum erst ein Keim, dann ein kräftiger Baum. So versteht die katholische Sicht die Lehrentwicklung.
3.2 Die historische Anwesenheit des Petrus in Rom
Zwar ist für den Primat nicht notwendig, die Anwesenheit des Petrus in Rom zu belegen; dennoch wird die Tatsache, daß Petrus in Rom war, von verschiedenen alten Quellen bezeugt.
Dazu zählen Clemens von Rom (1. Jh.), Papias, Irenäus und Klemens von Alexandria (2. Jh.), Eusebius von Cäsarea (4. Jh.).
Außerdem akzeptiert die erdrückende Mehrheit der Forscher dies als gesicherten Befund.14
Auch die archäologischen Ausgrabungen unter dem Petersdom in Rom aus den 1940er und 1950er Jahren stehen in Einklang mit der Lokalisierung des Martyriums des Petrus auf dem Vatikanhügel.15
Ein verbreiteter Einwand gegen die Anwesenheit des Petrus in Rom ist sein Fehlen in den Grüßen des Römerbriefes des Paulus.
Das beweist jedoch nicht, daß Petrus nie in Rom war. Verschiedene alte Quellen (Eusebius, Hieronymus, Orosius) bezeugen, daß Petrus um 42 n. Chr. dorthin kam, 49 n. Chr. aufgrund des Claudius-Edikts Rom verlassen mußte und später zurückkehrte, bis zu seinem Martyrium unter Nero 64 n. Chr.
Es ist daher plausibel, daß Petrus zum Zeitpunkt des Römerbriefes (etwa 57 n. Chr.) schlicht nicht in Rom war, weil er auf Mission unterwegs war.
4. Die Aufgabe des Papstes: die Kirche und die Einheit
Warum sollte ein Christ den Papst brauchen, fragen unsere protestantischen Brüder. Die Kirche könne sehr wohl ohne ein irdisches Oberhaupt leben; sie werde direkt von Christus geführt.
Wenn dem so wäre, warum hätte Jesus Petrus dann eine so spezifische Rolle zugedacht und ihm eine so konkrete Aufgabe übertragen? Warum ergreift Petrus nach der Himmelfahrt regelmäßig im Namen der Apostel das Wort (Apg 1–15)? Warum entscheidet er über die Wahl des Matthias, spricht an Pfingsten, leitet das erste Konzil von Jerusalem?
Die Kirche ist der mystische Leib Christi, aber auch eine sichtbare, geschichtliche Wirklichkeit. Jeder Leib hat einen sichtbaren Kopf: In der Kirche ist das der Papst, der Stellvertreter Christi.
Ohne zentrale Autorität droht die lehrmäßige Zersplitterung: Das zeigt gerade die unüberschaubare Vielzahl an protestantischen Denominationen, die in grundlegenden Lehren uneins sind. Das zeigt auch die Gefahr der Spaltung innerhalb des Katholizismus in jenen Bereichen, die die päpstliche Autorität in Frage stellen.
Wozu dient der Papst? Er dient der Bewahrung der Einheit in der Wahrheit. Seine Sendung ist, der Wahrheit zu dienen, nicht, sie zu schaffen. Der Beleg zeigt sich in der Einheit der katholischen Kirche, während alle anderen Denominationen und Religionen keine Einheit kennen.
Wie der heilige Cyprian im 3. Jahrhundert sagte:
„Er kann Gott nicht zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat“, und er fügte hinzu: „Dem Petrus zuerst, auf den er seine Kirche gebaut hat und von dem die Einheit ihren Ursprung nahm und offenbar wurde, gab der Herr diese Vollmacht: daß auf Erden gelöst sei, was er löst“.16
In seiner Schrift De catholicae Ecclesiae unitate, entstanden um 251 n. Chr. im Zusammenhang mit den Spaltungen des Novatus (in Karthago) und des Novatian (in Rom), legte derselbe Kirchenvater Cyprian eine sehr klare Auffassung vom Papsttum dar:
„Der Herr spricht zu Petrus: ‚Und ich sage dir‘, sagt er, ‚du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen; und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; und was immer du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, und was immer du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein‘. Und nach der Auferstehung sagt er zu ihm: ‚Weide meine Lämmer‘. Auf ihn baut er die Kirche, und ihm gibt er den Auftrag, die Schafe zu weiden; und obwohl er die gleiche Vollmacht allen Aposteln überträgt, setzt er doch einen einzigen Stuhl ein und begründet mit seiner Autorität Ursprung und Sinn der Einheit. Gewiß waren auch die anderen das, was Petrus war, aber Petrus wurde der Primat gegeben, und eine einzige Kirche und ein einziger Stuhl wurden gezeigt; und alle sind Hirten, doch eine einzige ist die Herde, die als von allen Aposteln in einmütiger Übereinstimmung umsorgt gezeigt wird. Wer diese in Petrus gegenwärtige Einheit nicht bewahrt, glaubt er, sich im Glauben zu halten? Wer den Stuhl Petri verläßt, auf dem die Kirche gegründet ist, meint er, in der Kirche bleiben zu können?“17
Die Bibel, in ihrer Gesamtheit gelesen und in Kontinuität mit der apostolischen Tradition, aus der sie hervorgegangen ist, erlaubt nicht nur das Papsttum, sondern verlangt es vielmehr als sichtbares Fundament der Einheit.
Es handelt sich nicht um eine menschliche Macht, sondern um einen Dienst, den Christus selbst gewollt hat. Nicht zufällig zeigt die Geschichte, daß, wer sich vom Papst trennt, unweigerlich auch vom übrigen Teil der Kirche auseinandergerät.
Die eigentliche Frage lautet nicht: „Ist das Papsttum nützlich?“, Sondern: „Wollte Christus ein sichtbares Fundament für seine Kirche?“, und die Schrift sagt – wie wir gesehen haben: ja.
5. Der Papst und die Bibel
Letztlich beruhen die von protestantischer Seite gegen das Papsttum vorgebrachten Einwände auf einer selektiven Auslegung der Schrift und auf einem der Bibel selbst fremden Grundsatz: der Sola Scriptura.
Im Gegenteil haben wir gesehen, daß das Neue Testament klar zeigt, daß Petrus von Christus eine besondere Rolle erhalten hat – bestätigt sowohl durch Taten als auch durch Worte. Aber auch durch die Geschichte und die Zeugnisse der frühen Kirchenväter.
Die gewöhnlich vorgebrachten Einwände, auf die wir geantwortet haben, widerlegen nicht, sondern bestätigen im Gegenteil ein Leitungsmodell, das zugleich sichtbar, autoritativ und brüderlich ist. Das Papsttum ist keine späte Hinzufügung: Es ist der sichtbare Ausdruck der von Christus für seine Kirche gewollten Einheit.
Der Petrusprimat ist eine biblisch begründete Wirklichkeit, bestätigt von der lebendigen Tradition der Kirche.
Damit stellt sich auch vielmehr die Frage, warum schismatische Teile der Kirche im Osten und die protestantischen Denominationen wirklich das Papsttum ablehnen. Handelt es sich dabei nicht vielmehr um eine Auflehnung? Um die Weigerung, sich einer von Jesus selbst eingesetzten Autorität zu unterwerfen?
*UCCR, Union Rationaler Katholischer Christen, ein seit 2011 aktives Informationsportal, das sich ironisch in bewußtem Kontrast zu einigen sich ähnlich nennenden italienischen Atheistenverbänden so benannte.
Bild: Vatican.va (Screenshot)
1 A. Dooley, Is the papacy biblical?, in: The Christian Post 05.05.2025.
2 John P. Meier: A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Companions and Competitors, 3. Bd, Yale University Press 2001, zitiert nach der italienischen Ausgabe: Un ebreo marginale, Quereniana 2003, S. 250f.
3 Ebd. S. 255.
4 Ebd. S. 256.
5 Ebd. S. 238.
6 Ebd. S. 238f.
7 Predigt von Papst Leo XIV. in der Heiligen Messe mit den wahlberechtigten Kardinälen, Sixtinische Kapelle, 9. Mai 2025.
8 Ciprianus: Epistula 71, ad Quintum.
9 Eusebius: Storia ecclesiastica, V, 24,16.
10 Ebd.
11 Ignatius von Antiochien: Brief an die Römer.
12 Irenäus von Lyon: Adversus Haereses, III, 1,1.
13 Ebd. III, 3,2.
14 Daniel W. Connor: Peter in Rome, Columbia University 1969; Engelbert Kirschbaum: Die Gräber der Apostelfürsten St. Peter und St. Paul in Rom, Societas-Verlag, Frankfurt am Main 1974; Rudolf Pesch: Simon Petrus. Geschichte und geschichtliche Bedeutung des ersten Jüngers Jesu Christi, Hiersemann, Stuttgart 1980.
15 Jocelyn Toynbee & John W. Perkins: The Shine of St. Peter and the Vatican Excavations, Pantheon 1957; John P. Meier: A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Companions and Competitors, 3. Bd, Yale University Press 2001, zitiert nach der italienischen Ausgabe: Un ebreo marginale, Quereniana 2003, S. 242; M. Guarducci: Le reliquie di Pietro sotto la Confessione della Basilica Vaticana, Vatikanverlag, Rom 1965; J.E. Walsh, The bones of St. Peter, Doubleday 1982.
16 Ciprianus: Epistula 73, ad Iubaianum.
17 Ciprianus: De catholicae Ecclesiae unitate.