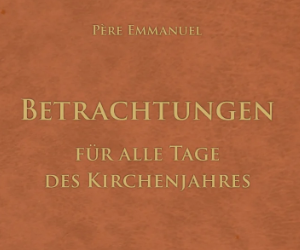Von Roberto de Mattei*
Wir wissen nicht, ob die zehn Jahre zwischen Anfang 2013 und Ende 2023 als die intensivsten des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen werden, aber sie waren mit Sicherheit die unberechenbarsten unseres Lebens.
Das Jahrzehnt beginnt mit einer „Bombe“, dem Rücktritt von Benedikt XVI. am 11. Februar 2013, und endet mit einer weiteren „Bombe“, oder besser gesagt einer „Büchse der Pandora“, wie sie in einem kürzlich erschienenen Buch von Julio Loredo und José Antonio Ureta (Associazione Tradizione Famiglia Proprietà, Rom 2023) treffend bezeichnet wurde: die Synodalitätssynode im kommenden Oktober. Die erste „Büchse der Pandora“, um genau zu sein, war jedoch der Rücktritt Benedikts XVI. vom Papstamt, „ein Blitz aus heiterem Himmel“, wie Kardinal Angelo Sodano es ausdrückte, mit dem alles begann.
Die Möglichkeit des Verzichts auf das Papstamt ist im Kirchenrecht vorgesehen (can. 332, § 2), wurde aber nur ganz selten in Anspruch genommen. Zudem erschienen die Gründe und Modalitäten der Abdankung eigenartig. Bis zum letzten Tag seines Lebens wiederholte Benedikt XVI., daß seine Entscheidung keinen anderen Grund hatte als seinen schwachen psychophysischen Zustand, eine „körperliche und geistige Erschöpfung“, wie Msgr. Georg Gänswein auf den Seiten seines der „historischen Abdankung“ gewidmeten Buches erklärte („Nichts als die Wahrheit. Mein Leben mit Benedikt XVI., Herder, Freiburg i. B. 2023). In einem Brief vom 28. Oktober 2022 an seinen Biographen Peter Seewald, wenige Wochen vor seinem Tod, erklärte Benedikt, das „zentrale Motiv“ für seinen Rücktritt war „die Schlaflosigkeit, die mich seit dem Weltjugendtag in Köln [August 2005] ununterbrochen begleitet“. Seine unmißverständlichen Äußerungen haben jedoch nicht dazu geführt, den abenteuerlichsten Spekulationen ein Ende zu setzen, die sogar so weit gingen, zu behaupten, daß dieser Rücktritt in Wirklichkeit nie stattgefunden habe und daß Benedikt XVI. weiterhin gegen den „Usurpator“ Franziskus regiert habe.
Papst Ratzinger konnte sich sicher nicht vorstellen, daß er in den zehn Jahren nach seinem Pontifikat das Debakel miterleben muß, das durch die Wahl von Franziskus ausgelöst wurde, nicht zuletzt deshalb, weil er sicher war, daß sein Nachfolger Kardinal Angelo Scola sein würde. Als der erste weiße Rauch aus dem Schornstein des Petersdoms aufstieg, brachte eine Erklärung der Italienischen Bischofskonferenz am 13. März 2013 um 20.24 Uhr „die Gefühle der gesamten italienischen Nation zum Ausdruck über die Nachricht von der Wahl von Kardinal Angelo Scola zum Nachfolger des Petrus“. Nach zuverlässigen Rekonstruktionen führte Scola im Konklave 2013 im ersten Wahlgang, bevor er von Bergoglio überholt wurde, der im fünften Wahlgang gewählt wurde (Gerard O’Connel: The election of Pope Francis. An Inside Account of the Conclave that Changed History, Orbis Books, 2021).
Die Vorhersagen wurden durch das Votum amerikanischer Kardinäle umgestoßen, die davon überzeugt waren, daß es eine tiefgreifende innere Reinigung der Kirche brauchte und daß kein italienischer Kardinal dazu in der Lage wäre. Dank ihrer entscheidenden Stimme wurde Jorge Mario Bergoglio gewählt. Wer hätte gedacht, daß sich gerade im amerikanischen Episkopat zehn Jahre später der entschiedenste Widerstand gegen Papst Franziskus manifestieren würde?
Sowohl die Konservativen als auch die Progressiven wünschten sich innerkirchliche Reformen, und Bergoglio präsentierte sich als „geistlicher“ Kandidat, der in der Lage sei, diese Reformen umzusetzen. Wer hätte gedacht, daß Papst Franziskus der „politischste“ der Päpste der vergangenen hundert Jahre sein würde (siehe Jean-Pierre Moreau: La conquête du pouvoir, Contretemps, Paris 2023) und daß seine Reformen sensationell scheitern würden?
Die Ernennung von Kardinal George Pell zum ersten Präfekten des Wirtschaftssekretariats am 24. Februar 2014 schien eine Garantie für die Konservativen zu sein, die sich jedoch bald bewußt wurden, daß sich die Reformen verzögerten und sich stattdessen lehrmäßige und pastorale Mißverständnisse häuften, insbesondere nach dem apostolischen Schreiben Amoris laetitia vom 19. März 2016. Vier hochrangige Kardinäle (Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra, Joachim Meisner) legten der Glaubenskongregation am 16. September 2016 fünf Dubia vor: Es war vielleicht absehbar, daß es darauf nie eine Antwort geben würde, was aber unerwartet kam, war das Ableben von zwei der vier Kardinäle: Joachim Meisner am 5. Juli 2017 und Carlo Caffarra am 6. September desselben Jahres, was das weitere öffentliche Vorgehen der beiden verbliebenen Kardinäle unwegsam machte.
Inzwischen hatte die australische Polizei am 29. Juni 2017 die Anklage gegen Kardinal Pell wegen „schwerer sexueller Vergehen“ an Minderjährigen bestätigt. Pell wurde von den Geschworenen im australischen Bundesstaat Victoria für schuldig befunden und am 13. März 2019 zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Erst am 7. April 2020 wurde er vom Höchstgericht einstimmig freigesprochen und nach mehr als einem Jahr Haft wieder freigelassen. Der australische Kardinal, der in praktischen Dingen aktivste und fähigste der Kurienkardinäle, kehrte nach Rom zurück und begann, die antibergoglianischen Reihen für das nächste Konklave zu organisieren, verstarb jedoch unerwartet am 10. Januar 2023. Während seines Requiems fand nur wenige Schritte entfernt im Vatikan eine hitzige Anhörung im Prozeß gegen Kardinal Angelo Becciu statt, ein noch offenes Gerichtsverfahren mit vielen Unbekannten, in das Papst Franziskus verwickelt ist.
Wer hätte außerdem die Enttäuschung über Papst Franziskus selbst bei den Progressiven erahnen können, die seine Wahl enthusiastisch begrüßt hatten? Der Historiker Alberto Melloni nannte im April 2013 die Ankündigung der Kurienreform durch Papst Franziskus „den wichtigsten Schritt in der Geschichte der Kirche der vergangenen zehn Jahrhunderte und in der fünfzigjährigen Rezeptionsgeschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils“ (Corriere della Sera, 14. April 2013). Zehn Jahre später bezeichnete derselbe Melloni das Prinzip, auf dem die Apostolische Konstitution Praedicate evangelium vom 19. März 2022 über die Neuorganisation der Römischen Kurie beruht, als „eine These, die das Zweite Vatikanische Konzil ins Herz trifft und, daß das ein entscheidender Punkt für die Zukunft der Kirche ist“ (La Repubblica, 24. August 2022). Der Vorwurf lautet, den Vorrang der sakramentalen vor der rechtlichen Ordnung geleugnet zu haben, der einer der Eckpfeiler der neuen Konzilslehre gewesen war.
„Das Eindringen von Franziskus löste einen Schock aus. Ein Zusammenprall der Kulturen. Je nach Sensibilität wurde er als Alptraum, als irdischer Schock oder als echte Befreiung empfunden“, schreibt Jean-Marie Guénois in seinem jüngsten Buch „Pape François. La Révolution (Gallimard, Paris 2023), in dem er zu enträtseln versucht, was ein anderer Vatikanist, Massimo Franco, „L’enigma Bergoglio“ (Edizioni Solferino, Mailand 2020) genannt hat. Zu den wenigen klaren Punkten gehört eine radikale Kontinuität, was die Praxis betrifft, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In diesem Sinne hat Abbé Claude Barthe recht, wenn er das gegenwärtige Pontifikat als „eine Apokalypse im wörtlichen Sinne“ bezeichnet, „d. h. eine Offenbarung, insbesondere eine Offenbarung der großen Wende, die die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils nolens volens herbeigeführt haben. Papst Franziskus treibt dieses absolut einzigartige Ereignis auf die Spitze oder macht sein Wesen in jedem Fall viel greifbarer“ (ResNovae, 1. September 2023).
Die „Büchse der Pandora“ des Rücktritts von Benedikt XVI. und der darauf folgenden Wahl von Franziskus hat aber vielleicht die unvorhersehbarsten Folgen im Bereich der traditionstreuen Katholiken hervorgebracht. Die Correctio filialis vom 11. August 2017, die von mehr als 200 Theologen und Gelehrten aus verschiedenen Fachbereichen unterzeichnet wurde, schien in dieser Welt zu lehrmäßiger Einigkeit und Einheitlichkeit zu führen. Die Coronavirus-Pandemie, der russisch-ukrainische Krieg und die unbeständige Haltung von Franziskus haben jedoch dazu beigetragen, sie zu destabilisieren. Die traditionelle Welt ist keine „Acies ordinata“ mehr, wie es bis Januar 2020 den Anschein haben konnte, sondern eine verwirrte und zerstrittene Ansammlung, die sich einem bevorstehenden Ereignis gegenübersieht, das Kardinal Pell als „giftigen Albtraum“ bezeichnete: die Oktobersynode, eine neue „Büchse der Pandora“, von der alles zu erwarten ist, einschließlich der Reaktionen, die sie unweigerlich provozieren wird.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana