
(Rom) Anläßlich des zehnten Jahrestages der Thronbesteigung durch Papst Franziskus ließ die New York Times, das Flaggschiff des globalistischen Establishments, auch eine konservative Stimme zu Wort kommen. Ross Douthats Kolumne „Papst Franziskus’ Jahrzehnt der Spaltung“ wurde von der New Yorker Tageszeitung am Mittwoch, dem 15. März, veröffentlicht. Der Kolumnist attestiert Franziskus, daß dessen Pontifikat „Tage der Drangsal“ erlebe, sich diese der Papst jedoch selbst zuzuschreiben habe, denn er sei es gewesen, der bestrebt war, „auf Schritt und Tritt den größten Wirbelsturm“ auszulösen.
„Da ist der Zweifrontenkrieg, den Rom über Lehre und Liturgie führt, indem es versucht, die Traditionalisten der lateinischen Messe in der Kirche auszurotten, während es die liberalen deutschen Bischöfe diplomatisch davon abhält, ein Schisma auf der linken Flanke des Katholizismus zu provozieren.“
Dann nennt der Kolumnist bereits den Fall des Jesuiten Marko Rupnik als Beispiel „für gut vernetzte Kleriker, die des sexuellen Mißbrauchs beschuldigt werden und gegen die Regeln und Reformen immun zu sein scheinen“, mit denen ihrem Wirken Grenzen gesetzt werden sollen.
Drittens „sind da noch die düsteren Zahlen für die Kirche der Ära Franziskus, wie der sich beschleunigende Rückgang der Zahl der Männer, die weltweit für das Priesteramt studieren“. Die Zahl der Seminaristen, so Douthat, sind seit Beginn des derzeitigen Pontifikats nur rückläufig.
Und schließlich sei die Finanzlage „so desolat“, daß der Vatikan von den Kardinälen „höhere Mieten verlangt, um die jahrelangen Defizite auszugleichen“.
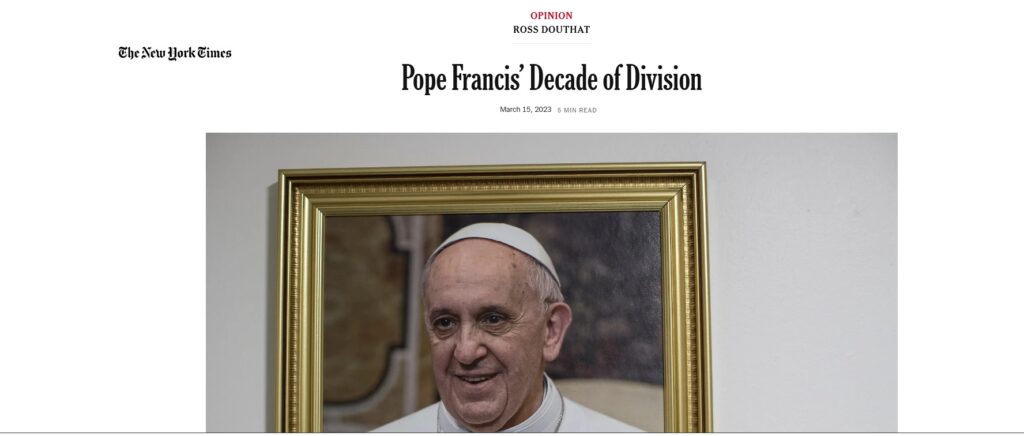
Die säkulare Presse habe gleich mit seiner Wahl „das Narrativ von Franziskus als großem Reformer“ etabliert. „Als gegenteilige Beweise auftauchten“, reagierten dieselben Medien mit eisernem Schweigen. „Es blieb meist seinen konservativen Kritikern überlassen, Listen von Klerikern zu erstellen, die des Mißbrauchs beschuldigt werden und von diesem Pontifex begünstigt wurden, oder auf das Scheitern der Finanzreform“ und auf das Fehlen einer echten Erneuerung hinzuweisen, wie sich in den Kirchenbänken zeige.
Franziskus habe versprochen „die Kirche weniger selbstbezogen, weniger egozentrisch zu machen, stattdessen hat er ein Jahrzehnt erbitterter interner Debatten und wachsender theologischer Spaltungen hervorgebracht, während das offizielle Gerede des Katholizismus vom Rest der Welt mit erstaunlicher Gleichgültigkeit aufgenommen wird“.
Was die „offensichtliche Polarisierung“ in der Kirche angehe, „haben zumindest die Bewunderer des Papstes ihre eigene Erklärung: Das Problem liegt im Widerstand der konservativen Katholiken, insbesondere der konservativen amerikanischen Katholiken, die sein Pontifikat blockiert, behindert und sabotiert haben und sich damit sowohl dem Heiligen Geist als auch der legitimen Autorität Roms widersetzen. Die katholische Rechte hat einen Bürgerkrieg angezettelt und den Papst zu Unrecht beschuldigt, und sein offensichtliches Leitungs- und Führungsversagen ist nur ein Beweis für die Schwierigkeit einer echten und tiefgreifenden Reform.“
Dieser Erklärung der Franziskus-Bewunderer widerspricht Douthat:
„Ich habe einige persönliche Gründe, dieser Darstellung nicht zuzustimmen: Ich war einer der ersten, der an Papst Franziskus gezweifelt hat, weil ich mehr oder weniger die Art von Zerfall befürchtete, die wir gerade erleben“. Seither seien viele seiner konservativen katholischen Mitstreiter in einer Art Opposition gegen Rom (wohl mehr gegen Santa Marta) gelandet, was Douthat mehr als Folge der spezifischen Art und Weise sieht, „in der Franziskus seine Liberalisierung durchgeführt hat, als eine reflexartige Opposition gegen alles, was außerhalb der eigenen Komfortzone liegt“.
Der Kolumnist skizziert ein „kontrafaktisches Szenario“: Man solle sich vorstellen, was gewesen wäre, wenn sein Pontifikat mit seinen „Gesten der Integration und des Willkommens“ und das berühmte „Wer bin ich, um zu urteilen“ sich nicht nur in Richtung der „liberalen Katholiken“ gezeigt hätte; wenn Franziskus sich nicht nur für Änderungen eingesetzt hätte, die von den Progressiven gefordert werden, damit sie sich „leichter in die bestehende Lehre einfügen lassen, wie die Lockerung der Zölibatsregel für Priester oder sogar die Zulassung von Frauen als Diakonen“; wenn er sich ebenso stark um die Einheit der Kirche bemüht hätte; wenn er sich gleichzeitig große Mühe gegeben hätte, „den Konservativen zu versichern, daß die Kirche nicht einfach von ihren Verpflichtungen abrückt oder ihre Lehre zu Ehe und Sexualität auflöst“.
Ein solcher Vorstoß wäre bei den Konservativen „auf Widerstand gestoßen“ – Douthat selbst schreibt von sich, die Aufhebung der Zölibatsregel für einen Fehler zu halten –, während die Liberalen, die sich einen viel radikaleren Wandel wünschen würden, enttäuscht gewesen wären. „Aber die Ziele wären konkret und erreichbar gewesen, die Einschränkungen und Grenzen klar, und der Papst hätte versucht, so etwas wie die Rolle des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn zu spielen, mit seiner Eile, den jüngeren Bruder willkommen zu heißen, aber auch mit seiner liebevollen Unterstützung für den älteren.“
„Stattdessen war Franziskus‘ erste Taktik eine Kontroverse, die in einem viel offensichtlicheren Konflikt mit der katholischen Lehre stand: die Frage der Wiederverheiratung nach einer Scheidung, bei der es um die Worte von Jesus selbst geht.“
Nicht nur das:
Der generelle Ansatz von Franziskus sei es gewesen, „Kontroversen an möglichst vielen Fronten auszulösen: manchmal durch seine Äußerungen, manchmal durch seine Ernennungen und eine Zeitlang durch die bizarre Strategie, wiederholte Gespräche mit einem atheistischen italienischen Journalisten zu führen, der bekanntlich keine Notizen machte, sodaß sich gewöhnliche Katholiken fragten, ob der Papst tatsächlich zum Beispiel die Lehre von der Hölle geleugnet hatte oder ob er sich damit begnügte, daß die Leser von La Repubblica dies dachten.“
Franziskus habe all das ergänzt „mit einer ständigen Kritik an den Konservativen und vor allem an den Traditionalisten“. Douthat erinnert als Kontrapunkt noch einmal an das Verhalten des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn.
„Und als die traditionalistische Fraktion, vorhersehbar, zu einem Brennpunkt der Opposition mit manchmal paranoiden Zügen wurde, entschied sich der Papst, der Dezentralisierung und Vielfalt predigte, für ein grausames Mikromanagement, bei dem er versuchte, die Gemeinden der lateinischen Messe durch so barmherzige Gesten wie das Verbot, ihre Messen in den Pfarrblättern zu veröffentlichen, zu erwürgen.“
Und doch habe der Papst bei alldem für den progressiven Flügel der Kirche „nicht viel Konkretes bewirkt, sondern immer wieder Rückzieher gemacht: Rückzieher bei der Unklarheit über die Kommunion für Geschiedene und Wiederverheiratete, Rückzieher, als es so aussah, als würde er neue Experimente mit verheirateten Priestern zulassen, indem er dem Glaubensdikasterium erlaubte, die Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare, die viele europäische Bischöfe genehmigen wollen, für unmöglich zu erklären“.
Dies habe, wie ebenfalls „vorhersehbar“, sowohl zu „Enttäuschungen über unerfüllte Erwartungen“ als auch zu einem „ständigen Drang“ geführt, „so weit wie möglich zu gehen, sogar in Richtung des liberalen Protestantismus, den vor allem die deutsche Kirche anzustreben scheint, in der Annahme, daß Franziskus gezwungen werden muß, die Veränderungen zu akzeptieren, die er immer wieder ins Auge faßt, aber nie ganz verwirklicht“.
Aus dem Gesagten folgert Douthat abschließend:
„Mit Blick auf das zehnjährige Jubiläum ist dieses Pontifikat nicht nur wegen seines Reformeifers auf unvermeidliche Widerstände gestoßen. Es hat unnötigerweise Kontroversen vervielfacht und Spaltungen verschärft, um einer Agenda willen, die noch immer vage erscheinen mag, und seine Entscheidungen schienen auf Schritt und Tritt darauf ausgerichtet zu sein, die größtmögliche Entfremdung zwischen den kirchlichen Fraktionen zu schaffen und den größten Wirbelsturm zu erzeugen, den man sich vorstellen kann.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va/New York Times (Screenshot)




